Rindenwanzen (Insecta: Heteroptera: Aradidae)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
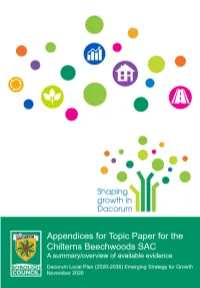
Topic Paper Chilterns Beechwoods
. O O o . 0 O . 0 . O Shoping growth in Docorum Appendices for Topic Paper for the Chilterns Beechwoods SAC A summary/overview of available evidence BOROUGH Dacorum Local Plan (2020-2038) Emerging Strategy for Growth COUNCIL November 2020 Appendices Natural England reports 5 Chilterns Beechwoods Special Area of Conservation 6 Appendix 1: Citation for Chilterns Beechwoods Special Area of Conservation (SAC) 7 Appendix 2: Chilterns Beechwoods SAC Features Matrix 9 Appendix 3: European Site Conservation Objectives for Chilterns Beechwoods Special Area of Conservation Site Code: UK0012724 11 Appendix 4: Site Improvement Plan for Chilterns Beechwoods SAC, 2015 13 Ashridge Commons and Woods SSSI 27 Appendix 5: Ashridge Commons and Woods SSSI citation 28 Appendix 6: Condition summary from Natural England’s website for Ashridge Commons and Woods SSSI 31 Appendix 7: Condition Assessment from Natural England’s website for Ashridge Commons and Woods SSSI 33 Appendix 8: Operations likely to damage the special interest features at Ashridge Commons and Woods, SSSI, Hertfordshire/Buckinghamshire 38 Appendix 9: Views About Management: A statement of English Nature’s views about the management of Ashridge Commons and Woods Site of Special Scientific Interest (SSSI), 2003 40 Tring Woodlands SSSI 44 Appendix 10: Tring Woodlands SSSI citation 45 Appendix 11: Condition summary from Natural England’s website for Tring Woodlands SSSI 48 Appendix 12: Condition Assessment from Natural England’s website for Tring Woodlands SSSI 51 Appendix 13: Operations likely to damage the special interest features at Tring Woodlands SSSI 53 Appendix 14: Views About Management: A statement of English Nature’s views about the management of Tring Woodlands Site of Special Scientific Interest (SSSI), 2003. -

Heteroptera: Aradidae)
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 50 (30/06/2012): 339‒340. NOTAS SOBRE LOS ARÁDIDOS DE PORTUGAL (HETEROPTERA: ARADIDAE) Manuel Baena1 & Antonio José Zuzarte 2 1 Departamento de Biología y Geología, I.E.S. Trassierra, Avda. Arroyo del Moro, s/n, 14011 Córdoba, España ‒ [email protected] 2 rua Dr. José Frederico Laranjo, nº 6, 7450-128 Monforte, Portugal ‒ [email protected] Resumen: Se cita por primera para la fauna portuguesa Aradus reuterianus Puton, 1875. Se actualiza el catálogo portugués de la familia Aradidae y se incluye un mapa con la distribución de las cinco especies presentes en Portugal continental. Palabras clave: Heteroptera, Aradidae, Aradus reuterianus, nueva cita, catálogo, distribución, Portugal. Notes on the Aradidae (Heteroptera) of Portugal Abstract: Aradus reuterianus Puton, 1875 is recorded for the first time from Portugal. The Portuguese catalogue of the family Aradidae is updated and a distribution map of the five species living on the Portuguese mainland is provided. Key words: Heteroptera, Aradidae, Aradus reuterianus, new record, catalogue, distribution, Portugal. Introducción El conocimiento actual de la familia Aradidae en Portugal especie en Escandinavia son los trabajos de Brammanis continental es pobre y se debe casi exclusivamente a la labor (1975) y Heliövaara (1984). del entomólogo Antero Frederico de Seabra quién publicó una CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Portugal: Estremadura: Mata do serie de trabajos sobre la familia (Seabra, 1924, 1925, 1926) Valado (Seabra, 1924, Seabra, 1926), Mata de Leiria, (Seabra, que constituyen el grueso de los datos que poseemos sobre la 1931); Tras os Montes: San Martinho d’Anta (Seabra, 1926); fauna portuguesa. -

KATALOG STJENICA (HETEROPTERA: MIRIDAE) HRVATSKE Uvod
Entomol. Croat. 2010. Vol. 14. Num. 1-2: 23-76 UDC 595.789 (497.6) ISSN 1330-6200 KATALOG STJENICA (HETEROPTERA: MIRIDAE) HRVATSKE Ivana PAJAČ1, Božena BARIć1 i Bogomir MILOŠEVIć2 1Zavod za poljoprivrednu zoologiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Svetošimunska cesta 25, HR – Zagreb, Hrvatska, [email protected] 2Kosorova 1, Zagreb Prihvaćeno: 28. listopada 2010. U katalogu se navodi 276 vrsta stjenica (Heteroptera: Miridae) Hrvatske. Prvi se put u fauni Hrvatske spominje 36 vrsta, a ovim pregledom nije utvrđeno 15 vrsta za koje se navodi da postoje u našoj zemlji. Tri su vrste poznate samo iz Hrvatske. Heteroptera, Miridae, Hrvatska, fauna I. PAJAČ, B. BARIć & B. MILOŠEVIć. Catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) from Croatia. Entomol. Croat. 2010. Vol. 14 Num. 1-2: 23-76 The catalogue lists 276 species of plant bugs (Heteroptera: Miridae) from Croatia. Thirty-six species are mentioned for the first time in the Croatian fauna. Fifteen species listed as existing in Croatia were not found in this review. Three species are known only from Croatia. Heteroptera, Miridae, Croatia, fauna Uvod Porodica Miridae, stariji naziv Capsidae, najveća je u podredu Heteroptera. U Europi je poznato oko 6 000 vrsta. Vrste Miridae od ostalih porodica stjenica razlikuju se po tome što im nedostaju ocella. Zbog nedostatka ocella u mnogim se narodima u prijevodu nazivaju slijepe stjenice. Prema načinu ishrane vrste ove porodice većinom su fitofagne pa su neke od njih opasni štetnici u poljoprivredi (Lygus sp., Apolygus sp., Orthops sp., Adelphocoris lineolatus, Polymerus cognatus, Notostira elongata i dr.). Mnoge vrste koriste hranu životinjskog podrijetla, tj. zoofagne su i ubrajaju su u važne prirodne neprijatelje raznih štetnika. -

Heteroptera Checklist
rECOrd Chester Zoological Gardens Upton, Chester RECORD Cheshire, CH2 1LH Tel: 01244 383749 / 383569 The Biodiversity Information System for [email protected] Cheshire, Halton, Warrington and Wirral Provisional Checklist Of Cheshire Heteroptera (True Bugs) Provided by: Steve Judd - Cheshire County Heteroptera Recorder 20th January 1987 - LCES Report & Proceedings Amended by: Steve J. McWilliam - July 2002 Taken from the Lancashire and Cheshire Entomological Society (LCES) Report and Annual Proceedings One Hundred and Tenth Session 1986/87, Pages 60-65. The checklist is based on previous county checklists compiled by Whittaker (1906, 1908), Britten (1930) and Massee (1955). Additional unpublished annotations made by Massee to his 1955 checklist were made available by the Biological Records Centre at Monks Wood. Records were extracted from the Lancashire and Cheshire Fauna Committee cards housed at Manchester Museum. Data has been extracted from the Liverpool Museum collection and all post 1970 records are supported by voucher specimens in the Museum's collection. Scientific Name: English Name: National Status: Aradidae: Aradus depressus (F.) Local Acanthosomatidae: Acanthosoma haemorrhoidalis (L.) Hawthorn Shieldbug Common Elasmostethus interstinctus (L.) Birch Shield Bug Common Elasmostethus tristriatus (F.) Juniper Shieldbug Local Elasmucha grisea (L.) Parent Bug Cydnidae: Sehirus bicolor (L.) Common Scutelleridae: Palomena prasina (L.) Green Shieldbug Common Dolycoris baccarum (L.) Sloe Bug Common Piezodorus lituratus (F.) Gorse Shieldbug Common Pentatoma rufipes (L.) Forest Bug Common Picromerus bidens (L.) Common Troilus luridus (F.) Local Rhacognathus punctatus ((L.) Local Zicrona caerulea (L.) Blue Bug Local Coreidae: Coriomeris denticulatus (Scop.) Common Alydidae: Alydus calcaratus (L.) Local Rhopalidae: Corizus hyoscyami ((L.) Local Rhopalus maculatus ((Fieber) Notable B Chorosoma schillingi (Schum.) Local A Company Limited by Guarantee Registered in England No. -

Annotated Checklist of the Hemiptera Heteroptera of the Site of Community Importance and Special Area of Conservation “Alpi Marittime” (NW Italy)
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Bruno David Président du Muséum national d’Histoire naturelle RÉDACTRICE EN CHEF / EDITOR-IN-CHIEF : Laure Desutter-Grandcolas ASSISTANTS DE RÉDACTION / ASSISTANT EDITORS : Anne Mabille ([email protected]), Emmanuel Côtez MISE EN PAGE / PAGE LAYOUT : Anne Mabille COMITÉ SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC BOARD : James Carpenter (AMNH, New York, États-Unis) Maria Marta Cigliano (Museo de La Plata, La Plata, Argentine) Henrik Enghoff (NHMD, Copenhague, Danemark) Rafael Marquez (CSIC, Madrid, Espagne) Peter Ng (University of Singapore) Norman I. Platnick (AMNH, New York, États-Unis) Jean-Yves Rasplus (INRA, Montferrier-sur-Lez, France) Jean-François Silvain (IRD, Gif-sur-Yvette, France) Wanda M. Weiner (Polish Academy of Sciences, Cracovie, Pologne) John Wenzel (The Ohio State University, Columbus, États-Unis) COUVERTURE / COVER : Eurydema fieberi Fieber, 1837. Photo: S. Bambi. Zoosystema est indexé dans / Zoosystema is indexed in: – Science Citation Index Expanded (SciSearch®) – ISI Alerting Services® – Current Contents® / Agriculture, Biology, and Environmental Sciences® – Scopus® Zoosystema est distribué en version électronique par / Zoosystema is distributed electronically by: – BioOne® (http://www.bioone.org) Les articles ainsi que les nouveautés nomenclaturales publiés dans Zoosystema sont référencés par / Articles and nomenclatural novelties published in Zoosystema are referenced by: – ZooBank® (http://zoobank.org) Zoosystema est une revue en flux continu publiée par les Publications scientifiques du Muséum, Paris / Zoosystema is a fast track journal published by the Museum Science Press, Paris Les Publications scientifiques du Muséum publient aussi / The Museum Science Press also publish: Adansonia, Geodiversitas, Anthropozoologica, European Journal of Taxonomy, Naturae, Cryptogamie sous-sections Algologie, Bryologie, Mycologie. Diffusion – Publications scientifiques Muséum national d’Histoire naturelle CP 41 – 57 rue Cuvier F-75231 Paris cedex 05 (France) Tél. -

Heteroptera, Miridae), Ravageur Du Manguier `Ala R´Eunion Morguen Atiama
Bio´ecologie et diversit´eg´en´etiqued'Orthops palus (Heteroptera, Miridae), ravageur du manguier `aLa R´eunion Morguen Atiama To cite this version: Morguen Atiama. Bio´ecologieet diversit´eg´en´etique d'Orthops palus (Heteroptera, Miridae), ravageur du manguier `aLa R´eunion.Zoologie des invert´ebr´es.Universit´ede la R´eunion,2016. Fran¸cais. <NNT : 2016LARE0007>. <tel-01391431> HAL Id: tel-01391431 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01391431 Submitted on 3 Nov 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION Faculté des Sciences et Technologies Ecole Doctorale Sciences, Technologies et Santé (E.D.S.T.S-542) THÈSE Présentée à l’Université de La Réunion pour obtenir le DIPLÔME DE DOCTORAT Discipline : Biologie des populations et écologie UMR Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en Milieu Tropical CIRAD - Université de La Réunion Bioécologie et diversité génétique d'Orthops palus (Heteroptera, Miridae), ravageur du manguier à La Réunion par Morguen ATIAMA Soutenue publiquement le 31 mars 2016 à l'IUT de Saint-Pierre, devant le jury composé de : Bernard REYNAUD, Professeur, PVBMT, Université de La Réunion Président Anne-Marie CORTESERO, Professeur, IGEPP, Université de Rennes 1 Rapportrice Alain RATNADASS, Chercheur, HORTSYS, CIRAD Rapporteur Karen McCOY, Directrice de recherche, MiVEGEC, IRD Examinatrice Encadrement de thèse Jean-Philippe DEGUINE, Chercheur, PVBMT, CIRAD Directeur "Je n'ai pas d'obligation plus pressante que celle d'être passionnement curieux" Albert Einstein "To remain indifferent to the challenges we face is indefensible. -

Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2Nd Series
Issue 17/18 v.1.1 Het News Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2nd Series Circulation: An informal email newsletter circulated periodically to those interested in Heteroptera. Copyright: Text & drawings © 2011 Authors Photographs © 2011 Photographers Citation: Het News, 2nd Series, no.17/18, Spring/Autumn 2011 Editors: Our apologies for the belated publication of this year's issues, we hope that the record 30 pages in this combined issue are some compensation! Sheila Brooke: 18 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] Bernard Nau: 15 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] CONTENTS NOTICES: SOME LITERATURE ABSTRACTS ........................................... 16 Lookout for the Pondweed leafhopper ............................................................. 6 SPECIES NOTES. ................................................................18-20 Watch out for Oxycarenus lavaterae IN BRITAIN ...........................................15 Ranatra linearis, Corixa affinis, Notonecta glauca, Macrolophus spp., Contributions for next issue .................................................................................15 Conostethus venustus, Aphanus rolandri, Reduvius personatus, First incursion into Britain of Aloea australis ..................................................17 Elasmucha ferrugata Events for heteropterists .......................................................................................20 AROUND THE BRITISH ISLES............................................21-22 -

Download Des Berichts
WISSENSCHAFTLICHES JAHRBUCH DER TIROLER LANDESMUSEEN 2019 Herausgegeben von Direktor PD Dr. Wolfgang Meighörner Tiroler Landesmuseen-Betriebsges. m. b. H. Museumstraße 15 A-6020 Innsbruck Bildquellen Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben, © Tiroler Landesmuseen. © 2019 bei den Autorinnen und Autoren und der Tiroler Landesmuseen-Betriebsges. m. b. H. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Gestaltung büro54, Innsbruck Satz und Umschlag Studienverlag/Karin Berner Umschlagbild: Ansicht eines Trachtenpaares aus Aldein, Bleistift- und Tuschfederzeichnung mit Tempera koloriert, aus „Studien und Skizzen zu den Volkstrachten Bildern von Tirol und Vorarlberg“ von Karl von Lutterotti (1793–1872). Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, FB 4333/59. Herstellung Studienverlag Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck E-Mail: [email protected] Internet: www.studienverlag.at Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. ISBN 978-3-7065-5087-1 Abb. 1: Der Augsburger Bär (Arctia matronula) kann beinahe als Wappentier des Brandenbergtales bezeichnet werden. Foto: J. Kautzky. TAG DER ARTENVIELFALT 2019 – TIROL/BRANDENBERG Konrad Pagitz & Peter Huemer (Wissenschaftliche Koordinatoren) ABSTRACT EINLEITUNG Andreas Jedinger In 2019, the Nordtiroler Tag der Artenvielfalt took place in Brandenberg. In course of 24 hours of fieldwork, we found Der Tiroler Tag der Artenvielfalt hat bereits eine mehr als 1,300 taxa. This number encompasses 750 plant taxa 15-jährige Tradition. Angefangen mit den Erhebungen consisting of 176 liverworts and mosses, 574 tracheophytes „Entlang der Brennerachse“ 2004 wurden in den Jahren and 26 fungi and slime moulds. -

Response of Saproxylic Insect Communities to Forestry: Implications for Conservation
Response of Saproxylic Insect Communities to Forestry: Implications for Conservation Fredrik Stenbacka Faculty of Forest Sciences Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies Umeå Doctoral Thesis Swedish University of Agricultural Sciences Umeå 2009 Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2009:69 Cover: Large flight-intercept trap at Stenbithöjden clear-cut. (photo: F. Stenbacka) ISSN 1652-6880 ISBN 978-91-576-7416-6 © 2009 Fredrik Stenbacka, Umeå Print: Arkitektkopia AB, Umeå 2009 Response of Saproxylic Insect Communities to Forestry: Implications for Conservation. Abstract In boreal Fennoscandia clear-cutting practices and fire suppression have drastically reduced dead wood amount and diversity, deteriorating the sapoxylic fauna (species associated with dead wood). More effective conservation measures are urgently needed, which requires more empirical data on many saproxylics in managed forest landscapes. In this thesis I have studied both the immediate and more long-term effects of clear-cutting on saproxylic insect communities (beetles, parasitic wasps and flat bugs), by comparing species richness, abundance and assemblage composition in the whole successional range of existing spruce dominated forests. My thesis also provides data on substrate requirements of red- listed beetles, response of flat bugs to forest fires, and complementarity of sampling methods for assessing data on rare and threatened species. Old-growth forests supported the most intact communities and the highest densities of saproxylic insects and are probably very important as source habitats, especially for red-listed species. Mature managed forests were very similar in assemblage composition, strongly suggesting a high conservation value of these forests. Surprisingly, many saproxylic beetles adapted to late successional stages were present in thinned middle-aged forests, suggesting a significant conservation potential of these forests, provided that sufficient amounts and qualities of dead wood are retained. -

Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) W Polskich Sudetach
Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica vol. 10: 9-12. Opole, 12 III 2016 ISSN 2083-201X Krótkie doniesienie – Short communication Pierwsze stwierdzenie Aradus truncatus Fieber, 1860 oraz nowe obserwacje Aradus depressus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w polskich Sudetach KRZYSZTOF ZAJĄC 57-540 Lądek Zdrój, ul. Fabryczna 1a e-mail: [email protected] Abstract . [First record of Aradus truncatus Fieber, 1860 and new records of Aradus depressus (Fabricius, 1794) (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) in the Polish Sudetes ]. The paper presents the first record of Aradus truncatus in Sudetes and first rec- ords of A. depressus in the Złote Mountains (Eastern Sudetes). All Polish records of both species are summarized based on the literature and new data. Additionally, the paper summarizes briefly the current state of knowledge related to the flat bugs fauna of the Polish Sudetes. Key words : Hemiptera, Heteroptera, Aradidae, Aradus , flat bugs, faunistics, distribution, new record, Sudetes, Poland. Rodzina korowcowatych Aradidae obejmuje plu- wiając je z dotychczasową wiedzą o występowaniu skwiaki żyjące głównie pod korą lub w próchnie sta- obu gatunków w kraju. Oznaczeń okazów dokonano w rych, zamierających lub martwych drzew, zwykle zain- oparciu o pracę Lisa (2001). fekowanych przez grzyby. Aradus truncatus Fieber, 1860 Spośród 50 przedstawicieli rodziny występują- cych w Europie, w Polsce stwierdzono dotychczas Gatunek europejski, jeden z najrzadziej spotykanych występowanie 18 gatunków z 3 rodzajów (Lis 2001). przedstawicieli rodzaju. Znajdowany głównie pod Stan rozpoznania rozmieszczenia korowcowatych w korą drzew liściastych, jednak odławiany również z kraju jest stosunkowo słaby, na co wpływ ma skryty gatunków iglastych (Lis 2001). W niektórych krajach tryb życia (Kubisz 1992; Lis 2001). -

The Aradidae (Insecta, Hemiptera, Heteroptera) of Argentina
TERMS OF USE This pdf is provided by Magnolia Press for private/research use. Commercial sale or deposition in a public library or website is prohibited. Zootaxa 3500: 1–35 (2012) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2012 · Magnolia Press Article ISSN 1175-5334 (online edition) urn:lsid:zoobank.org:pub:CBDF71F7-70A8-415F-83CA-3010E8B2E8B6 The Aradidae (Insecta, Hemiptera, Heteroptera) of Argentina EUGENIA FERNANDA CONTRERAS¹ & MARÍA DEL CARMEN COSCARÓN² 1 Instituto de Biología de la Altura, Universidad Nacional de Jujuy. Av Bolivia 1661. 4600. San Salvador de Jujuy. Argentina. 2 Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata. Paseo del Bosque S/N.1900. La Plata. Argentina. 1 Corresponding autor: Eugenia Fernanda Contreras E-mail: [email protected] Abstract In Argentina, 14 genera and 41 species are recorded, belonging to 5 subfamilies: Aneurinae, Aradinae, Calisiinae, Isode- minae and Mezirinae. Aneurosoma dissimile (Bergroth); Aneurus bosqui Kormilev; Aphleboderrhis comata Champion; Aphleboderrhis pilosa Stål; Aradus angustellus (Blanchard); Aradus brasiliensis Usinger; Aradus mexicanus Usinger; Ar- adus penningtoni Drake; Calisius confusus Kormilev; Dysodius lunatus (Fabricius); Iralunelus bergi (Kormilev); Iralun- elus monrosi (Kormilev); Iralunelus subdipterus (Burmeister); Isodermus gayi (Spinola); Kormilevia dureti (Kormilev); Lobocara oblonga Bergroth; Mezira americana (Spinola); Mezira argentinensis (Kormilev); Mezira birabeni (Kormilev 1953); Mezira bonaerensis -

(Heteroptera: Aradidae). Considerations on the Local Distribution and the Habitat Preferences of This New Belgian Species Following a Nine-Months Field Survey
Belgian Journal of Entomology 111: 1–28 (2021) ISSN: 2295-0214 www.srbe-kbve.be urn: lsid:zoobank.org:pub:7124DD6B-FFC4-4968-B423-BF30EFE3223B Belgian Journal of Entomology The northernmost discovery of Aradus brenskei (Reuter, 1884) (Heteroptera: Aradidae). Considerations on the local distribution and the habitat preferences of this new Belgian species following a nine-months field survey Brecht VERKEMPINCK1, Berend AUKEMA2, Robin VAN HEGHE3 & Tim SPELEERS4 1 Erfken 5, 9340 Lede, Belgium. E-mail: [email protected] (corresponding author) 2 Naturalis Biodiversity Centre, P.O. Box 9517, 2300 RA Leiden, the Netherlands. E-mail: [email protected] 3 Regionaal Landschap Schelde-Durme, Markt 1, 9230 Wetteren, Belgium. E-mail: [email protected] 4 Essestraat 23, 9340 Lede, Belgium. E-mail: [email protected] Published: Brussels, 23 February 2021 VERKEMPINCK B. et al. The northernmost discovery of Aradus brenskei (Heteroptera: Aradidae) Citation: VERKEMPINCK B., AUKEMA B., VAN HEGHE R. & SPELEERS T., 2021. - The northernmost discovery of Aradus brenskei (Reuter 1884) (Heteroptera: Aradidae). Considerations on the local distribution and the habitat preferences of this new Belgian species following a nine-months field survey. Belgian Journal of Entomology, 111: 1–28. ISSN: 1374-5514 (Print Edition) ISSN: 2295-0214 (Online Edition) The Belgian Journal of Entomology is published by the Royal Belgian Society of Entomology, a non-profit association established on April 9, 1855. Head office: Vautier street 29, B-1000 Brussels. The publications of the Society are partly sponsored by the University Foundation of Belgium. In compliance with Article 8.6 of the ICZN, printed versions of all papers are deposited in the following libraries: - Royal Library of Belgium, Boulevard de l’Empereur 4, B-1000 Brussels.