Insecta: Heteroptera) II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
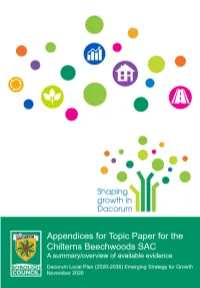
Topic Paper Chilterns Beechwoods
. O O o . 0 O . 0 . O Shoping growth in Docorum Appendices for Topic Paper for the Chilterns Beechwoods SAC A summary/overview of available evidence BOROUGH Dacorum Local Plan (2020-2038) Emerging Strategy for Growth COUNCIL November 2020 Appendices Natural England reports 5 Chilterns Beechwoods Special Area of Conservation 6 Appendix 1: Citation for Chilterns Beechwoods Special Area of Conservation (SAC) 7 Appendix 2: Chilterns Beechwoods SAC Features Matrix 9 Appendix 3: European Site Conservation Objectives for Chilterns Beechwoods Special Area of Conservation Site Code: UK0012724 11 Appendix 4: Site Improvement Plan for Chilterns Beechwoods SAC, 2015 13 Ashridge Commons and Woods SSSI 27 Appendix 5: Ashridge Commons and Woods SSSI citation 28 Appendix 6: Condition summary from Natural England’s website for Ashridge Commons and Woods SSSI 31 Appendix 7: Condition Assessment from Natural England’s website for Ashridge Commons and Woods SSSI 33 Appendix 8: Operations likely to damage the special interest features at Ashridge Commons and Woods, SSSI, Hertfordshire/Buckinghamshire 38 Appendix 9: Views About Management: A statement of English Nature’s views about the management of Ashridge Commons and Woods Site of Special Scientific Interest (SSSI), 2003 40 Tring Woodlands SSSI 44 Appendix 10: Tring Woodlands SSSI citation 45 Appendix 11: Condition summary from Natural England’s website for Tring Woodlands SSSI 48 Appendix 12: Condition Assessment from Natural England’s website for Tring Woodlands SSSI 51 Appendix 13: Operations likely to damage the special interest features at Tring Woodlands SSSI 53 Appendix 14: Views About Management: A statement of English Nature’s views about the management of Tring Woodlands Site of Special Scientific Interest (SSSI), 2003. -

Insetos Do Brasil
COSTA LIMA INSETOS DO BRASIL 2.º TOMO HEMÍPTEROS ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA SÉRIE DIDÁTICA N.º 3 - 1940 INSETOS DO BRASIL 2.º TOMO HEMÍPTEROS A. DA COSTA LIMA Professor Catedrático de Entomologia Agrícola da Escola Nacional de Agronomia Ex-Chefe de Laboratório do Instituto Oswaldo Cruz INSETOS DO BRASIL 2.º TOMO CAPÍTULO XXII HEMÍPTEROS ESCOLA NACIONAL DE AGRONOMIA SÉRIE DIDÁTICA N.º 3 - 1940 CONTEUDO CAPÍTULO XXII PÁGINA Ordem HEMÍPTERA ................................................................................................................................................ 3 Superfamília SCUTELLEROIDEA ............................................................................................................ 42 Superfamília COREOIDEA ............................................................................................................................... 79 Super família LYGAEOIDEA ................................................................................................................................. 97 Superfamília THAUMASTOTHERIOIDEA ............................................................................................... 124 Superfamília ARADOIDEA ................................................................................................................................... 125 Superfamília TINGITOIDEA .................................................................................................................................... 132 Superfamília REDUVIOIDEA ........................................................................................................................... -

And Phylogenetic Implications
G C A T T A C G G C A T genes Article The Complete Mitogenome of Pyrrhocoris tibialis (Hemiptera: Pyrrhocoridae) and Phylogenetic Implications Qi-Lin Zhang 1,2 , Run-Qiu Feng 1, Min Li 1, Zhong-Long Guo 1 , Li-Jun Zhang 1, Fang-Zhen Luo 1, Ya Cao 1 and Ming-Long Yuan 1,* 1 State Key Laboratory of Grassland Agro-ecosystems; Key Laboratory of Grassland Livestock Industry Innovation, Ministry of Agriculture and Rural Affairs; Engineering Research Center of Grassland Industry, Ministry of Education; College of Pastoral Agriculture Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China; [email protected] (Q.-L.Z.); [email protected] (R.-Q.F.); [email protected] (M.L.); [email protected] (Z.-L.G.); [email protected] (L.-J.Z.); [email protected] (F.-Z.L.); [email protected] (Y.C.) 2 Faculty of Life Science and Technology, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China * Correspondence: [email protected] Received: 29 August 2019; Accepted: 15 October 2019; Published: 18 October 2019 Abstract: We determined the complete mitogenome of Pyrrhocoris tibialis (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) to better understand the diversity and phylogeny within Pentatomomorpha, which is the second largest infra-order of Heteroptera. Gene content, gene arrangement, nucleotide composition, codon usage, ribosomal RNA (rRNA) structures, and sequences of the mitochondrial transcription termination factor were well conserved in Pyrrhocoroidea. Different protein-coding genes have been subject to different evolutionary rates correlated with the G + C content. The size of control regions (CRs) was highly variable among mitogenomes of three sequenced Pyrrhocoroidea species, with the P. -

A New Family of Coreoidea from the Lower Cretaceous Lebanese Amber (Hemiptera: Pentatomomorpha)
P O L I S H JOUR NAL OF ENTOMOLO G Y POLSKIE PISMO ENTOMOL OGICZ N E VOL. 80: 627-644 Gdynia 31 December 2011 DOI: 10.2478/v10200-011-0049-5 A new family of Coreoidea from the Lower Cretaceous Lebanese Amber (Hemiptera: Pentatomomorpha) DANY AZAR1, ANDRÉ NEL2, MICHAEL S. ENGEL3, 4, ROMAIN GARROUSTE2, ARMAND MATOCQ2 1Lebanese University, Faculty of Sciences II, Department of Natural Sciences, PO box 26110217, Fanar – Matn, Lebanon, e-mail: [email protected]; 2CNRS UMR 7205, CP 50, Entomologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, 45 rue Buffon, F-75005 Paris, France, e-mails: [email protected], [email protected], [email protected]; 3Division of Entomology (Paleoentomology), Natural History Museum, University of Kansas, Lawrence, KS 66049-2811, USA, e-mail: [email protected]; 4Department of Ecology & Evolutionary Biology, 1501 Crestline Drive – Suite 140, University of Kansas, Lawrence, KS 66049-2811, USA ABSTRACT. A new genus and species, Yuripopovina magnifica, belonging to a new coreoid family, Yuripopovinidae (Hemiptera: Pentatomomorpha), is described and illustrated from the Lower Cretaceous amber of Lebanon. The species represents the first definitive Mesozoic record for the Coreoidea. A cladistic analysis of Coreoidea, including the new family, is undertaken. KEY WORDS: Pentatomomorpha, Coreoidea, Yuripopovinidae, fam. n., gen. n., sp. n., Lebanon, phylogeny. INTRODUCTION The Pentatomomorpha with its 14 000 known living species (WEIRAUCH & SCHUH 2011) is the second largest of the seven heteropteran infraorders (SCHAEFER 1993, ŠTYS & KERZHNER 1975) (Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Nepomorpha, Leptodomorpha, Cimicomorpha, and Pentatomorpha). Most authors recognize five superfamilies within Pentatomomorpha, but there remains controversy regarding the 628 Polish Journal of Entomology 80 (4) composition of these superfamilies (SCHAEFER 1993, ŠTYS 1961). -

Rindenwanzen (Insecta: Heteroptera: Aradidae)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Joannea Zoologie Jahr/Year: 2018 Band/Volume: 16 Autor(en)/Author(s): Morkel Carsten, Frieß Thomas Artikel/Article: Rindenwanzen (Insecta: Heteroptera: Aradidae) als Indikatoren natürlicher Waldentwicklung im Nationalpark Gesäuse (Österreich, Steiermark) 93- 138 Joannea Zoologie 16: 93–138 (2018) Rindenwanzen (Insecta: Heteroptera: Aradidae) als Indikatoren natürlicher Waldentwicklung im Nationalpark Gesäuse (Österreich, Steiermark)1 Carsten MOR K EL & Thomas FRIE ß Zusammenfassung. Die Rindenwanzen des Nationalparks Gesäuse werden vorgestellt und mit Blick auf ihre Eignung als Indikatoren natürlicher Waldentwicklung diskutiert. Aus dem Untersuchungsgebiet sind bisher elf Arten bekannt: Aneurus avenius (DU F OUR , 1833), Aradus betulae (LINNAEUS , 1758), A. betulinus FALLÉN , 1807, A. cinnamomeus PAN - ZER, 1806, A. conspicuus HERRIC H -SC H AE ff ER, 1835, A. corticalis (LINNAEUS , 1758), Aradus depressus depressus (FABRICIUS, 1794), A. erosus FALLÉN , 1807, A. lugubris FALLÉN , 1807, A. obtectus VÁSÁR H EL Y I , 1988 und A. versicolor HERRIC H -SC H AE ff ER, 1835. Dargestellt werden die jeweiligen Fundorte und Fundhabitate im Nationalpark anhand historischer und re- zent erhobener Daten. Im Rahmen einer im Jahr 2017 durchgeführten, zeit-standardi- sierten Kartierung wurden an 42 verschiedenen Standorten unter anderem Baumart, Totholztyp, Holzdimensionsklasse, Holzzersetzungsgrad, Holzfeuchtegrad, Beschat- tung, Mikrohabitat und Pilzfruchtkörper notiert. Auf Basis dieser Daten wird die ökolo- gische Einnischung von Aradiden im Gesäuse abgeleitet und im Weiteren werden Charak ter- und Zielarten festgelegt. Es hat sich gezeigt, dass mehrere Rindenwanzen- arten im Nationalpark ab einem bestimmten Stadium der Waldentwicklung und der da- mit verfügbaren Totholzqualitäten auftreten. Entscheidend ist das Vorhandensein von Totholz in stärkerer Dimension (> 30 cm Durchmesser) und in den fortgeschrittenen Zerfallsphasen. -

Heteroptera: Aradidae)
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 50 (30/06/2012): 339‒340. NOTAS SOBRE LOS ARÁDIDOS DE PORTUGAL (HETEROPTERA: ARADIDAE) Manuel Baena1 & Antonio José Zuzarte 2 1 Departamento de Biología y Geología, I.E.S. Trassierra, Avda. Arroyo del Moro, s/n, 14011 Córdoba, España ‒ [email protected] 2 rua Dr. José Frederico Laranjo, nº 6, 7450-128 Monforte, Portugal ‒ [email protected] Resumen: Se cita por primera para la fauna portuguesa Aradus reuterianus Puton, 1875. Se actualiza el catálogo portugués de la familia Aradidae y se incluye un mapa con la distribución de las cinco especies presentes en Portugal continental. Palabras clave: Heteroptera, Aradidae, Aradus reuterianus, nueva cita, catálogo, distribución, Portugal. Notes on the Aradidae (Heteroptera) of Portugal Abstract: Aradus reuterianus Puton, 1875 is recorded for the first time from Portugal. The Portuguese catalogue of the family Aradidae is updated and a distribution map of the five species living on the Portuguese mainland is provided. Key words: Heteroptera, Aradidae, Aradus reuterianus, new record, catalogue, distribution, Portugal. Introducción El conocimiento actual de la familia Aradidae en Portugal especie en Escandinavia son los trabajos de Brammanis continental es pobre y se debe casi exclusivamente a la labor (1975) y Heliövaara (1984). del entomólogo Antero Frederico de Seabra quién publicó una CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Portugal: Estremadura: Mata do serie de trabajos sobre la familia (Seabra, 1924, 1925, 1926) Valado (Seabra, 1924, Seabra, 1926), Mata de Leiria, (Seabra, que constituyen el grueso de los datos que poseemos sobre la 1931); Tras os Montes: San Martinho d’Anta (Seabra, 1926); fauna portuguesa. -

Heteroptera Checklist
rECOrd Chester Zoological Gardens Upton, Chester RECORD Cheshire, CH2 1LH Tel: 01244 383749 / 383569 The Biodiversity Information System for [email protected] Cheshire, Halton, Warrington and Wirral Provisional Checklist Of Cheshire Heteroptera (True Bugs) Provided by: Steve Judd - Cheshire County Heteroptera Recorder 20th January 1987 - LCES Report & Proceedings Amended by: Steve J. McWilliam - July 2002 Taken from the Lancashire and Cheshire Entomological Society (LCES) Report and Annual Proceedings One Hundred and Tenth Session 1986/87, Pages 60-65. The checklist is based on previous county checklists compiled by Whittaker (1906, 1908), Britten (1930) and Massee (1955). Additional unpublished annotations made by Massee to his 1955 checklist were made available by the Biological Records Centre at Monks Wood. Records were extracted from the Lancashire and Cheshire Fauna Committee cards housed at Manchester Museum. Data has been extracted from the Liverpool Museum collection and all post 1970 records are supported by voucher specimens in the Museum's collection. Scientific Name: English Name: National Status: Aradidae: Aradus depressus (F.) Local Acanthosomatidae: Acanthosoma haemorrhoidalis (L.) Hawthorn Shieldbug Common Elasmostethus interstinctus (L.) Birch Shield Bug Common Elasmostethus tristriatus (F.) Juniper Shieldbug Local Elasmucha grisea (L.) Parent Bug Cydnidae: Sehirus bicolor (L.) Common Scutelleridae: Palomena prasina (L.) Green Shieldbug Common Dolycoris baccarum (L.) Sloe Bug Common Piezodorus lituratus (F.) Gorse Shieldbug Common Pentatoma rufipes (L.) Forest Bug Common Picromerus bidens (L.) Common Troilus luridus (F.) Local Rhacognathus punctatus ((L.) Local Zicrona caerulea (L.) Blue Bug Local Coreidae: Coriomeris denticulatus (Scop.) Common Alydidae: Alydus calcaratus (L.) Local Rhopalidae: Corizus hyoscyami ((L.) Local Rhopalus maculatus ((Fieber) Notable B Chorosoma schillingi (Schum.) Local A Company Limited by Guarantee Registered in England No. -

Hemiptera, Prosorrhyncha) with Special Reference to the Pregenital Abdominal Structure1
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Justification for the Aradimorpha as an infraorder of the suborder Heteroptera (Hemiptera, Prosorrhyncha) with Special Reference to the Pregenital Abdominal Structure1 M.H. SWEET Abstract: Aradomorpha SWEET 1996 is replaced with Aradimorpha because of homonymy with Arado- morpha CHAMPION 1899, a genus of Reduviidae. The Aradimorpha differ from the Pentatomomorpha s.s. and the Leptopodomorpha in having a plesiomorphic connexivum of dorsal epipleurites and ventral hy- popleurites rather than having the connexivum turned over so that the hypopleurites are dorsalized and the epipleurites folded into the abdomen. In most Aradimorpha, in both males and females, sterna 3 to 7 are free with intersegmental conjunctiva; terga 1-2 and 3 to 6 are united, but all epipleurites are free. In the Pentatomomorpha at least abdominal sterna 2 to 4 in females and sterna 2 to 5 in males are uni- ted or fused without conjunctiva. In some aradids the hypopleurites are united or fused with the sterna, but hypopleurite 2 is usually free. Sternum 2 is sometimes united to fused with sternum 1 and the meta- sternum. The abdominal spiracles in the Aradimorpha are ventral on the hypopleurites, although some- times very lateral in position on the hypopleurites, with the exception of the Chinamyersiini in which spiracles 4, 5 and 6 are dorsal on the epipleurites in Chinamyersia, and 5 and 6 dorsal in Gnostocoris, whi- le in the Tretocorini (Tretocoris and Kumaressa) spiracle 2 seems dorsal but is actually very lateral on the hypopleurite. In the Termitaphididae, epipleurites and hypopleurites are distinct, forming mobile lateral abdominal lobes. -

An Annotated Catalog of the Iranian Miridae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha)
Zootaxa 3845 (1): 001–101 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Monograph ZOOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3845.1.1 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:C77D93A3-6AB3-4887-8BBB-ADC9C584FFEC ZOOTAXA 3845 An annotated catalog of the Iranian Miridae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha) HASSAN GHAHARI1 & FRÉDÉRIC CHÉROT2 1Department of Plant Protection, Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. E-mail: [email protected] 2DEMNA, DGO3, Service Public de Wallonie, Gembloux, Belgium, U. E. E-mail: [email protected] Magnolia Press Auckland, New Zealand Accepted by M. Malipatil: 15 May 2014; published: 30 Jul. 2014 HASSAN GHAHARI & FRÉDÉRIC CHÉROT An annotated catalog of the Iranian Miridae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha) (Zootaxa 3845) 101 pp.; 30 cm. 30 Jul. 2014 ISBN 978-1-77557-463-7 (paperback) ISBN 978-1-77557-464-4 (Online edition) FIRST PUBLISHED IN 2014 BY Magnolia Press P.O. Box 41-383 Auckland 1346 New Zealand e-mail: [email protected] http://www.mapress.com/zootaxa/ © 2014 Magnolia Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from the publisher, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed in writing. This authorization does not extend to any other kind of copying, by any means, in any form, and for any purpose other than private research use. ISSN 1175-5326 (Print edition) ISSN 1175-5334 (Online edition) 2 · Zootaxa 3845 (1) © 2014 Magnolia Press GHAHARI & CHÉROT Table of contents Abstract . -

Laboulbeniales on Semi-Aquatic Hemiptera. Laboulbenia. Richard K
Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany Volume 6 | Issue 3 Article 7 1967 Laboulbeniales on Semi-aquatic Hemiptera. Laboulbenia. Richard K. Benjamin Rancho Santa Ana Botanic Garden Follow this and additional works at: http://scholarship.claremont.edu/aliso Part of the Botany Commons Recommended Citation Benjamin, Richard K. (1967) "Laboulbeniales on Semi-aquatic Hemiptera. Laboulbenia.," Aliso: A Journal of Systematic and Evolutionary Botany: Vol. 6: Iss. 3, Article 7. Available at: http://scholarship.claremont.edu/aliso/vol6/iss3/7 ALISO VoL. 6, No. 3, pp. 111-136 }UNE 30, 1967 LABOULBENIALES ON SEMI-AQUATIC HEMIPTERA. LA.BOULBENIA.. RICHARD K. BENJAMIN Rancho Santa Ana Botanic Garden Claremont, California INTRODUCTION The Hemiptera, or true bugs, a large and diverse assemblage of insects, are characterized by ( 1) mouth-parts articulated into an often elongate tubular beak adapted for feeding on plants or animals by piercing and sucking, ( 2) gradual metamorphosis, and ( 3) overlapping front wings having a hardened basal part, the corium, and a thin, transparent apex, the membrane. The order commonly is divided into two suborders, the Homoptera and the Heteroptera ( Brues, Melander & Carpenter, 1954; Ross, 1956). At present no member of the Homoptera (which includes such well-known bugs as the cicadas, tree hoppers, plant lice, etc.) is known to be parasitized by Laboulbeniales. These fungi occur on insects classi fied in the Heteroptera, but only 26 species have been described. Entomologists subdivide the Heteroptera into two major groups based, in part, on the length of the antennae. These are the Cryptocerata (short-horned bugs) in which the antennae are short and are concealed beneath the head and the Gymnocerata (long-horned bugs) in which the antennae typically are longer than the head and are exposed. -

Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2Nd Series
Issue 17/18 v.1.1 Het News Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2nd Series Circulation: An informal email newsletter circulated periodically to those interested in Heteroptera. Copyright: Text & drawings © 2011 Authors Photographs © 2011 Photographers Citation: Het News, 2nd Series, no.17/18, Spring/Autumn 2011 Editors: Our apologies for the belated publication of this year's issues, we hope that the record 30 pages in this combined issue are some compensation! Sheila Brooke: 18 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] Bernard Nau: 15 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] CONTENTS NOTICES: SOME LITERATURE ABSTRACTS ........................................... 16 Lookout for the Pondweed leafhopper ............................................................. 6 SPECIES NOTES. ................................................................18-20 Watch out for Oxycarenus lavaterae IN BRITAIN ...........................................15 Ranatra linearis, Corixa affinis, Notonecta glauca, Macrolophus spp., Contributions for next issue .................................................................................15 Conostethus venustus, Aphanus rolandri, Reduvius personatus, First incursion into Britain of Aloea australis ..................................................17 Elasmucha ferrugata Events for heteropterists .......................................................................................20 AROUND THE BRITISH ISLES............................................21-22 -

Types of True Bugs (Insecta, Hemiptera, Heteroptera) Deposited in the Museo De La Plata, Argentina
Zootaxa 3977 (1): 001–101 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Monograph ZOOTAXA Copyright © 2015 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3977.1.1 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:19EF7607-0D12-4DB0-B269-373A97C3D6ED ZOOTAXA 3977 Types of true bugs (Insecta, Hemiptera, Heteroptera) deposited in the Museo de La Plata, Argentina MARÍA DEL CARMEN COSCARÓN, CARINA BASSET & NANCY LOPEZ División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, B1900DNG La Plata, Argentina. E-mail: [email protected] Magnolia Press Auckland, New Zealand Accepted by D. Rider: 19 May. 2015; published: 25 Jun. 2015 MARÍA DEL CARMEN COSCARÓN, CARINA BASSET & NANCY LOPEZ Types of true bugs (Insecta, Hemiptera, Heteroptera) deposited in the Museo de La Plata, Argentina (Zootaxa 3977) 101 pp.; 30 cm. 25 Jun. 2015 ISBN 978-1-77557-733-1 (paperback) ISBN 978-1-77557-734-8 (Online edition) FIRST PUBLISHED IN 2015 BY Magnolia Press P.O. Box 41-383 Auckland 1346 New Zealand e-mail: [email protected] http://www.mapress.com/zootaxa/ © 2015 Magnolia Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from the publisher, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed in writing. This authorization does not extend to any other kind of copying, by any means, in any form, and for any purpose other than private research use. ISSN 1175-5326 (Print edition) ISSN 1175-5334 (Online edition) 2 · Zootaxa 3977 (1) © 2015 Magnolia Press COSCARÓN ET AL.