Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
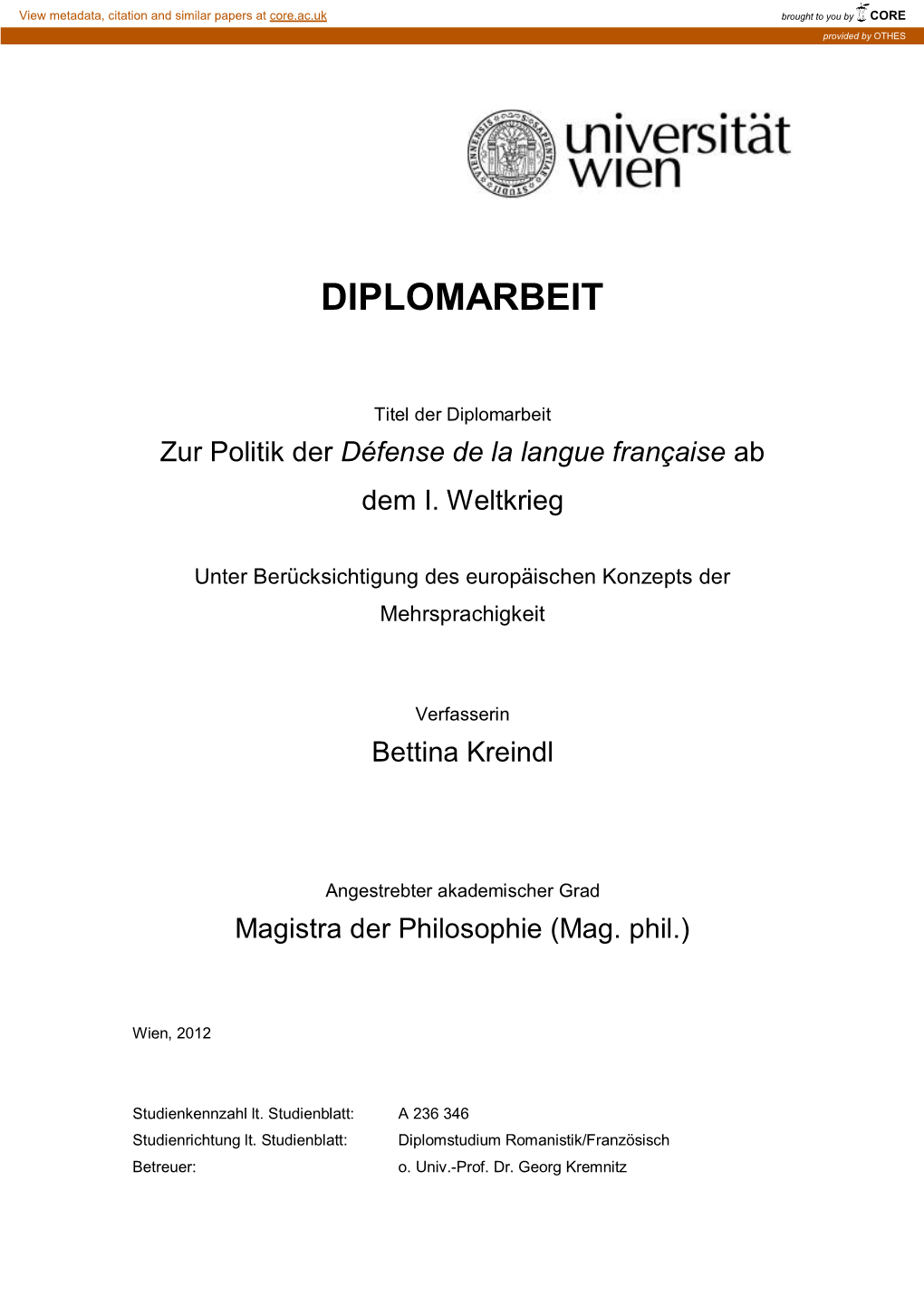
Load more
Recommended publications
-

Lettres & Manuscrits Autographes
ALDE ALDE Lettres & Manuscrits autographes Lettres & Manuscrits autographes www.alde.fr mardi 20 octobre 2009 42 Expert Thierry Bodin Syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art Les Autographes 45, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris Tél. 01 45 48 25 31 - Facs 01 45 48 92 67 [email protected] Exposition partielle à la librairie Les Autographes Sur rendez-vous préalable uniquement Exposition publique Salle Rossini le dimanche 18 octobre de 11 h à 18 h et le mardi 20 octobre de 10 h à 12 h MaisonALDE de ventes spécialisée Livres & Autographes Lettres & manuscrits autographes Vente aux enchères publiques Le mardi 20 octobre 2009 à 14 h 00 Salle Rossini 7, rue Rossini 75009 Paris Tél. : 01 53 34 55 01 Commissaire-priseur Jérôme Delcamp 7, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 53 34 55 00 - Fax 01 42 47 10 26 [email protected] - www. rossini.fr présentera les nos 4 à 21, 32, 105, 174, 223, 226, 229, 271, 355 à 357, 390. Ceux-ci sont signalés par un astérisque dans le catalogue. ALDE Maison de ventes aux enchères 1, rue de Fleurus 75006 Paris Tél. 01 45 49 09 24 - Facs. 01 45 49 09 30 - www.alde.fr Agrément n°-2006-583 5 12 2 3 1. AGRICULTURE. Manuscrit, vers 1771-1782 ; cahier d’environ 25 pages in-fol. (plus ff. vierges), plus 15 pages formats divers intercalées (étui-chemise). 80/100 Recettes de métairies du domaine d’Auchard, ventes et achats de bestiaux, état détaillé des « biens d’Antoine Meisonnier dit Bernard » (maisons, granges, prés, terres), production de seigle, d’avoine et de blé, quittance fiscale de l’élection de Clermont- Ferrand au nom de M. -
Lettres & Manuscrits Autographes
LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES Salle des ventes Favart Mercredi 26 et jeudi 27 avril 2017 DIVISION DU CATALOGUE Mercredi 26 avril Littérature Nos 1 à 247 Beaux-Arts Nos 248 à 307 Jeudi 27 avril Musique et spectacle Nos 308 à 401 Sciences, techniques et voyages Nos 402 à 433 Histoire Nos 434 à 602 Abréviations L.A.S. ou P.A.S. : lettre ou pièce autographe signée L.S. ou P.S. : lettre ou pièce signée (texte d’une autre main ou dactylographié) L.A. ou P.A. : lettre ou pièce autographe non signée exPert Thierry BODIN, Les Autographes Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] Mercredi 26 avril 2017 à 14 heures nos 1 à 307 Jeudi 27 avril 2017 à 14 heures nos 308 à 602 Vente aux enchères publiques Salle des ventes Favart 3, rue Favart 75002 Paris expert : Thierry BODIN, Les Autographes Lettres & Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] manuscrits responsable de la vente : Marc GUYOT [email protected] autographes Tél. : 01 78 91 10 11 Exposition privée sur rendez-vous chez l’expert Expositions publiques à la salle des Ventes Favart Mardi 25 avril de 10 h à 18 h Mercredi 26 avril de 10 h à 12 h Jeudi 27 avril de 10 h à 12 h Téléphone pendant l’exposition : 01 53 40 77 10 catalogue visible sur www.ader-paris.fr enchérissez en direct sur www.drouotlive.com En 1re de couverture, est reproduit le lot 257 En 4e de couverture, est reproduit le lot 324 3 2 LittérAturE 1. -

Lettres & Manuscrits Autographes
MaisonALDE de ventes spécialisée Livres & Autographes Lettres & manuscrits autographes Vente aux enchères publiques Le mardi 20 octobre 2009 à 14 h 00 Salle Rossini 7, rue Rossini 75009 Paris Tél. : 01 53 34 55 01 Commissaire-priseur Jérôme Delcamp 7, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 53 34 55 00 - Fax 01 42 47 10 26 [email protected] - www. rossini.fr présentera les nos 4 à 21, 32, 105, 174, 223, 226, 229, 271, 355 à 357, 390. Ceux-ci sont signalés par un astérisque dans le catalogue. ALDE Maison de ventes aux enchères 1, rue de Fleurus 75006 Paris Tél. 01 45 49 09 24 - Facs. 01 45 49 09 30 - www.alde.fr Agrément n°-2006-583 5 12 2 3 1. AGRICULTURE. Manuscrit, vers 1771-1782 ; cahier d’environ 25 pages in-fol. (plus ff. vierges), plus 15 pages formats divers intercalées (étui-chemise). 80/100 Recettes de métairies du domaine d’Auchard, ventes et achats de bestiaux, état détaillé des « biens d’Antoine Meisonnier dit Bernard » (maisons, granges, prés, terres), production de seigle, d’avoine et de blé, quittance fiscale de l’élection de Clermont- Ferrand au nom de M. Saulmur. 2. Pierre ALBERT-BIROT (1876-1967). Grabinoulor (Denoël et Steele, 1933); in-12, 277 p., broché (petite déchir. au dos). 150/200 Édition originale, exemplaire de l’auteur (H.C. sur alfa), portant deux cachets encre à son nom, avec additions autographes. En tête de chacun des 57 chapitres, est inscrit de la main de l’auteur un titre ; ces titres sont recopiés en fin de volume sous forme d’une table des matières s’étendant sur quatre pages, et une seconde fois sur un feuillet dactylographié séparé. -

Histoire Du Ministère Des Affaires Étrangères Et De La Constitution De Ses Fonds D’Archives Panorama Des Fonds Un Secrétariat D’État Et Des Commis
Histoire du ministère des Affaires étrangères et de la constitution de ses fonds d’archives Panorama des fonds Un secrétariat d’État et des commis • Au Moyen Age les rois de France menaient leur politique étrangère envers les autres souverains avec des conseillers diplomatiques • À la fin du XVe siècle, quatre Secrétaires d’État du roi se partagent la correspondance avec la province et l’étranger. Louis de Revol, premier secrétaire d’État aux Affaires étrangères 1589-1594 Secrétaires d’État aux Affaires étrangères Quelques grandes figures Charles Colbert de Croissy 1629-1696 Jean-Baptiste Colbert de Torcy 1685-1746 Secrétaires d’Etat aux Affaires étrangères Quelques grandes figures Etienne François duc de Choiseul Vergennes 1758-1770l L’administration centrale des Affaires étrangères • Lors de la création d’une administration autonome des Affaires étrangères il a été prévu que chaque secrétaire d’État serait assisté d’un commis et de six clercs. • Leur nombre, en constante augmentation depuis lors, s’élève à 37 le 1er janvier 1766, parmi lesquels dix-neuf politiques, y compris le bureau des consulats de Le Gay avec six employés originaires de la Marine. • En 1774, 38 commis sont en fonction, dont au moins dix-sept politiques. Si l’effectif des commis a doublé de 1727 à 1766, il est demeuré à peu près inchangé durant le dernier quart du règne de Louis XV, de 1766 à 1774. Les postes diplomatiques français de la Renaissance au XVIIIe siècle • Le ministère des Affaires étrangères revient à Paris en 1792. Les services sont découpés en six divisions : division du Nord, division du Midi, La Révolution division des Consulats, division des Fonds et division des Relations et l’Empire commerciales. -

Annuaire Français De Relations Internationales AFRI 2006, Volume VII Editions Bruylant, Bruxelles
Annuaire Français de Relations Internationales AFRI 2006, volume VII Editions Bruylant, Bruxelles SEREQUEBERHAN Hewane, "Chronique bibliographique de l'année 2005", AFRI 2006, volume VII Disponible sur http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/biblio_2005.pdf Tous droits réservés - Centre Thucydide - contact : [email protected] AFRI 2006, volume VII CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE SOUS LA DIRECTION DE Anne DULPHY∗ AVEC Célia BELIN, Tetyana BOBURKA, Yann BEDZIGUI, Baptiste CHATRE, ∗∗ Julian FERNANDEZ et Hewane SEREQUEBERHAN SOMMAIRE Chronique des ouvrages Union européenne et relations internationales L’Union européenne sur la scène internationale Les enjeux de l’élargissement Regards sur la politique étrangère de la France Problématiques de la mondialisation Approches générales Approches spécifiques Chronique des revues Histoire des relations internationales au XXe siècle Variations sur l’Europe Numéros spéciaux L’avenir de l’Union européenne L’Ukraine La relation transatlantique L’ONU et la sécurité collective Numéros spéciaux Bilan et perspectives Guerres et stabilité Numéros spéciaux Guerre et économie L’Iraq « Nation building », démocratie et terrorisme Autres guerres, autres paix Prolifération Numéros spéciaux L’arme nucléaire La question iranienne ∗ Maître de conférences à l’Ecole polytechnique (France) et à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences- Po, France) ; chercheur rattachée au Centre d’histoire de la Fondation nationale des Sciences politiques (France). ∗∗ Allocataires de recherche au Centre Thucydide de l’Université -

ŢARA BÂRSEI Iiiiiihiiiiiiii.Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
ŢARA BÂRSEI iiiiiihiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu Ţara Bârsei: Craiu Nou Axente Banciu: Suflete uitate(Boghicii) Caius Bardoşi: Diplomaţia în trecut şi în prezent Axente Banciu: însemnări râsleţe PARTEA LITERARĂ D. Olariu : Ruini 1. Colan: St. 0. losif S. Tamba: Din stânga şi din dreapta Axente Banciu: Răsfoind ziarele şi re vistele noastre N. A. Pop, Ax. B. Dări de seamă şi 1. Colan: Bibliografie. Anul II. lulie-August 1930 No. 4 „ASTRA Braşov ŢARA BARSEI APARE LA DOUĂ LUNI ODATĂ SUB CONDUCEREA PROFESORULUI A. BANCIU REDACŢIA ] şi \ B-dul Regele Ferdinand No. 14, Braşov ADMINISTRAŢIA ) ABONAMENTUL PENTRU UN AN LEI 260 NUMĂRUL LEI 50 Pentru străinătate acelaş preţ, plus taxele de expediţie (Lei 140) INFORM AŢIUNI Pentru autori Pentru cetitori şi abonaţi Manuscrisele primite la redacţie nu se Cei cari an primit No. 1, 2, şi 3 şi înapoiază. le-au reţinut, sunt rugaţi să ne achite Autorii, ale căror articole urmează să se publice, vor fl încunoştiinţaţi despre abonamentul. aceasta. * * * Extrase din articolele publicate in revistă se pot face plătindu-se tipogra In loc să apărem lunar în 3 coaie de fiei numai costul hârtiei şi trasului. tipar, vom apărea la câte două luni în 6 coaie. Am făcut-o aceasta pentru a O coală 16p. formatul şi hârtia revistei. putea publica şi articole mal lungi, 50 ex. Lei 320, 100 ex. Lei 550, 200 ex. Lei 870 cari, fărâmiţate în 2—3 numere de re 8 pag. vistă, pierd adeseori atât de mult. Ce 50 ex. Lei 230, 100 ex. Lei 320. 200 ex. Lei 550 titorii nu vor fi scurtaţi deci cu nimic. -

Lettres & Manuscrits Autographes
LETTRES & MANUSCRITS AUTOGRAPHES Salle des ventes Favart Mercredi 26 et jeudi 27 avril 2017 DIVISION DU CATALOGUE Mercredi 26 avril Littérature Nos 1 à 247 Beaux-Arts Nos 248 à 307 Jeudi 27 avril Musique et spectacle Nos 308 à 401 Sciences, techniques et voyages Nos 402 à 433 Histoire Nos 434 à 602 Abréviations L.A.S. ou P.A.S. : lettre ou pièce autographe signée L.S. ou P.S. : lettre ou pièce signée (texte d’une autre main ou dactylographié) L.A. ou P.A. : lettre ou pièce autographe non signée exPert Thierry BODIN, Les Autographes Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] Mercredi 26 avril 2017 à 14 heures nos 1 à 307 Jeudi 27 avril 2017 à 14 heures nos 308 à 602 Vente aux enchères publiques Salle des ventes Favart 3, rue Favart 75002 Paris expert : Thierry BODIN, Les Autographes Lettres & Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] manuscrits responsable de la vente : Marc GUYOT [email protected] autographes Tél. : 01 78 91 10 11 Exposition privée sur rendez-vous chez l’expert Expositions publiques à la salle des Ventes Favart Mardi 25 avril de 10 h à 18 h Mercredi 26 avril de 10 h à 12 h Jeudi 27 avril de 10 h à 12 h Téléphone pendant l’exposition : 01 53 40 77 10 catalogue visible sur www.ader-paris.fr enchérissez en direct sur www.drouotlive.com En 1re de couverture, est reproduit le lot 257 En 4e de couverture, est reproduit le lot 324 Jeudi 27 avril 2017 à 14 heures Vente aux enchères publiques Salle deS VenTeS FaVarT 3, rue Favart 75002 Paris Lettres & manuscrits autographes 2e vacation expert : Thierry BODIN, Les Autographes Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. -

Lettres Et Manuscrits Autographes
MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 LETTRES ET MANUSCRITS AUTOGRAPHES Lettres et Manuscrits Autographes - Salle des ventes Favart, mardi 13 décembre 2011 ADER, Société de Ventes Volontaires - Agrément 2002-448 - Sarl au capital de 7500 euros 3, rue Favart 75002 Paris - Tél. : 01 53 40 77 10 - Fax : 01 53 40 77 20 - contact @ader-paris.fr ADER N° siret : 450 500 707 000 28 - TVA Intracom : FR 66 450 500 707 - www.ader-paris.fr Couv Ader 13-12-11.indd 1 24/11/11 13:49 Expert Thierry BODIN, Les Autographes Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 - Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] Division du catalogue Histoire et science Nos 1 à 132 Littérature et Arts Nos 133 à 199 Archives de Jean-Émile Laboureur Nos 200 à 309 Abréviations : L.A.S. ou P.A.S. lettre ou pièce autographe signée L.S. ou P.S. lettre ou pièce signée (texte d’une autre main ou dactylographié) L.A. ou P.A. lettre ou pièce autographe non signée Couv Ader 13-12-11.indd 2 24/11/11 13:49 Expert Thierry BODIN, Les Autographes Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 - Fax : + 33 (0)1 45 48 92 67 [email protected] MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 À 14 H Vente aux enchères publiques SALLE DES VENTES FAVART 3, rue Favart - 75002 Paris LETTRES ET MANUSCRITS AUTOGRAPHES Division du catalogue Succession Théodore Tausky et à divers Histoire et science Nos 1 à 132 Littérature et Arts Nos 133 à 199 Archives Jean-Émile Laboureur Archives de Jean-Émile Laboureur Nos 200 à 309 Expositions à la salle Favart Lundi 12 décembre de 10 h à 18 h Mardi 13 décembre de 10 h à 12 h Téléphone pendant la vente : 01 53 40 77 10 Abréviations : L.A.S.