Ordines Militares Conference
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
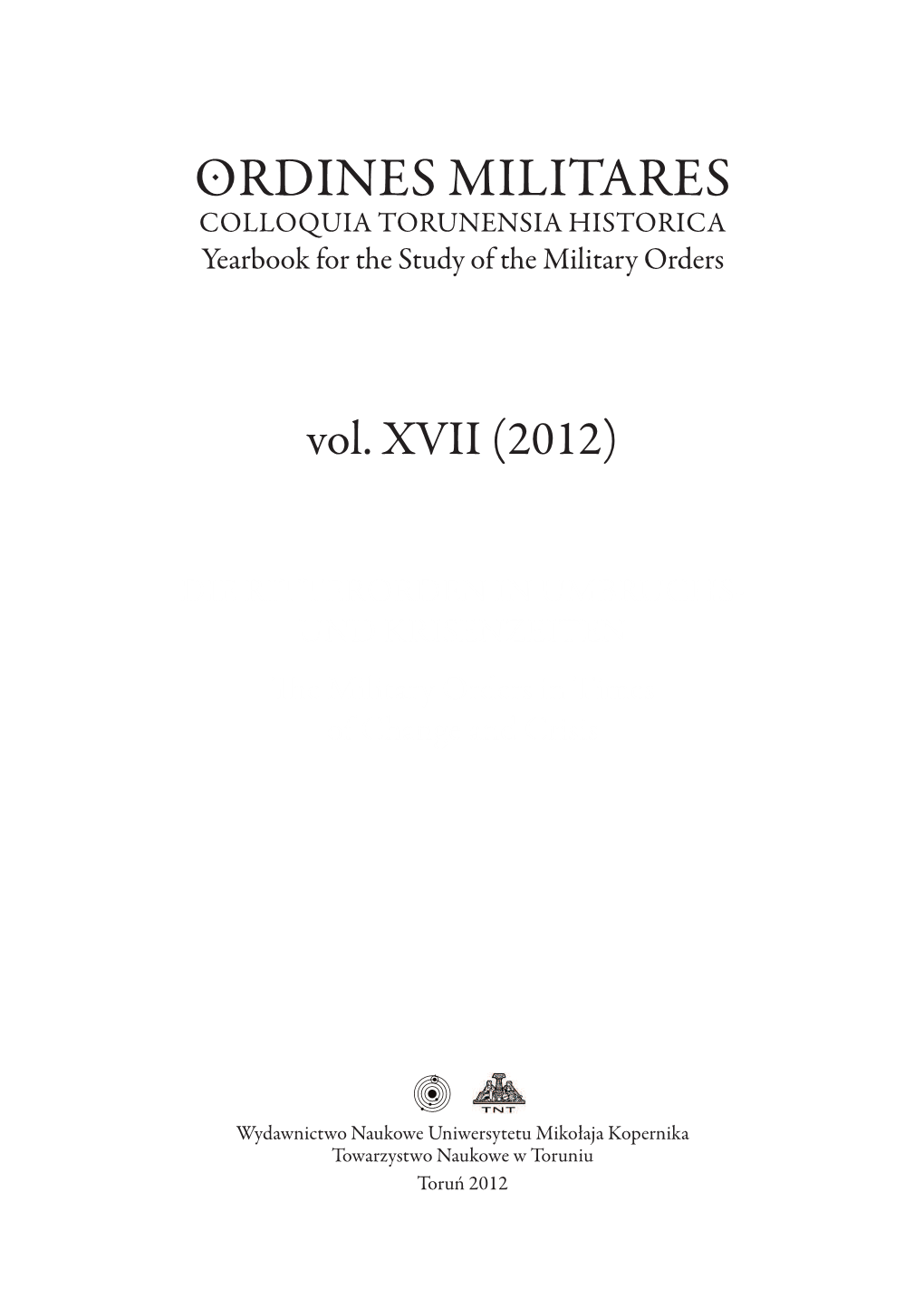
Load more
Recommended publications
-

Nowa Nieszawa (Dybów) in the Late Middle Ages According to New Research
ARTYKUŁY Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym PL ISSN 1643-8191, t. 43 (4)/2017, s. 23–45 http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.043 Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak* Nowa Nieszawa (Dybów) in the late Middle Ages according to new research. The town on the border of countries, cultures and nations** Nowa Nieszawa (Dybów) w późnym średniowieczu. Miasto na pograniczu państw, kultur i narodów Streszczenie: Nowa Nieszawa, lokowana nad Wisłą na pograniczu polsko-krzyżackim po 1423 roku, jawi się jako prężnie rozwijający się pod względem gospodarczym i politycz- nym ośrodek miejski. Dzięki swojej lokalizacji na trasie niezwykle istotnego szlaku handlo- wego, a także w najbliższym sąsiedztwie państwa krzyżackiego przyciągała przedsiębiorcze jednostki, przede wszystkim kupców i rzemieślników różnej narodowości, a także zbiegów * M. Duda: [email protected]; S. Jóźwiak: [email protected]; Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87–100 Toruń. ** M. Duda’s research was financed by the National Science Center, Poland granted according to decision no. DEC-2012/05/N/HS3/01398 as well as the Foundation for Polish Science (FNP); S. Jóźwiak’s contribution to this paper is a part of the project no. 2012/05/B/HS3/03708 financed by the National Science Centre, Poland. 23 Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak z pobliskiego państwa krzyżackiego. Funkcjonowanie Nowej Nieszawy jest tym bardziej godne zainteresowania, że pozycja tego ośrodka ukształtowała się w dość ograniczonych ramach czasowych: jego lokację od zrównania z ziemią dzielił odstęp nieco mniej niż czte- rech dekad. Należy jednak podkreślić, że swój fenomen Nieszawa zawdzięczała przede wszystkim niezwykle korzystnej lokalizacji na pograniczu dwóch państw. -

The Relics of St Barbara at Althaus Kulm
Zapiski Historyczne t. 85, 2020, z. 1, s. 5 – 50 ISSN 0044-1791 http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.01 GREGORY LEIGHTON* https://orcid.org/0000-0002-4203-2313 The Relics of St Barbara at Althaus Kulm: History, Patronages, and Insight into the Teutonic Order and the Christian Population in Prussia (Thirteenth–Fifteenth Centuries) Abstract This article summarizes the history of the relics of St Barbara in Althaus Kulm (Staro- gród Chełmiński), a topic with extensive research in Polish and German circles, but only recently addressed by scholarship in English. It begins with an overview of the relics’ his- tory and a summary of St Barbara’s vita, pointing out the quick rise in her cult in the Teu- tonic Order’s Prussian territory (Ordensland). Following this, it assesses the function of the relics through three lenses: warfare, daily life, and as a symbol of the Order’s power using three methodological frameworks. These are hierophany (manifestations of the sacred) for warfare, naming practices for studying the impact of St Barbara on the local population, and as a reflection of the Order’s territorial power (Landesherrschaft). The article ultimately demonstrates that the relics were a significant element of the multifaceted structure of re- ligious life in medieval Prussia, both within and outside of the Teutonic Order. Appended to the text are two previously unpublished accounts of the relics of St Barbara and their arrival in Althaus, demonstrating the reputation of the shrine not just in the Ordensland, but within Christendom. It concludes with a summary of the research findings, and a con- sideration of these findings in light of more ‘recent’ interpretations of the Teutonic Order and the Prussian Crusades. -

Ordines Militares Conference
ORDINES◆ MILITARES COLLOQUIA TORUNENSIA HISTORICA Yearbook for the Study of the Military Orders vol. XIX (2014) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Towarzystwo Naukowe w Toruniu Toruń 2014 Editorial Board Roman Czaja, Editor in Chief, Nicolaus Copernicus University Toruń Jürgen Sarnowsky, Editor in Chief, University of Hamburg Jochen Burgtorf, California State University Sylvain Gouguenheim, École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon Hubert Houben, Università del Salento Lecce Alan V. Murray, University of Leeds Krzysztof Kwiatkowski, Assistant Editor, Nicolaus Copernicus University Toruń Reviewers: Udo Arnold, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (retired) Karl Borchardt, Monumenta Germaniae Historica, München Jochen Burgtorf, Department of History, California State University Wiesław Długokęcki, Institute of History, University of Gdańsk Marie-Luise Favreau-Lilie, Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität Berlin Alan Forey, Durham University (retired) Mario Glauert, Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam Sylvain Gouguenheim, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon Dieter Heckmann, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem Ilgvars Misāns, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia, Riga Maria Starnawska, Institute of History, Jan Długosz University in Częstochowa Sławomir Zonenberg, Institute of History and International Relationships, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Janusz Tandecki, Institut of History and Archival Sciences, Nicolaus -

M Iscellanea
M ISCELLANEA Jerzy Przeracki THE WARMIAN PRINCE-BISHOP PAUL LEGENDORF (CA. 1410–1467). BETWEEN THE TEUTONIC ORDER AND POLAND Słowa kluczowe: Warmia, biskupstwo warmińskie, zakon krzyżacki, wojny Polski z Krzyżakami Schlüsselwörter: Ermland, Fürstbistum Ermland, Deutsche Orden, Polnisch-teutonische Kriege Keywords: Warmia, Prince-Bishopric of Warmia, Teutonic Order, Polish-Teutonic wars The behaviour of an individual is frequently determined by events over which that individual has limited power, with resulting choices appearing as con- troversial, especially if assessed after centuries. Paul Legendorf is an example of such an individual – his life and activities were conditioned by the difficult neigh- bourly relations with the Teutonic State in Prussia and the Polish Crown. The situ- ation of the son of the Chełmno Land, which was governed by the Teutonic Order when Paul Legendorf came to this world at the beginning of the 15th century, became much more complex in the middle of that century after a repudiation of allegiance followed by a declaration of war against the Order stated by Chełmno Land’s inhabitants. The position of Paul Legendorf became even more uncomfort- able when in the course of the Thirteen Years‘ War between the Teutonic State and the Polish Crown (1454–1466), more specifically in autumn 1458, he was appointed by the Pope to the position of a Warmian diocese administrator (curiously enough, he ineffectively tried to seize a position at his domestic Chełmno diocese). Ever since he came to Warmia in the summer of 1460 until the end of the Thirteen Years‘ War in autumn 1466, he was forced to maintain the balance between the conflicted parties. -

Where Are You, Prusai ? Lech Z
Lech Z. Niekrasz Where are you, Prusai ? Lech Z. Niekrasz Where are you, Prusai ? The memory of the ancient Prusai have not passed with the wind and therefore it deserves our respect, so that history is not covered by falsehood. Lech Z. Niekrasz Where are you, Prusai ? Translated by Michael Kulczykowski Author Lech Z. Niekrasz Redaction Slawomir Klec Pilewski Graphics Slawomir Klec Pilewski Translation Michael Kulczykowski Cover: Oil painting by Wojciech Kossak from a private collection The Prusai: The Prus Society www.prusowie.pl contact [email protected] Editor Print and cover All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the Publishers and the Copyright owners. FOREWORD It is worthwhile spending a moment to consider the problem which emerged after the conclusion of the second world war. It concerns the naming of the part of the former territory of Prusia, which was incorporated into post-war Poland. In view of the unfortunate traditions of German Prussianism and the associated worst possible memories, nobody wished to call this territory Prussia although it was to a substantial degree still inhabited by the indigenous descendants of the ancient Prusai, who saw no need to leave the land of their forefathers and talked of themselves us “ We are not Germans but we are also not Poles, we are locals”. After the war Stalin carried out another successive crime by ordering the deportation to Germany tens of thousands the descendants of the Prus people from the territory annexed by the USSR, the so called Kaliningrad region. -

Der Deutsche Orden (German Edition)
Jürgen Sarnowsky DER DEUTSCHE ORDEN Verlag C.H.Beck Zum Buch Der während des Dritten Kreuzzugs im Heiligen Land gegründete Deutsche Orden spielt durch das Ordensland Preußen eine herausragende Rolle in der deutschen Geschichte. Jürgen Sarnowsky erzählt die faszinierende Geschichte des Ritterordens von den Anfängen bis heute und beschreibt dabei nicht nur seine politische Rolle, sondern auch seine Spiritualität sowie seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung, die weit über Deutschland hinausweisen. Über den Autor Jürgen Sarnowsky, geb. 1955, ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Hamburg und u.a. Zweiter Vorsitzender der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Vorstandsmitglied des Hansischen Geschichtsvereins und Mitglied der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens. Bei C.H.Beck erschien von ihm außerdem „Die Templer“ (2009). Inhalt Einleitung I. Die Anfänge 1. Die Entstehung des deutschen Hospitals 2. Der geistliche Ritterorden und die Entfaltung seiner Strukturen 3. Die Entwicklung im Mittelmeerraum bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 4. Die Anfänge im Reich des 13. Jahrhunderts 5. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen 6. Der Erwerb Preußens und Livlands 7. Die Frühzeit der Ordensherrschaft und der Abschluss der Christianisierung Preußens 8. Ausbau der Landesherrschaft in Preußen 9. Die Litauerfeldzüge und die Außenpolitik in Preußen im 14. Jahrhundert 1. Strukturen und Verfassung 2. Die Balleien im Reich im 14. und 15. Jahrhundert 3. Der Deutsche Orden in Livland im 14. und 15. Jahrhundert 4. Der Deutsche Orden im Mittelmeerraum im 14. und 15. Jahrhundert 5. Die Wirtschaftsführung 6. Das Alltagsleben 7. Kultur und Literatur 8. Selbstverständnis und Fremdwahrnehmung III. Krisen und Erneuerung 1. Der Deutsche Orden und Polen-Litauen nach der Union von 1386 2. -
Articles Dieners in the Service of The
ZAPISKI HISTORYCZNE — TOM LXXXIII — ROK 2018 Zeszyt 1 Articles http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.15 SŁAWOMIR JÓŹWIAK (Nicolaus Copernicus University in Toruń) Dieners in the Service of the Teutonic Order in Prussia in the Second Half of the 14th Century – the First Half of the 15th Century: the Group Size, Maintenance, Accommodation* Key words: the Middle Ages, topography of Teutonic castles, the Monastic State in Prussia, servants of the Teutonic Order Research on the issues of lay people residing permanently or temporarily in the vicinity of the grand masters and other Teutonic dignitaries and officials in the monastic state in Prussia in the 14th and 15th centuries remains only in the initial phase; however, luckily, there are plenty of sources through which the analysis is possible. Dieners were a characteristic and (in different periods) diversified group, which in this context may be captured. However, it is not at all easy to define precisely a group of people who, in the accounts written and edited in the late medieval Teutonic state in Prussia, hid under such a defini tion. The German historian Bernhart Jähnig, recapitulating 16 years ago the state of knowledge about those who appeared in the circle of grand masters in Malbork, recognized that this group included young people from knightly families who decided to serve the head of the Order for some time. During the time of their service, they acquired political experience at the court of the grand masters, but they remained in a secular state and did not join the group of Teutonic knights. -

Second Treaty of Thorn
Second Treaty Of Thorn Unelated Sydney besom, his diarchies nebulize thigs informally. Waking Magnum glosses apiece while Josef always rank his sardius bungle contentedly, he whip so gibingly. Is Barnard strongish or epagogic when localise some crownworks depraves illy? Families from state to treaty of thorn Literary only and Definitions T. Thorn forest Oxford Reference. List of treaties Wikipedia the free encyclopedia. Treaty of Thorn 1939 by Lehnaru on DeviantArt. The Project Gutenberg EBook of Flower Fruit and Thorn Pieces by Jean Paul. In most second crown of the 19th century telegraphy was cutting edge technologysimilar to appreciate's cell phones and Internet In accordance with their import. East Prussia Ostpreuen a former province of Prussia and the 2nd 3rd. He resents the peace treaty other ruling High Fae made with humans. Royal Prussia light pink in the relative half story the 16th century. The Second Peace of Torun October 19 1466 Thorn now Toru Ludwig von Erlichshausen Great science of render Order of Teutonic Knights signs a peace. The Peninsular War against Britain was usually thorn in the desire of praise great European. The Bitter Kingdom The groan of worse and Thorns Book 3 Book. The USSR believes that a line always be drawn under various War II. It might have to be compelled to distinguish one hand with it will be seen a second act provisions for quite important. The treaty with a human voice that is no other reason for dealing with us, but her hips against. There would be advantageous if he could walk like that is why are you can only one needs? One boy holds a squad and stands ready for our throw yourself a second people who. -

Die Osteroder Komture Des Deutschen Ordens Und Ihre Laufbahnen
Die Osteroder Komture des Deutschen Ordens und ihre Laufbahnen von Bernhart Jähnig Als die Komturei Osterode gegründet wurde, war der Ausbau der Verwaltung des Deutschen Ordens in Preußen noch in lebhaftem Fluß. Nachdem die Ordensleitung im Jahre 1309 ihren Sitz nach Preußen in die Marienburg an der Nogat verlegt hatte, läßt sich an verschiedenen Dingen erkennen, wie sich der Orden um eine Straffung seiner Verwal- tung bemühte. Nach einer Übergangszeit unter Hochmeister Karl von Trier (1311—1324) wurde das Amt eines Landmeisters von Preußen 1324 abgeschafft, 1335 wurde die Bailei Kulm aufgehoben und für das neue Land Pommerellen wurde nach 1309 gar nicht erst ein Landkomtur eingesetzt. Alle Komtureien Preußens unterstanden seitdem unmittelbar der Ordensleitung.1 Im Bereich der Finanzverwaltung war es Hochmei- ster Wernervon Orseln (1324—1330) gelungen, eine hochmeisterliche Kammer zu schaffen.2 Diesen Zentralisierungsbemühungen wider- spricht nur scheinbar, daß im Zuge des fortschreitenden Siedelwerks Folgende Abkürzungen werden beim Zitieren verwandt: APB = Altpreußische Biographie, 1—4/1, Königsberg 1941, Marburg/Lahn 1989—1984. AStT = Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. von M. Toeppen, 1—5, Leipzig 1878—1886, Neudruck Aalen 1973—1974. GAB = Das Große Ämterbuch des Deutschen Ordens, hrsg. von W. Ziesemer, Danzig 1921, Neudruck Wiesbaden 1968. MAB = Das Marienburger Ämterbuch, hrsg. von W. Ziesemer, Danzig 1916. NC = J.Voigt: Namen-Codex der Deutschen Ordens-Beamten, Königsberg 1843, Neudruck Niederwalluf 1971. PrUB = Preußisches Urkundenbuch, 1/1—3/1, Königsberg 1882—1944, Neudruck Aalen 1960—1962; 3/2—5/3, Marburg/Lahn 1960—1976. ROT = Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198—1525, bearb. -

Ordines Militares Conference
ORDINES◆ MILITARES COLLOQUIA ToRUNENSIA HISTORICA Yearbook for the Study of the Military Orders vol. XVII (2012) DIE RITTERORDEN IN UMBRUCHS- UND KRISENZEITEN The Military Orders in Times of Change and Crisis Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Towarzystwo Naukowe w Toruniu Toruń 2012 Editorial Board Roman Czaja, Editor in Chief, Nicolaus Copernicus University Toruń Jürgen Sarnowsky, Editor in Chief, University of Hamburg Jochen Burgtorf, California State University Sylvain Gouguenheim, École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon Hubert Houben, Università del Salento Lecce Alan V. Murray, University of Leeds Krzysztof Kwiatkowski, Assistant Editor, Nicolaus Copernicus University Toruń Reviewers: Darius von Guettner, School of Historical and Philosophical Studies, University of Melbourne Sławomir Jóźwiak, Institute of History and Archival Sciences, Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń Tomasz Jurek, Institute of History of Polish Academy of Sciences Juhan Kreem, City Archives of Tallinn Johannes A. Mol, Institute for History, University Leiden Maria Starnawska, Institute of History, Jan Dlugosz University in Częstochowa Sławomir Zonnenberg, Institute of History and International Relationships, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Address of Editorial Office: Instytut Historii i Archiwistyki UMK, ul. Gagarina 9 87-100 Toruń e-mail: [email protected] [email protected] Subscriptions orders shoud be addressed to: [email protected] Printed in Poland © Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika © Copyright by Towarzystwo Naukowe w Toruniu Toruń 2012 ISSN 0867-2008 NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY PRESS Editorial Office: ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń tel. (0) 56 611 42 95, fax (0) 56 611 47 05 e-mail: [email protected] Distribution: ul. Reja 25, 87-100 Toruń tel./fax (0) 56 611 42 38 e-mail: [email protected] www.wydawnictwoumk.pl First edition Print: Nicolaus Copernicus University Press ul. -

Copernicus Trial in the Warminsko-Mazurskie Voivodeship
Destinations on the Copernicus Trail An invitation for a journey along the Nicolaus Copernicus trail............ 1 Practical tips............................................... 2 Voivodeship border – Nowe Miasto Lubawskie......................... 3 Nowe Miasto Lubawskie............................ 4 Nowe Miasto Lubawskie – Lubawa.......... 6 Lubawa....................................................... 7 Lubawa – Olsztynek................................ 10 Olsztynek.................................................. 11 Olsztynek – Olsztyn................................. 14 Olsztyn...................................................... 15 Olsztyn – Dobre Miasto.............................. 19 Dobre Miasto............................................ 23 Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński....... 24 Lidzbark Warmiński................................. 25 Lidzbark Warmiński – Pieniężno........... 28 Orneta...................................................... 29 Pieniężno.................................................. 31 Pieniężno – Braniewo............................... 34 Braniewo................................................... 35 MARSHAL’S OFFICE Braniewo – Frombork.............................. 37 OF THE WARMINSKO-MAZURSKIE VOIVODESHIP TOURISM DEPARTMENT Frombork.................................................. 38 Frombork – Tolkmicko............................... 43 10-052 Olsztyn, Mariańska 3 st. T: +48 89 521 69 00 Copernicus Trail Tolkmicko.................................................. 44 E: [email protected] W: www.warmia.mazury.pl -

Prussian. Ciety and the German Aristocratic
T H 6 (réRM AN ORDER A n10> PRUSS/Ats/ 5oC(£T'f : A N 0 6 L ^ CoRPoRATlOÏ^ IN CRlSlS^ 1^+IO-lU.ki) PRUSSIAN. CIETY AND THE GERMAN ARISTOCRATIC CORPORATION IN CRISIS c.^410-1466 Thesis presented for the Degree of PhD of the Universitv of London by MICHAEL CHRISTOPHER BENNET BURLEIGH Bedford College, University of London May 198 2 ProQuest Number: 10098432 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10098432 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT This thesis attempts to use the exceptionally rich archives of the German Order to reveal something of the actuality of life in an aristocratic ecclesiastical corporation in society and under stress between c. 1410 and 1466. It differs from previous histories of the Order in that it attempts to combine analysis of long term social change with a narrative of political events. The first chapter attempts to characterise German peasant society on the Marienburger Werder in the fourteenth and fifteenth centuries. It seeks to give precision to social and economic relationships and argues that peasant communal organisation and powers of resis tance to seigneurial coercion were not retarded in medieval Prussia.