Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
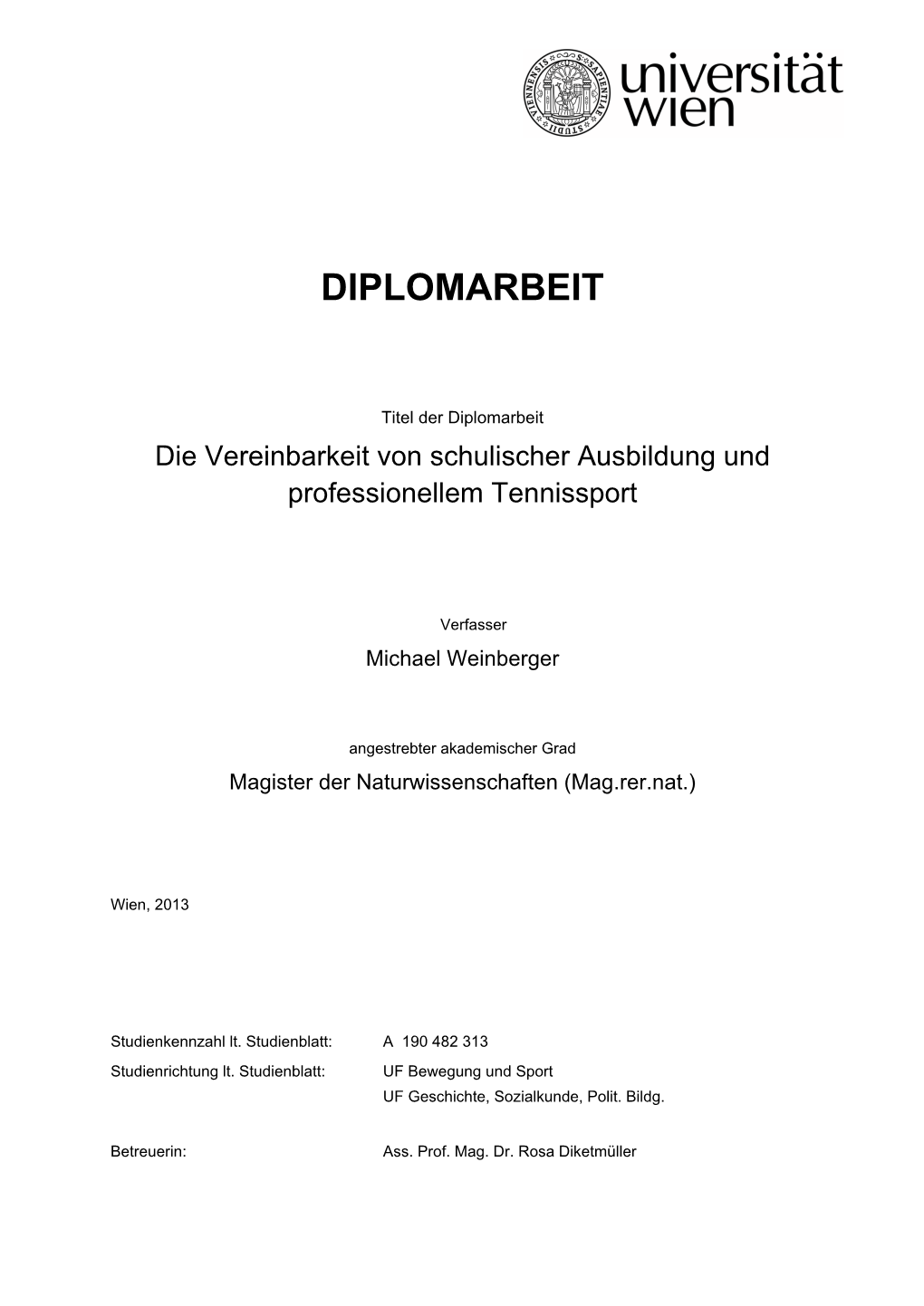
Load more
Recommended publications
-

SPORT Die Schweiz Hat Ihn Wieder «Als Sähe Man Brasilianern Beim Fussball Zu» Frühstück Mit Dem Champion
NeuöZürcörZäitung SPORT Dienstag, 8.Juli 2003 Nr.15541 Wort zum Sport Die Schweiz hat ihn wieder Hallo, Nostradamus Das Gstaader Traditionsturnier begrüsst sein erdenschweres Aushängeschild Roger Federer Dieses Jahr wird der 500.Ge- gel. Gstaad, 7.Juli ler auf Sand im Saanenland bisher allerdings burtstag des französischen Me- unterdurchschnittlich ab (ein Erfolg, fünf Nieder- diziners und Astrologen Nostra- Erstmals seit zwölf Jahren, als Michel Stich lagen). Diesmal konzentriert sich Federer nur aufs damus (1503–1566) gefeiert, 1991 in London seinen Landsmann Boris Becker Einzel. Hermenjat würde sich über ein Fort- wenn auch leider nur ziemlich in den Senkel stellte, tritt der Wimbledon-Cham- kommen seines Aushängeschilds freuen, das am diskret. Dabei hätten gerade wir pion wieder am Swiss Open Gstaad an. Roger ersten Tag die Computer-Grafiken im Vorverkauf sportlich interessierten Zeitge- Federer landete im Privatjet einer in Genf domi- um sechzig Prozent nach oben rotieren liess. nossinnen und -genossen allen zilierten Firma um 18.12 Uhr auf dem Flugplatz Saanen, dessen unebene Piste vor mehr als einem Bereits am englischen Championships-Day Grund dazu, dem seiner Weis- hatte der Routinier Hermenjat kühl verschiedene sagungen wegen berühmt ge- Jahrzehnt saniert und neu asphaltiert worden war, damit die empfindliche Elektronik in den Flug- Flug-Szenarien kalkuliert, da der frühere Eis- wordenen Leibarzt von König hockey-Verteidiger um das Glatteis auch im Ten- KarlIX. Kränze der Dankbar- zeugen präzis arbeitet und die Jets bei jedem Wet- ter landen können. Der Schweizer Tennis-Tell nisgeschäft weiss. «Jeder Champion figuriert erst keit zu winden. Nirgendwo wie in der Draw, wenn ich ihn mit Handschlag be- im Reiche des Sports – sei's im trifft in Runde eins auf Spaniens Qualifikanten Marc Lopez ´ (ATP 190). -

THE ROGER FEDERER STORY Quest for Perfection
THE ROGER FEDERER STORY Quest For Perfection RENÉ STAUFFER THE ROGER FEDERER STORY Quest For Perfection RENÉ STAUFFER New Chapter Press Cover and interior design: Emily Brackett, Visible Logic Originally published in Germany under the title “Das Tennis-Genie” by Pendo Verlag. © Pendo Verlag GmbH & Co. KG, Munich and Zurich, 2006 Published across the world in English by New Chapter Press, www.newchapterpressonline.com ISBN 094-2257-391 978-094-2257-397 Printed in the United States of America Contents From The Author . v Prologue: Encounter with a 15-year-old...................ix Introduction: No One Expected Him....................xiv PART I From Kempton Park to Basel . .3 A Boy Discovers Tennis . .8 Homesickness in Ecublens ............................14 The Best of All Juniors . .21 A Newcomer Climbs to the Top ........................30 New Coach, New Ways . 35 Olympic Experiences . 40 No Pain, No Gain . 44 Uproar at the Davis Cup . .49 The Man Who Beat Sampras . 53 The Taxi Driver of Biel . 57 Visit to the Top Ten . .60 Drama in South Africa...............................65 Red Dawn in China .................................70 The Grand Slam Block ...............................74 A Magic Sunday ....................................79 A Cow for the Victor . 86 Reaching for the Stars . .91 Duels in Texas . .95 An Abrupt End ....................................100 The Glittering Crowning . 104 No. 1 . .109 Samson’s Return . 116 New York, New York . .122 Setting Records Around the World.....................125 The Other Australian ...............................130 A True Champion..................................137 Fresh Tracks on Clay . .142 Three Men at the Champions Dinner . 146 An Evening in Flushing Meadows . .150 The Savior of Shanghai..............................155 Chasing Ghosts . .160 A Rivalry Is Born . -

Doubles Final (Seed)
2016 ATP TOURNAMENT & GRAND SLAM FINALS START DAY TOURNAMENT SINGLES FINAL (SEED) DOUBLES FINAL (SEED) 4-Jan Brisbane International presented by Suncorp (H) Brisbane $404780 4 Milos Raonic d. 2 Roger Federer 6-4 6-4 2 Kontinen-Peers d. WC Duckworth-Guccione 7-6 (4) 6-1 4-Jan Aircel Chennai Open (H) Chennai $425535 1 Stan Wawrinka d. 8 Borna Coric 6-3 7-5 3 Marach-F Martin d. Krajicek-Paire 6-3 7-5 4-Jan Qatar ExxonMobil Open (H) Doha $1189605 1 Novak Djokovic d. 1 Rafael Nadal 6-1 6-2 3 Lopez-Lopez d. 4 Petzschner-Peya 6-4 6-3 11-Jan ASB Classic (H) Auckland $463520 8 Roberto Bautista Agut d. Jack Sock 6-1 1-0 RET Pavic-Venus d. 4 Butorac-Lipsky 7-5 6-4 11-Jan Apia International Sydney (H) Sydney $404780 3 Viktor Troicki d. 4 Grigor Dimitrov 2-6 6-1 7-6 (7) J Murray-Soares d. 4 Bopanna-Mergea 6-3 7-6 (6) 18-Jan Australian Open (H) Melbourne A$19703000 1 Novak Djokovic d. 2 Andy Murray 6-1 7-5 7-6 (3) 7 J Murray-Soares d. Nestor-Stepanek 2-6 6-4 7-5 1-Feb Open Sud de France (IH) Montpellier €463520 1 Richard Gasquet d. 3 Paul-Henri Mathieu 7-5 6-4 2 Pavic-Venus d. WC Zverev-Zverev 7-5 7-6 (4) 1-Feb Ecuador Open Quito (C) Quito $463520 5 Victor Estrella Burgos d. 2 Thomaz Bellucci 4-6 7-6 (5) 6-2 Carreño Busta-Duran d. -

Tennis Glory Ever Could
A CHAMPION’S MIND For my wife, Bridgette, and boys, Christian and Ryan: you have fulfilled me in a way that no number of Grand Slam titles or tennis glory ever could Introduction Chapter 1 1971–1986 The Tennis Kid Chapter 2 1986–1990 A Fairy Tale in New York Chapter 3 1990–1991 That Ton of Bricks Chapter 4 1992 My Conversation with Commitment Chapter 5 1993–1994 Grace Under Fire Chapter 6 1994–1995 The Floodgates of Glory Chapter 7 1996 My Warrior Moment Chapter 8 1997–1998 Wimbledon Is Forever Chapter 9 1999–2001 Catching Roy Chapter 10 2001–2002 One for Good Measure Epilogue Appendix About My Rivals Acknowledgments / Index Copyright A few years ago, the idea of writing a book about my life and times in tennis would have seemed as foreign to me as it might have been surprising to you. After all, I was the guy who let his racket do the talking. I was the guy who kept his eyes on the prize, leading a very dedicated, disciplined, almost monkish existence in my quest to accumulate Grand Slam titles. And I was the guy who guarded his private life and successfully avoided controversy and drama, both in my career and personal life. But as I settled into life as a former player, I had a lot of time to reflect on where I’d been and what I’d done, and the way the story of my career might impact people. For starters, I realized that what I did in tennis probably would be a point of interest and curiosity to my family. -

Verksamhetsberättelse 2018
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet ................................................................................................................................. 5 Idrottens organisation .................................................................................................................................. 7 Styrelse, projektgrupper och kansli ............................................................................................................ 9 Historia ......................................................................................................................................................... 11 Till minne av Martin Carlstein .................................................................................................................. 19 Verksamhetsplan 2019 ................................................................................................................................ 21 Policy i olika frågor ..................................................................................................................................... 25 Utmärkelser.................................................................................................................................................. 27 Barn och ungdom ........................................................................................................................................ 31 Klubbutveckling, klubbesök, tennis- och multibanor .......................................................................... -

Andy Murray Articles 2006-2008|
ANDY MURRAY ARTICLES 2006-2008 | In 2006 Andy Murray began his voyage into World top 20 Tennis players. Starting with a tame Australian Open campaign which led to a strained relationship with the bullish British press. His first ATP tour title in San Jose beating two Former Grand Slam Champions along the way. While a rather upsetting coaching split and a trouncing of the World number 1 filled a year where progress was there for the tennis public to see but attitude and off court issues usually filled the journalists copy. 2006 Scrappy Murray prevails after sluggish start By Neil Harman, Tennis Correspondent Published at 12:00AM, January 4 2006 HIS first match of 2006 reassured Andy Murray’s followers yesterday that the element of his game that stands him in such stead as a professional of rare promise — his love of a scrap — is undimmed. From every standpoint, Murray’s defeat of Paolo Lorenzi, an Italian qualifier, in the first round of the Next Generation Adelaide International, was exactly the kind of thrash in the dark of which these first-week events are chock-full. He served seven aces, six double faults, broke serve seven times in 12 attempts, lost his own service three times and won the final five games. The one statistic to matter was a 3-6, 6-0, 6-2 victory and a place in the second round today against Tomas Berdych, a player being touted every bit as fiercely in his native Czech Republic as Murray is in Britain. Berdych’s last defeat was against Murray in the second round of the Davidoff Swiss Indoors in Basle in October, after which the Scot was almost buried in headlines about the passing of the British baton — he defeated Tim Henman in the first round — while Berdych went on to overhaul a star-studded field and lift the Paris Masters. -

Die Träume Des 18-Jährigen Roger Federer
Sonntag | Nr. 34 | 29. August 2010 SPORT Seite 30 Die Träume des 18-jährigen Roger Federer Antworten des Schweizer Weltstars aus einem vor zehn Jahren geführten Interview mit dem «Sportmagazin» – und was inzwischen daraus geworden ist Traumfrau rin Lüthi schon mal auf, allerdings allen Einladungen folgen, überall schätzt seine jährlichen Einkünfte nicht, wenns auf dem Platz wirklich den Ehrengast spielen. Dennoch ver- im Moment auf 43 Millionen Dollar. «Sie sollte schon hübsch sein. hart auf hart geht. Und dann lassen steckt er sich gerade in der Schweiz Federer nennt inzwischen Häuser So eine Mischung aus Pamela sie auch mal den einen oder ande- gar nicht. Und es gibt wohl kaum ei- und Wohnungen in Oberwil BL, Wol- Anderson und Cindy Crawford, ren Spruch fallen. Ganz im Gegen- nen Spieler auf der Tour, der nach lerau SZ, Valbella GR und Dubai sein das wärs. Aber es müssen satz zu seinem Freund, dem ameri- den Trainings so viele Autogramme Eigen. In seiner Garage stehen Lu- natürlich auch viele andere kanischen Supergolfer Tiger Woods, schreibt wie Federer oder sich auch xusautos. Die Zeiten, als er von Basel Sachen stimmen.» der wegen seiner Affären nun frisch für ein Erinnerungsfoto hinstellt. mit dem Zug zum Turnier nach Lyon Im Kreis der Schauspieler be- geschieden ist, gibts bei Federer bis- Ein Autogramm zu erhalten, ihm da- gefahren ist, sind lange vorbei. Nun wegte sich Federer nicht. So her aber noch keine Anzeichen, dass bei selbst Karte und Stift in die Hand leistet er sich schon mal einen Pri- musste er an einem anderen er auch noch in fremden Revieren drücken, ist kein besonderes Prob- vatjet. -

Die Geschichte Des Schweizer Davis Cup Teams Von 1992 Bis 2015
Von Final zu Final und weiter – die Geschichte des Schweizer Davis Cup Teams von 1992 bis 2015 Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen und einer ganz besonderen Krönung 1992 wars, als die Schweiz erstmals ein Davis- Cup-Endspiel erreichte. Gegner waren die USA; 1:3 hiess es nach drei Tagen. Seit den "goldenen Tagen von Fort Worth" sind etliche Jahre vergangen. Jahre mit vielen Höhen und Tiefen. Jahre, in denen sich das Schweizer Team grundlegend erneuert hat und 2014 den grössten Erfolg seiner Geschichte feiern konnte. Ein Blick zurück auf die letzten Davis-Cup-Jahre... Irgendwie ist es bezeichnend: 1992, dem Jahr des bisher grössten Erfolges in der Schweizer Davis-Cup- Geschichte, folgten die Ernüchterung von Kalkutta und Tel Aviv. 1993 war ein verlorenes Jahr, ein Jahr der vielen Missgeschicke. Dem Jahr des Triumphs hinkte das Jahr des tiefen Falls hinterher. Irgendwie hatte sich alles gegen die Davis-Cup-Helden von Fort Worth verschworen: Die Auslosung mit der Erst- Runden-Begegnung im fernen Indien, die unbeschreibliche Armut in Kalkuttas Strassen, die selbst den ausgebufften Profis Marc Rosset und Jakob Hlasek den Schlaf raubte, der unsägliche Rasenplatz inmitten eines fürchterlichen Panoramas von Armut, Dreck und Kriegsfilmkulisse mit halbverfallenen Häusern. Die Schweizer, etwas spät angereist, verfielen dem Trauma des Siegen-Müssens, verloren Spiel und Partie und fanden sich unvermittelt in der Abstiegsrunde in Israel wieder. An jenem verhängnisvollen Freitag begannen die entscheidenden Partien morgens um acht, mit Rücksicht auf den israelischen Feiertag zum Jom Kippur wurde die normalerweise am Wochenende stattfindende Begegnung kurzerhand zwei Tage vorverschoben. Und es kam, wie es kommen musste: Der lange Schatten Kalkuttas reichte bis ins schmucke Canada Stadium zu Ramat Hasharon, die Schweizer stiegen in die Europazone ab, Coach Georges Deniau und Captain Tim Sturdza nahmen den Hut. -
MHS GRIDDERS FALL Stock Prices Swing Widely
Official Killer Rowland joins field Huskies in chase Hurricane Jerry of governor hopefuls/4 z ' after beating UMass/11 blamed in 2 deaths/5 Hflanrlipatpr Mprali i t . Monday, Oct. 16,1989 Manchester, Conn. — A City of Village Charm Newsstand Price; 35 Cents IfflaurhrBtrr Hrralft A’s, Giants ready for Series opener Stock prices swing widely NEW YORK (AP) — Stock — see page 41 prices bounced like a ping pong ball today in a crush of Uading so heavy SPORTS that it was difficult to get an ac curate reading on the Dow Jones in dustrial average, which gyrated wildly. The key Dow index was up 16.19 points at 2,585.45 at 10:30 a.m., 5 MHS GRIDDERS FALL with some issues posting impressive gains, after an initial dive of about 65 points. Volume was even heavier than on By Jim Tierney Black Monday, Oct. 19, 1987, ac Manchester Herald cording to Richard Torrenzano, the WILLIMANTIC — Windham High football coach New York Stock Exchange’s chief Brian Cruddcn challenged his offensive line at halfUme spokesman. About 131 million of Friday night’s CCC East encounter with visiUng shares were traded in the first hour, about eqtial to the typical trading for Manchester High. Cruddcn’s dominant offensive line took charge m me an entire day. second half, opening up gaping holes for its ^ m g In spite of the Dow Jones in dustrials’ gain, declining issues out backs, as the >^^ippets defeated the Indians, 46-28. Reginald Pinto/Manchester Herald Windham, which strung 220 mshing yards out among numbered advancing ones by about five backs, remains undefeated at 3-0 in the league and HELPING OTHERS — Jean McGrath, a volunteer at the a 7-to-l margin in the overall 3-2 overall. -
Histoire De L'équpe Suisse De Coupe Davis
Kommunikation Biel, 23.02.2015 / sp De 1992 jusqu'à 2014 Jusque à 2014 c’était ne seule fois que la Suisse a frôlé l'exploit en Coupe Davis. C'était en 1992, à l'occasion de la finale contre les Etats-Unis, perdue par la Suisse 1 :3. De nombreuses années ponctuées d'échecs, de malchance et de pannes se sont écoulées depuis « l'âge d'or de Fort Worth ». Des années de renouvellement et de renaissance pour l'équipe suisse qui peut maintenant pour la première fois depuis longtemps se remettre à rêver. Flash-back dans le passé suisse de la Coupe Davis... Plus on monte haut, plus on peut tomber bas. L'équipe suisse de Coupe Davis, arrivée au sommet de sa gloire en 1992, en a fait la douloureuse expérience avec les douches froides de Calcutta et Tel Aviv. 1993 fut une année perdue, l'année des infortunes à répétition, l'année de la chute libre. Tout semblait vouloir se liguer contre les héros de Fort Worth: le sort qui leur avait destiné une rencontre de premier tour dans l'Inde lointaine, la misère indicible des rues de Calcutta qui priva de sommeil des professionnels de la trempe d'un Marc Rosset ou Jakob Hlasek, l'inénarrable gazon au cœur d'un terrible décor de pauvreté, d'insalubrité et de maisons délabrées digne du plus noir des films de guerre. Arrivés tard sur les lieux, les Suisses, hantés par l'obsession de gagner, perdirent leurs moyens et la rencontre, et se retrouvèrent en Israël pour le barrage.. -
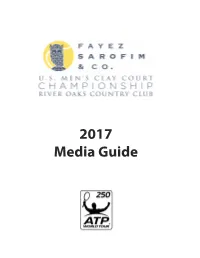
2017 Media Guide Layout 1
2017 Media Guide 2017 US Clay Storylines About the Tournament Youth Movement The Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Champi- There are seven players under the age of 21 in the Top 100 onship is an ATP World Tour 250 event. It is the only ATP event of the Emirates ATP Rankings, and four of them will be at River played on clay in North America. Oaks: France Tiafoe (19), Jared Donaldson (20), Hyeon Chung This year is the 107th edition of the U.S. Men’s Clay Court (20) and Ernesto Escobedo (20). Championship, which started in 1910. The tournament has been held in 21 different U.S. cities, and has called Houston Top of the Heap home since moving to Westside Tennis Club in 2001. Jack Sock is the No. 1 seed this week, which is the first time This year marks the 10th time River Oaks Country Club has he has been the top seed at an ATP World Tour event in his ca- hosted the tournament. River Oaks first hosted tournament reer. At 24-years-old, he is the youngest No. 1 seed at the tour- tennis in 1931, including an event on the World Championship nament since 23-year-old Andy Roddick in 2006. Tennis circuit from 1970 into the mid-1980s. After hosting a prestigous prize money tournament in the ensuing years, River Seed Struggles Oaks became home to this ATP event in 2008. This will be the Since the tournament moved to Houston in 2001, nine un- 83rd tournament contested at River Oaks. -

Singles Doubles
2017 12-19 November 2017 in London, England (The O2) · 8 Players - 8 Teams - $ 8,000,000 (Indoor Hard) SUNDAY, 19 NOVEMBER 2017 WEDNESDAY, 15 NOVEMBER 2017 Singles - Final Singles - Round Robin - Group Pete Sampras [6] G. Dimitrov (BUL) d [7] D. Goffin (BEL) 75 46 63 [4] D. Thiem (AUT) d [Alt] P. Carreno Busta (ESP) 63 36 64 [6] G. Dimitrov (BUL) d [7] D. Goffin (BEL) 60 62 Doubles - Final [2] H. Kontinen (FIN) / J. Peers (AUS) d [1] L. Kubot (POL) / M. Melo (BRA) 64 62 Doubles - Round Robin - Group Woodbridge/Woodforde [1] L. Kubot (POL) / M. Melo (BRA) d. [5] B. Bryan (USA) / M. Bryan (USA) 64 63 [4] J. Murray (GBR) / B. Soares (BRA) d. [7] I. Dodig (CRO) / M. Granollers (ESP) 61 61 SATURDAY, 18 NOVEMBER 2017 Singles - Semi-finals TUESDAY, 14 NOVEMBER 2017 [7] D. Goffin (BEL) d [2] R. Federer (SUI) 26 63 64 Singles - Round Robin - Group Boris Becker [6] G. Dimitrov (BUL) d [8] J. Sock (USA) 46 60 63 [2] R. Federer (SUI) d [3] A. Zverev (GER) 76(6) 57 61 Doubles - Semi-finals [8] J. Sock (USA) d [5] M. Cilic (CRO) 57 62 76(4) [1] L. Kubot (POL) / M. Melo (BRA) d [8] R. Harrison (USA) / M. Venus (NZL) 61 64 Doubles - Round Robin - Group Eltingh/Haarhuis [2] H. Kontinen (FIN) / J. Peers (AUS) d [4] J. Murray (GBR) / B. Soares (BRA) 76(2) 62 [2] H. Kontinen (FIN) / J. Peers (AUS) d [3] J. Rojer (NED) / H. Tecau (ROU) 76(3) 76(6) [8] R.