Dissertation / Doctoral Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
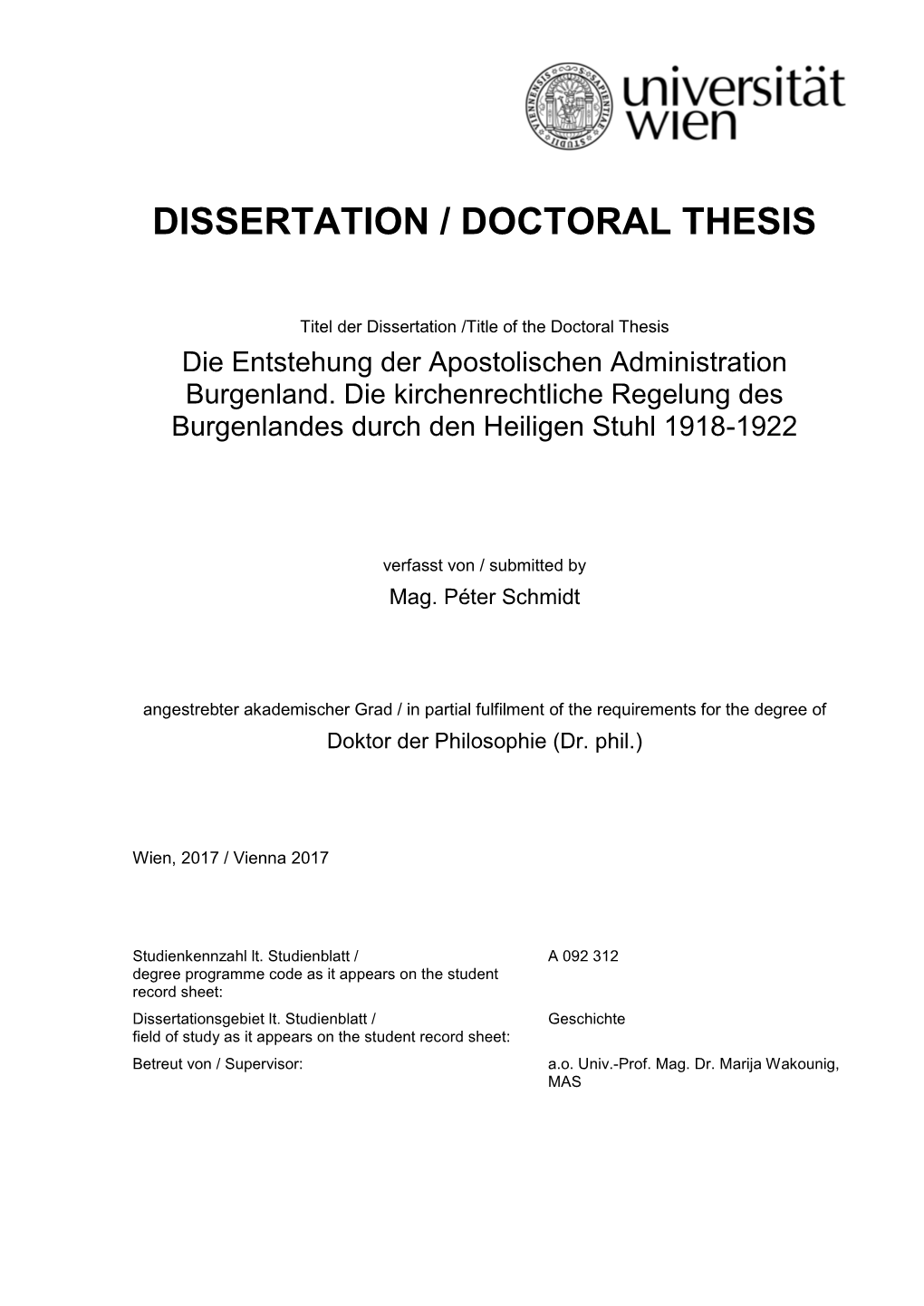
Load more
Recommended publications
-

The Sacraments of Initiation in the Work of Pius Parsch with an Outlook Towards the Second Vatican Council’S Constitution on the Sacred Liturgy
THE SACRAMENTS OF INITIATION IN THE WORK OF PIUS PARSCH WITH AN OUTLOOK TOWARDS THE SECOND VATICAN COUNCIL’S CONSTITUTION ON THE SACRED LITURGY A Dissertation Submitted to the Catholic Theological Faculty of Paris Lodron University, Salzburg in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree Doctor of Theology by Saji George Under the Guidance of Uni.-Prof. Dr. Rudolf Pacik Department of Practical Theology Salzburg, November 2013 ACKNOWLEDGEMENTS I owe a debt of gratitude to those who have helped me in the course of writing this dissertation. First of all, with the Blessed Virgin Mary, I thank the Triune God for all His graces and blessings: “My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Saviour, […] for the Mighty One has done great things for me and holy is his name” (Lk. 1: 46-50). I express my heartfelt gratitude to Prof. Dr. Rudolf Pacik, guide and supervisor of this research, for his worthwhile directions, valuable suggestions, necessary corrections, tremendous patience, availability and encouragement. If at all this effort of mine come to an accomplishment, it is due to his help and guidance. I also thank Prof. Dr. Hans-Joachim Sander for his advice and suggestions. My thanks are indebted to Mag. Gertraude Vymetal for the tedious job of proof-reading, patience, suggestions and corrections. I remember with gratitude Fr. Abraham Mullenkuzhy MSFS, the former Provincial of the Missionaries of St. Francis De Sales, North East India Province, who sent me to Salzburg for pursuing my studies. I appreciate his trust and confidence in me. My thanks are due to Fr. -

TESI Lucacon Margini
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI (IX Ciclo) Tesi di Dottorato Verso il disgelo: Stati Uniti e Santa Sede, 1914-1940 Coordinatore Ch.mo Prof. Antonio Scocozza Tutor Dottorando Ch.mo Prof. Luigino Rossi Luca Castagna Anno Accademico 2009/2010 A Walter, Silvana, Francesco e Rossella … la mia storia. Indice Introduzione I Capitolo Primo 1 Universalismi incompatibili (1914-1920) 1. Neutrali, ma non imparziali 1 1.1 La Santa Sede 1 1.2 Gli Stati Uniti 7 2. Alle origini del “problema” 13 2.1 I rapporti politico-diplomatici 13 2.2 Al limite dell’eresia: Santa Sede e Chiesa statunitense tra fine Ottocento e Grande 23 guerra 23 3. 1916-’18: vani tentativi di dialogo 34 3.1 Wilson, Bonzano e Gibbons 34 3.2 Gli Stati Uniti e la Nota di Benedetto XV 40 4. L’irraggiungibile Versailles 55 5. Un’occasione mancata? 61 Capitolo Secondo 64 Una transizione difficile (1920-1932) 1. Gli Stati Uniti dopo la Grande guerra: il “normale” anti-papismo 64 2. La Chiesa cattolica statunitense tra Benedetto XV e Pio XI: un passaggio tormentato 77 3. Timidi segnali di convergenza lungo l’“asse” Harding-Bonzano 93 4. «Per la S. Sede è opportuno aspettare»: Fumasoni Biondi conosce Washington 108 5. Due “investimenti a medio termine” 121 5.1 Le elezioni presidenziali del 1928 121 5.2 I Patti Lateranensi 127 Capitolo Terzo 134 Una missione comune (1933-1940) 1. Il “nuovo corso” 134 1.1 Roosevelt: l’“apostolo” del riscatto 141 2. -
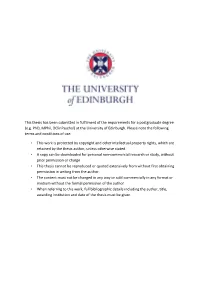
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. The Monument Question in Late Habsburg Austria A Critical Introduction to Max Dvořák’s Denkmalpflege Jonathan Blower Doctor of Philosophy The University of Edinburgh 2012 Abstract The present thesis is a critical introduction to a body of writings on heritage conservation by the Czech-born art historian Max Dvořák (1874–1921). From 1905 onwards, Dvořák was both professor of art history at the University of Vienna and Conservator General at the state institution responsible for heritage conservation in Austria: the ‘Royal and Imperial Central Commission for the Research and Preservation of Artistic and Historical Monuments’ (est. 1850). His published and archival texts on the subject are presented here for the first time in English translation. In this sense, the thesis follows the model of existing scholarship on the visual arts in Vienna around 1900, namely the combined English translations and critical introductions to the writings of Camillo Sitte (Collins & Collins, 1986), Otto Wagner (Mallgrave, 1988) and Alois Riegl (Forster & Ghirardo, 1982). -

1 Da Favorita Paper 02/2017
DA FAVORITA PAPER 02/2017 1 2 INHALT Preface Hans Winkler 5 Preface Oliver Kitz 7 1 Old States – New World 9 1.1 A divided world: power politics and the welfare state in international 9 relations 1.2 The dialectics of globalisation 10 1.3 What is the international community? 11 2 Diplomacy in the Centre of Europe: Austria 1814-1914 13 2.1 From Congress to War 13 2.2 From Greatness to Decline and Dissolution 16 3 World War I: Why did European Diplomacy Fail – Could it Happen 21 Today? 3.1 What did war mean for European diplomacy? 21 3.2 The concept of security and power was based on military strength 22 3.3 International relations based on the logic of war led to the formation 23 of military alliances 3.4 Every country had its own reason for why it wanted to go to war and 24 its own group pushing it in that direction 3.5 Why did European diplomacy fail? 24 3.6 Leading personalities in diplomacy embraced a logic of war 25 3.7 Press and public opinion 27 3.8 Can it happen again? 27 3.9 The war’s long lasting legacy 28 3.10 Geopolitical effects 28 3.10.1 The decline of Europe 29 3.10.2 Geopolitical development outside of Europe 29 3.10.3 Effects concerning internal developments in different states 30 3.10.4 Efforts concerning a future peaceful international order: A League of 30 Nations was created 4 Power Politics and Welfare Thinking in International Relations 32 4.1 Traditional Power Politics 32 4.2 Welfare Thinking in International Relations 33 3 4.3 The new diplomatic order in Europe 34 4.4 The United Nations system 35 4.5 The impact -

The Pleasant and the Useful: Pilgrimage and Tourism in Habsburg Mariazell
The Pleasant and the Useful: Pilgrimage and Tourism in Habsburg Mariazell The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Frank, Alison. 2009. The pleasant and the useful: pilgrimage and tourism in Habsburg Mariazell. Austrian History Yearbook 40:157-182. Published Version doi:10.1017/S0067237809000149 Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:10611804 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Pleasant and the Useful: Pilgrimage and Tourism in Habsburg Mariazell ALISON FRANK HE IDEA BEHIND THIS ARTICLE came from a riddle. A 1907 guidebook to the Austro-Hungarian pilgrimage site of Mariazell carried the following enigmatic line: “The traveler who, while visiting Mariazell, wishes to combine the pleasant and the T— useful for whom the pilgrimage should be at the same time an excursion into the mountains—will find a series of pretty promenades that lead him only a short way out of town and require absolutely no exertion.”1 The author most likely thought the meaning of this somewhat banal passage was completely clear. But the historian must wonder what exactly was “pleasant” and what was “useful” for the traveler to Mariazell. Was it pleasant to contemplate the majesty of God and the clemency of the Virgin Mary and useful to exercise one’s body in the fresh, mountain air—even without exertion? Or was it useful to demonstrate one’s piety and devotion via pilgrimage and dutiful time spent in mass, but pleasant to stroll through the temple of nature, admiring local flora and fauna along the way? Both of these interpretations are as truthful as they are possible, and their coexistence exemplifies a quintessential duality of religious tourism in the nineteenth century. -

Papal Reign by Symbolic Action and Emotional Communication Opportunities and Strategies to Inflame the « Roman Spirit » in Austria and Hungary Between the World Wars
RUPERT KLIEBER PAPAL REIGN BY SYMBOLIC ACTION AND EMOTIONAL COMMUNICATION OPPORTUNITIES AND STRATEGIES TO INFLAME THE « ROMAN SPIRIT » IN AUSTRIA AND HUNGARY BETWEEN THE WORLD WARS « How many divisions does the Pope have ? ». Iosif Vissarionovich Dzhugashvili, otherwise known as Joseph Stalin, is reputed to have asked this question in 1944. His cynicism was occasioned by discus- sions on whether the Holy See under Pope Pius XII (1939-1958) should be involved in negotiations on the reorganisation of Europe. Stalin had been one of the not inconsiderable number of contemporary figures to cause sleepless nights already for Pius XI. According to the 1926 Annuario Pontificio, Pius’« divisions » comprised a few companies of the Swiss Guard, the Guardia Palatina di Onore und the Gendarmeria Pontificia, along with 17 officers and, in addition, 93 members of the Corpo delle Guardie Nobili Pontificie.1 It goes without saying that the significance and influence of the Popes in the period after 1870 was not rooted in this token fighting force. Rather their power depended directly on the presence and acceptance of the highest Catholic office and of its incumbents – above all among the Catholic population and consequently in the context of the era’s power games in national poli- tics. Using Austria and Hungary as examples, this article discusses a number of questions with reference to the symbolic and emotional aspects of the reign of Pius XI : Are there signs of a specific « policy of emotions and symbols » ? If so, which traditional or new instruments served this policy, and with what success ? To what degree did curial ambitions encounter resistance or limitations posed by social condi- tions in a particular country ? Austria and Hungary undoubtedly belonged to the countries that lost most as a result of the First World War. -

Passionist International Bulletin N° 39 - New Series, 1-2016 Supplement to L’Eco of Saint Gabriel, Series 2016 Sped
Passionist International Bulletin N° 39 - New Series, 1-2016 Supplement to L’Eco of Saint Gabriel, Series 2016 Sped. in a.p. -45% art.2 comma 20/c legge 662/96 “We are all migrants, journeying in hope to… our true home.” Pope Francis CONTENTS Passionist International Bulletin N. 39 - New Series -1- 2016 Supplement to L’Eco of Saint Gabriel, MESSAGE OF THE SUPERIOR GENERAL TO THE PASSIONIST FAMILY Most Rev. Fr. Joachim Rego ........................... pag. 3 Editor “I AM A MIGRANT” ............................... » 5 General Curia of the Congregation of the Passion MESSAGE OF THE XV GENERAL SYNOD TO THE WHOLE PASSIONIST FAMILY ..................... » 8 General Consultor for Communications Fr. Denis Travers, C.P. THE MEETING OF THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR FORMATION Editing and Translation of Texts Fr. Martin Coffey ................................... » 9 Alessandro Foppoli, CP TWENTY-FIVE YEARS OF ADECO Antonio Munduate, CP Fr. Jesús María Aristín ............................... » 11 Giuseppe Adobati, CP Lawrence Rywalt, CP THE CONGREGATION OF THE PASSION Miguel Ángel Villanueva, CP AND ITS FIRST HOLY YEAR Fr. Alessandro Ciciliani .............................. » 12 Photography Arthur Carillo, CP MEETING OF THE EXECUTIVE BOARD OF PASSIONISTS INTERNATIONAL Javier Solís Basilio, CP Fr. Giuseppe Adobati Carrara .......................... » 14 Lawrence Rywalt, CP Stanley Baldon, CP PASSIONIST LIFE Address News from the Configurations and the Provinces Ufficio Comunicazioni Curia Generalizia ASSEMBLY OF THE PASPAC CONFIGURATION Piazza Ss. Giovanni e Paolo 13 Bro. Laurence M. Finn ............................... » 17 00184 Roma - Italy CENTENARY OF PASSIONIST PRESENCE IN SICILY Tel. 06.77.27.11 Fr. Rosario Fontana ................................. » 18 Fax. 06.700.84.54 Web Page: http://www.passiochristi.org REG (Mexico) PROVINCIAL CHAPTER ............... » 20 e-mail: [email protected] VULN (Germany-Austria) VICE-PROVINCIAL Graphics CONGRESS ...................................... -

HP TRIM Report
Archdiocese of Chicago Archives & Records Center Page 1 Title (Free Text Part) George Cardinal Mundelein Personal Papers Classification History Records - Finding Aid Owner Location George Mundelein Begin Date 1/1/1902 End Date 12/31/1939 Processor(s) Binder, Matthew; Satzik, Julie Date Created 2/13/2012 at 4:48 PM Accession Number 199005803 Number of Boxes 28 Security Unrestricted Access, Archives Copyright Notice No restrictions Collection Language(s) English; Italian; Latin Biographical/Administrative History George William Mundelein was born to parents Francis and Mary Mundelein in New York, on July 2, 1872. From his earliest years, Mundelein was educated by religious orders. Between school and a devoutly Catholic family, the Church made a distinct impression on the young man. He excelled in his studies at St. Nicholas’ Parochial School and was able to enroll at De La Salle Academy in New York. Upon completion of his degree, he was offered a commission to Annapolis but turned it down in favor of a higher calling. Mundelein’s dedication to study and commitment to the Church attracted the attention of prominent members of the Brooklyn clergy like Bishop McDonnell. With his support, Mundelein earned a chance to study at St. Vincent’s Archabbey outside of Beatty, Pennsylvania. By 1892, he was enrolled at the Urban College of Propaganda in Rome, Italy. After the requisite three years at the North American College, Mundelein was still one year younger than the canonical age for ordination. Bishop McDonnell again intervened and secured a dispensation for Mundelein’s early ordination to the priesthood. The dispensation was only granted because Mundelein had already proved his dedication to the Church through diligent study and active involvement in the college. -

Spicilegium Historicum
SPICILEGIUM HISTORICUM Congregationis SSmi Redemptoris San Clemente M. Hofbauer Patrono di Vienna, 1914-2014 Annus LXII 2014 Fasc. 1 Collegium S. Alfonsi de Urbe La Rivista SPICILEGIUM HISTORICUM Congregationis SSmi Redemptoris è una pubblicazione dell’Istituto Storico della Congregazione del Santissimo Redentore DIRETTORE Adam Owczarski SEGRETARIO DI REDAZIONE Emilio Lage CONSIGLIO DI REDAZIONE Alfonso V. Amarante, Álvaro Córdoba Chaves, Emilio Lage, Adam Owczarski DIRETTORE RESPONSABILE Alfonso V. Amarante SEDE Via Merulana, 31, C.P. 2458 I-00185 ROMA Tel [39] 06 494901, Fax [39] 06 49490243 e-mail: [email protected] ; [email protected] Con approvazione ecclesiastica Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 310 del 14 giugno 1985 Ogni collaboratore si assume la responsabilità di ciò che scrive. SIGLE E ABBREVIAZIONI AGHR Archivum Generale Historicum Redemptoristarum, Roma APNR Archivio della Provincia Napoletana CSSR, Pagani (SA) ASV Archivio Segreto Vaticano BAV Bibliotheca Apostolica Vaticana Bibl. Hist. Bibliotheca Historica CSSR, edita dall'Istituto Storico CSSR, Roma 1955 ss. Acta integra = Acta integra capitulorum generalium CSSR ab anno 1749 usque ad annum 1894 celebratorum, Romae 1899 Analecta = «Analecta CSSR», 1 (Roma 1922) – BOLAND = Samuel J. BOLAND , A Dictionary of the Redemptorists , Roma 1987 CARTEGGIO = S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI , Carteggio , I, a cura di G. Orlandi, Roma 2004 Codex regularum = Codex regularum et constitutionum CSSR... , Romae 1896 DE MEULEMEESTER , Bibliographie = Maurice DE MEULEMEESTER , Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes , 3 voll., Louvain 1933-1939 DE MEULEMEESTER , Histoire = Maurice DE MEULEMEESTER , Histoire sommaire de la Con- grégation du Très-Saint Rédempteur , Louvain 1958 DE MEULEMEESTER , Origines = Maurice DE MEULEMEESTER , Origines de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur.