Naturheilbewegung, Vegetarismus, Lebensreform
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
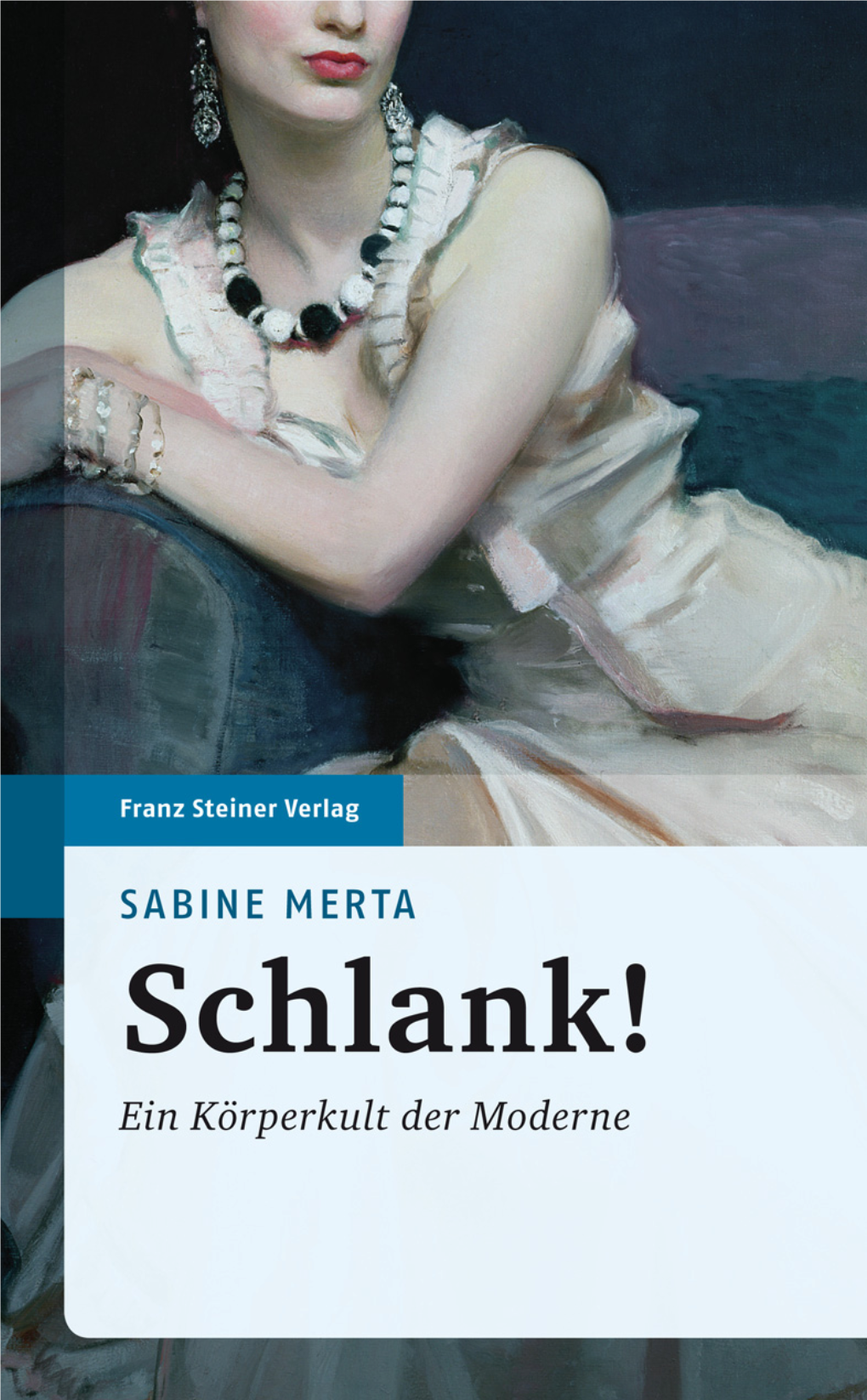
Load more
Recommended publications
-

Print This Article
Cómo referenciar este artículo / How to reference this article Németh, A., & Pukánszky, B. (2020). Life reform, educational reform and reform pedagogy from the turn of the century up until 1945 in Hungary. Espacio, Tiempo y Educación, 7(2), pp. 157-176. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.284 Life reform, educational reform and reform pedagogy from the turn of the century up until 1945 in Hungary András Németh email: [email protected] Eötvös Loránd University. Hungary / János Selye University Komárno. Slovakia Béla Pukánszky email: [email protected] University Szeged. Hungary / János Selye University Komárno. Slovakia Abstract: Since the end of the 19th century, the modernisation processes of urbanisation and industrialisation taking place in Europe and the transatlantic regions have changed not only the natural environment but also social and geographical relations. The emergence of modern states changed the traditional societies, lifestyles and private lives of individuals and social groups. It is also characteristic of this period that social reform movements appeared in large numbers – as a «counterweight» to unprecedented, rapid and profound changes. Some of these movements sought to achieve the necessary changes with the help of individual self-reform. Life reform in the narrower sense refers to this type of reform movement. New historical pedagogical research shows that in the major school concepts of reform pedagogy a relatively close connection with life reform is discernible. Reform pedagogy is linked to life reform – and vice versa. Numerous sociotopes of life reform had their own schools, because how better to contribute than through education to the ideal reproduction and continuity of one’s own group. -

KATALOG 12 Versandantiquariat Hans-Jürgen Lange Lerchenkamp
KATALOG 12 Versandantiquariat Hans-Jürgen Lange Lerchenkamp 7a D-29323 Wietze Tel.: 05146-986038 Email: [email protected] Bestellungen werden streng nach Eingang bearbeitet. Versandkosten (u. AGB) siehe letzte Katalogseite. Alchemie u. Alte Rosenkreuzer 1-45 Astrologie 46-77 Freimaurer, Templer u.a. Geheimbünde 78-104 Grenzwissenschaften 105-163 Heilkunde u. Ernährung 164-190 Hypnose, Suggestion u. Magnetismus 191-214 Lebensreform, völkische Bewegungen u. Ariosophie 215-301 Okkultismus u. Magie 302-363 Spiritismus u. Parapsychologie 364-414 Theosophie u. Anthroposophie 415-455 Utopie u. Phantastik 456-507 Volkskunde, Aberglaube u. Zauberei 508-530 Varia 531-666 Weitere Angebote - sowie PDF-Download dieses Katalogs (mit Farbabbildungen) - unter www.antiquariatlange.de . Wir sind stets am Ankauf antiquarischer Bücher aller Gebiete der Grenz- und Geheimwissenschaften interessiert! Gedruckt in 440 Exemplaren. Ein Teil der Auflage wurde mit einem Umschlag Liebe Kunden, die Bücher in unseren Katalogen sind Exklusivangebote . Das heisst, sie werden zunächst nur hier im Katalog angeboten! Erst etwa ein/zwei Monate nach Erscheinen des Katalogs, stellen wir die unverkauften Bücher auch online (Homepage, ZVAB & Co.). 2 – www.antiquariatlange.de Alchemie und Alte Rosenkreuzer 1. [Sod riqqavon we-serefa] i.e. Das Geheimnuß der Verwesung und Verbrennung aller Dinge, nach seinen Wundern im Reich der Natur und Gnade, Macro Et Microcosmice, als die Schlüssel: Dadurch der Weeg zur Verbesserung eröffnet, das verborgene der Creaturen entdecket, und die Verklärung des sterblichen Leibes gründlich erkant wird [...]. Dritte und mit vielen curiösen Obersvationibus vermehrte Auflage. (3. verm. Aufl.) Franckfurt am Mayn, In der Fleischerischen Buchhandlung, 1759. 109 S., Kl.-8°, Pappband d. Zt. 1000,00 € Caillet 6743; Ferguson I,306 u. -

WNF Bílá Kniha: Naturopatické Filosofie, Principy a Teorie
WNF Bílá kniha: Naturopatické filosofie, principy a teorie Poděkování Světová naturopatická federace (WNF) velmi oceňuje spolupráci následujících naturopatických vzdělávacích institucí při poskytování požadovaných údajů pro Bílou knihu WNF: Naturopatické filosofie, principy a teorie; Bastyr University, USA; Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM), Kanada; Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique (CENATHO), Francie; Centro Andaluz de Naturopatía (CEAN), Španělsko; Naturopatska Sola (SAEKA), Slovinsko; Wellpark College of Natural Therapies, Nový Zéland. Rádi bychom také poděkovali jednotlivcům a organizacím, které se podílely na dvou předchozích průzkumech, které poskytly základy pro tento projekt. Tyto organizace jsou uvedeny ve dvou zprávách o průzkumu, které lze nalézt na adrese http://worldnaturopathicfederation.org/wnf-publications/. Tuto iniciativu vedl výbor WNF Naturopathic Roots (Naturopatické kořeny), který zahrnoval členy Heilpraktiker, naturopaty a naturopatické lékaře (ND): Tina Hausser, Heilpraktiker, naturopat (Španělsko) Dr. Iva Lloyd, naturopatický lékař (ND) (Kanada) Dr. JoAnn Yánez, ND, MPH, CAE (USA) Phillip Cottingham, naturopat (Nový Zéland) Roger Newman Turner, naturopat (Velká Británie) Alfredo Abascal, naturopat (Uruguay) Všechna práva vyhrazena. Publikace Světové naturopatické federace jsou k dispozici na internetových stránkách www.worldnaturopathicfederation.org. Žádosti o povolení reprodukovat nebo překládat publikace WNF - ať již pro prodej nebo pro nekomerční distribuci musí být -

Zum 100. Todestag Von Heinrich Lahmann 1860 Bis 1905
Medizingeschichte Zum 100. Todestag von Heinrich Lahmann 1860 bis 1905 Am 1. Juni 2005 gedachte der Verschönerungs- des Ersten Weltkrieges die Besucherzahlen bis 1972), aber auch Ingeborg Elisabeth verein Weißer Hirsch mit der Enthüllung eingebrochen waren – wieder mehr als Gräfin von Plauen und Emmerich Graf von eines Lahmann-Porträtreliefs an der Pergola 80.000 (Prospekt Weißer Hirsch 1928). Thun und Hohenstein. Stechgrundstraße und einem Konzert mit Zudem kurten in weiteren bekannten natur- Der Weiße Hirsch war ein wirtschaftlich Musik von Rainer Promnitz sowie mit Aus- heilkundlich arbeitenden Einrichtungen des blühender Kurort, der ausschließlich vom schnitten aus einem Film von Ernst Hirsch Kurbezirkes Weißer Hirsch jährlich noch Kurtourismus lebte. Erste Bestrebungen, den des Todestages von Heinrich Lahmann vor Tausende von Gästen: im exklusiven „Dr. kleinen Dresdner Vorort Weißer Hirsch zum einhundert Jahren. Dabei wurde auch folgen- Weidners Sanatorium“, im für seine Diät- und Kurort und zur Sommerfrische zu entwickeln, des Gedicht zitiert: Fastenkuren berühmten Sanatorium von datierten bereits aus den 1870er Jahren. Aber „Wieviele tausende von Menschen haben Siegfried Möller (1871 bis 1943), im psycho- erst mit der Eröffnung von Lahmanns Sanato- dort Erholung schon gefunden? therapeutisch orientierten Sanatorium von rium begann 1888 sein großer Aufschwung. Wieviele tausende wohl konnten nur im Heinrich Teuscher (1862 bis 1946) oder im Weißen Hirsch gesunden? vornehm-familiär geführten Sanatorium von Der Begründer des Weltruhms – Auch ich gehörte einst zu dem Max Steinkühler (1875 bis 1934). Viele Erho- ein eigenwilliger Naturarzt Patienten-Publikum lungssuchende reisten in den weltberühmten Heinrich Lahmann (1860 bis 1905), Sohn aus Und ward gesund in Dr. Lahmanns Kurort und wohnten im luxuriösen Parkhotel einer angesehenen Bremer Kaufmannsfamilie, Sanatorium, oder in einer der zahlreichen Pensionen. -

The Best Well-Being Programmes in Slovenia
Terme Lendava Terme Zdravilišče Radenci Zdravilišče THE BEST WELL-BEING PROGRAMMES IN SLOVENIA Toplice 3000 - Moravske Terme Refreshing, relaxing, reenergising, Ptuj Terme rejuvenating with a local feel Sava Hoteli Bled Hoteli Sava Sava Hoteli Bled Enchanted by images of paradise. VISIT BREATHTAKING BLED Embraced by the mountain peaks of the Julian Alps, there is a lake, which glitters like a tear, with an island, which never fails to mesmerise. Breathe in deeply: let the fresh mountain air invigorate you. Listen to the tolling of a sunken bell at the bottom of the lake. Bled is the perfect place for both eternal romantics and enthusiastic sportsmen. Besides the mandatory walk around the lake and enjoying the original Bled Crème Cake there is so much else to do here… SAVA HOTELI BLED • Hotels with breath-taking views. • An idyllic resort with thermal springs and more than a hundred years of Ar- nold Rikli’s health resort tradition. • Give us three days and we’ll fill your pho- to album with unforgettable memories. • A clever combination of original Alpine gastronomy and contemporary culinary trends. • More than 60 years of the “Original Bled Crème Cake” – 60 years and more than 12 million sweet sighs. • Where we take care of the best in you under the patronage of Živa, the Old Slavic goddess of love. • In Bled we practise natural, sustainable tourism, enable green mobility, serve lo- cal food, and strive for energy efficiency. • Sava Hotels & Resorts – the proud guardian of Bled swans. THE HEALING POWER OF BLED People have always believed that the Slovenian town of Bled and the enchanting nature around it have special healing powers. -

Steward the Culture of Water Cure in Nineteenthcentury Austria
Northumbria Research Link Citation: Steward, Jill (2002) The culture of water cure in nineteenth-century Austria, 1800-1914. In: Water, Leisure and Culture: European Historical Perspectives. Leisure, Consumption and Culture . Berg, Oxford, pp. 23-36. ISBN 9781859735404 Published by: Berg URL: http://www.bloomsbury.com/uk/water-leisure-and-cul... <http://www.bloomsbury.com/uk/water-leisure-and-culture-9781859735404/> This version was downloaded from Northumbria Research Link: http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/582/ Northumbria University has developed Northumbria Research Link (NRL) to enable users to access the University’s research output. Copyright © and moral rights for items on NRL are retained by the individual author(s) and/or other copyright owners. Single copies of full items can be reproduced, displayed or performed, and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided the authors, title and full bibliographic details are given, as well as a hyperlink and/or URL to the original metadata page. The content must not be changed in any way. Full items must not be sold commercially in any format or medium without formal permission of the copyright holder. The full policy is available online: http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html This document may differ from the final, published version of the research and has been made available online in accordance with publisher policies. To read and/or cite from the published version of the research, please visit the publisher’s website (a subscription may be required.) Northumbria Research Link Steward, J. -
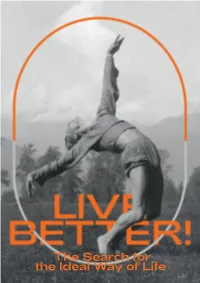
The Search for the Ideal Way of Life
The Search for the Ideal Way of Life 1 Published to accompany the exhibition “Live better! The Search for the Ideal Way of Life” in the Bernisches Historisches Museum (13.2.2020-5.7.2020) Exhibition partners: Edition eigenART, Verlag X-Time, Bern, 2020 www.edition-eigenart.ch ISBN 3-909990-35-5 English translation: Julia Slater Graphic Design: Luca Hostettler 5 Foreword Damir Skenderovic/Jakob Messerli 9 Echoes of the Lebensreform movement in the present day Eva Locher 13 Ways out of the crisis: Reforming life to reform the self Andreas Schwab 17 The Swiss Lebensreform movement: Instructions for a “better life” Stefan Rindlisbacher 30 Authors 31 For further reading Foreword “Live better!” was the rallying cry and precept of the “Lebensre- form” (Life Reform) movement, in Switzerland as in other Euro- pean countries. It challenged people unequivocally to change their ways, and was a declaration of discontent with the pre- vailing state of affairs and a warning of dangers to come. In the late 19th century it was the way in which advocates of Leb- ensreform expressed their unease at increasing industrialisa- tion, mechanisation and urbanisation, and their malaise at the accelerated pace of daily life and the globalisation of the world. Later these concerns expanded to include unhappiness at the growth-driven consumer society, and anxiety about environ- mental pollution and climate change. What did not change was the sense of crisis, which for some led to predictions of disas- ter and a feeling that the end of the world was nigh, but which mainly encouraged people to search for the ideal life, and an improvement in their own lifestyles. -

To the Followers of Naturopathy the Wonderful Human Machi
Index Publishers' Note Mahamrityunjaya Mantra What Is Life? What Is Disease? To the Followers of Naturopathy The Wonderful Human Machine The Human Body The Origin of Disease Health and Nature Cure Health and Law Of Nature Health and Conservation of Energy Health and Clothing The Secret of Living Health and Disease Vital Facts About Health Way to Radiant Health How to Keep Fit and Healthy Health and Psychology What Is Nature Cure'? Philosophy of Nature Cure Naturopathy and Spiritual Life Story of Nature Cure Fundamental Principles of Nature Cure Nature Cure Methods AIR FOR HEALTH AND CURE History of Water-cure How Water Serves As a Medical Agent Water Remedies Efficacy of Baths Cold Sponging Tepid Sponging Cold Rub Mud Cure SUN CURE How to Cure Diseases by Colour Power Influence of Colour on Health To the Celibates Aids to Brahmacharya Yogic Recipes for Brahmacharya Violation of Brahmacharya Self-restraint and Planned Parenthood EXERCISE MASSAGE CHIROPRACTIC SLEEP CARE OF TEETH Nature's Tonics Upanishads on Food Purpose of Food Constituents of Food Digestion Dietetic Treatment Diet and Health Protective Foods Cereals Proteins Pulses Germination of Pulses Vegetables Vegetable Salads Starches Mineral Salts Milk Fruits Fruit Salad Nuts Honey Dietetic Don'ts Different Qualities of Food Articles Incompatible Foods Dietetic Values of Fruits Rejuvenation Through Milk Treatment Fast and Its Importance Fasting and Its Benefits Fast Cure Methodical Breaking of Fasts Barley Bitter Gourd Bottle Gourd Buttermilk Kandang Kathri (kalyant) Mint Papaya -

Naturheilbewegung, Vegetarismus, Lebensreform
19 Das magisch anziehende Dreieck: Naturheilbewegung, Vegetarismus, Lebensreform Was verstand man im 19. Jahrhundert unter »Naturheilung«? Unter »Naturheilung« verstand man eine holistisch-vitalistische Gesundheitslehre von der Überwindung aller Krankheiten durch die dem Menschen innewohnende »Lebenskraft«. Die Naturheiler wollten die im Verwissenschaftlichungsprozess des 19. Jahrhunderts beiseite gedrängte humoralpathologische Harmonielehre und Di- ätetik mit ihren Naturheilverfahren als Gesamtlebensphilosophie wieder aufwerten. Lediglich Pflanzen, Pflanzenteile und Pflanzen- produkte in roher, frischer oder getrockneter Form oder natürliche Mineralien waren als Heilmittel bei den Anwendungen erlaubt. Ihre von der Antike übernommene, ganzheitliche Krankheitsvorstellung umfasste die Therapie des Leibes und der Seele. Deshalb fanden sich in zahlreichen naturheilkundlichen Gesundheitsführern auch Diät- vorschläge für ein besseres seelisches Wohlbefinden.1 Gesundheit wurde als Harmoniezustand von Körper, Geist und Seele aufgefasst, während Krankheit Disharmonie als Ergebnis einer »unnatürlichen« Lebensweise bedeutete. Eine naturgemäße Ernährungsweise bildete dabei den Kern- aspekt. Darunter wurde meist eine vegetarische Diät aus Obst, Knol- 20 Entwicklungsstränge der modernen Diätkost len-, Wurzel-, Blattgemüse, Samen, Nüssen und frischem Wasser verstanden. Eine Vielzahl an Krankheiten wurde auf eine fehlerhafte Ernährung zurückgeführt. So esse der Mensch zum Beispiel drei- mal so viel Fleisch, wie er eigentlich benötige.2 Zudem mache eine -
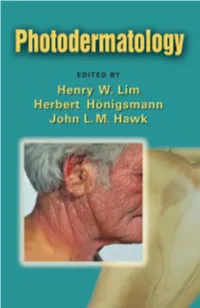
Photodermatology
Photodermatology DK7496_C000a.indd 1 12/14/06 1:27:45 PM BASIC AND CLINICAL DERMATOLOGY Series Editors ALAN R. SHALITA, M.D. Distinguished Teaching Professor and Chairman Department of Dermatology SUNY Downstate Medical Center Brooklyn, New York DAVID A. NORRIS, M.D. Director of Research Professor of Dermatology The University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado 1. Cutaneous Investigation in Health and Disease: Noninvasive Methods and Instrumentation, edited by Jean-Luc Lévêque 2. Irritant Contact Dermatitis, edited by Edward M. Jackson and Ronald Goldner 3. Fundamentals of Dermatology: A Study Guide, Franklin S. Glickman and Alan R. Shalita 4. Aging Skin: Properties and Functional Changes, edited by Jean-Luc Lévêque and Pierre G. Agache 5. Retinoids: Progress in Research and Clinical Applications, edited by Maria A. Livrea and Lester Packer 6. Clinical Photomedicine, edited by Henry W. Lim and Nicholas A. Soter 7. Cutaneous Antifungal Agents: Selected Compounds in Clinical Practice and Development, edited by John W. Rippon and Robert A. Fromtling 8. Oxidative Stress in Dermatology, edited by Jürgen Fuchs and Lester Packer 9. Connective Tissue Diseases of the Skin, edited by Charles M. Lapière and Thomas Krieg 10. Epidermal Growth Factors and Cytokines, edited by Thomas A. Luger and Thomas Schwarz 11. Skin Changes and Diseases in Pregnancy, edited by Marwali Harahap and Robert C. Wallach 12. Fungal Disease: Biology, Immunology, and Diagnosis, edited by Paul H. Jacobs and Lexie Nall 13. Immunomodulatory and Cytotoxic Agents in Dermatology, edited by Charles J. McDonald 14. Cutaneous Infection and Therapy, edited by Raza Aly, Karl R. Beutner, and Howard I. -

Review Article the History of Inpatient Care in German Departments Focussing on Natural Healing
Hindawi Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 521879, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/521879 Review Article The History of Inpatient Care in German Departments Focussing on Natural Healing André-Michael Beer,1 Bernhard Uehleke,2 and Karl Rüdiger Wiebelitz3 1 Department of Naturopathy, Blankenstein Hospital, Im Vogelsang 5-11, 45527 Hattingen, Germany 2 HfG Hochschule fur¨ Gesundheit und Sport, Germany Hochschule fur¨ Gesundheit und Sport, Vulkanstr. 1, 10367 Berlin, Germany 3 Clinic for Children and Adolescents, Prignitz Hospital, Dobberzinerstrasse 112, 19348 Perleberg, Germany Correspondence should be addressed to Andre-Michael´ Beer; [email protected] Received 28 August 2012; Revised 15 January 2013; Accepted 14 February 2013 Academic Editor: Thomas Ostermann Copyright © 2013 Andre-Michael´ Beer et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. We describe historic developments of inhouse facilities for natural healing in this paper, which were mainly located in German speaking regions. The naturopathic movement is a relabeling of the hydropathic movement in Germany, which was supported by a considerable proportion of the population in Germany during the mid 19th century. Due to the fact that hydropathic treatments were provided by nonmedical healers, discriminated as “quacks”, there was continuous hostility between hydropathy/naturopathy and medicine. However, among the many establishments providing inhouse treatment for acute and chronic diseases over weeks there were some which were controlled by medical doctors in the 20th century and some which were implemented by government. -

Everybody's Guide to Nature Cure- Harry Benjamin
Soil and Health Library This document is a reproduction of the book or other copyrighted material you requested. It was prepared on Monday, 29 March 2010 for the exclusive use of kamlesh, whose email address is [email protected] This reproduction was made by the Soil and Health Library only for the purpose of research and study. Any further distribution or reproduction of this copy in any form whatsoever constitutes a violation of copyrights. EVERYBODY'S GUIDE TO NATURE CURE By HARRY BENJAMIN, N.D. Author of Better Sight Without Glasses Your Diet—in Health and Disease Adventure in Living—Autobiography of a Myope Commonsense Vegetarianism Unorthodox Healing versus Medical Science Basic Self-Knowledge How to Become 100% Healthy HEALTH FOR ALL PUBLISHING CO. GATEWAY HOUSE, BEDFORD PARK, CROYDON CR9 2AT, SURREY FIRST IMPRESSION (2,000) 1936 SECOND IMPRESSION (2,000) 1936 THIRD IMPRESSION (5,000) 1937 FOURTH IMPRESSION (4,000) 1941 FIFTH IMPRESSION (4,000) 1943 SIXTH IMPRESSION (4,000) 1944 SEVENTH IMPRESSION (4,000) 1945 EIGHTH IMPRESSION (4,000) 1946 NINTH IMPRESSION (4,000) 1947 TENTH IMPRESSION (5,000) 1949 ELEVENTH IMPRESSION (5,000) 1952 TWELFTH IMPRESSION (5,000) 1955 THIRTEENTH IMPRESSION (5,000) 1958 FOURTEENTH IMPRESSION (5,000) 1961 FIFTEENTH IMPRESSION (5,000) 1964 SIXTEENTH IMPRESSION (5,000) 1967 DEDICATED TO STANLEY LIEF, N.D., D.O., D.C. FOUNDER OF " HEALTH FOR ALL " who did more to forward the work of Nature Cure in Great Britain than any other man. Made and Printed in Great Britain by The Lewes Press Wightman & Co, Ltd., Lewes, Sussex C O N T E N T S PART I—NATURE CURE IN THEORY AND OUTLINE INTRODUCTION ix I.