"Ei, Dem Alten Herrn Zoll' Ich Achtung Gern'"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Chronicle of the Reform: Catholic Music in the 20Th Century by Msgr
A Chronicle of the Reform: Catholic Music in the 20th Century By Msgr. Richard J. Schuler Citation: Cum Angelis Canere: Essays on Sacred Music and Pastoral Liturgy in Honour of Richard J. Schuler. Robert A. Skeris, ed., St. Paul MN: Catholic Church Music Associates, 1990, Appendix—6, pp. 349-419. Originally published in Sacred Music in seven parts. This study on the history of church music in the United States during the 20th century is an attempt to recount the events that led up to the present state of the art in our times. It covers the span from the motu proprio Tra le solicitudini, of Saint Pius X, through the encyclical Musicae sacra disciplina of Pope Pius XII and the Constitution on the Sacred Liturgy of the Second Vatican Council and the documents that followed upon it. In knowing the course of development, musicians today may build on the accomplishments of the past and so fulfill the directives of the Church. Cum Angelis Canere, Appendix 6 Part 1: Tra le sollicitudini The motu proprio, Tra le sollicitudini, issued by Pope Pius X, November 22, 1903, shortly after he ascended the papal throne, marks the official beginning of the reform of the liturgy that has been so much a part of the life of the Church in this century. The liturgical reform began as a reform of church music. The motu proprio was a major document issued for the universal Church. Prior to that time there had been some regulations promulgated by the Holy Father for his Diocese of Rome, and these instructions were imitated in other dioceses by the local bishops. -

Heinrich Von Herzogenberg's "Zwei Biblische Scenen": a Conductor's Study
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1999 Heinrich Von Herzogenberg's "Zwei Biblische Scenen": a Conductor's Study. John Elbert Boozer Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Boozer, John Elbert, "Heinrich Von Herzogenberg's "Zwei Biblische Scenen": a Conductor's Study." (1999). LSU Historical Dissertations and Theses. 7036. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/7036 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor qualify illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. -
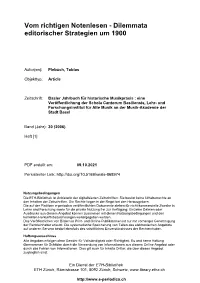
Dilemmata Editorischer Strategien Um 1900
Vom richtigen Notenlesen - Dilemmata editorischer Strategien um 1900 Autor(en): Plebuch, Tobias Objekttyp: Article Zeitschrift: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis : eine Veröffentlichung der Schola Cantorum Basiliensis, Lehr- und Forschungsinstitut für Alte Musik an der Musik-Akademie der Stadt Basel Band (Jahr): 30 (2006) Heft [1] PDF erstellt am: 09.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-868974 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 201 VOM RICHTIGEN NOTENLESEN - DILEMMATA EDITORISCHER STRATEGIEN UM 19001 von Tobias Plebuch Es erhub sich ein Streit auf der Mitgliederversammlung der Neuen Bachgesellschaft im elften Jahre ihres Bestehens, und noch heute lesen sich die Versammlungsprotokolle, als könnte man sich am Papier die Finger aufkratzen. -
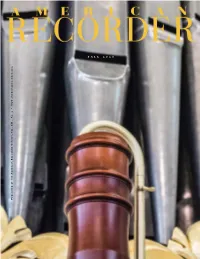
Fall 2020 AR
Published by the American Recorder Society, Vol. LXI , No. 3 • www.americanrecorder.org fall 2020 fall Editor’s ______Note ______ ______ ______ ______ Volume LXI, Number 3 Fall 2020 Features y 1966 copy of On Playing the Flute Giving Voice to Music: by J.J. Quantz is dog-eared and has a The Art of Articulation . 9-22, 26-33 numberM of sticky tabs hanging out, showing By Beverly R. Lomer and my years of referring to its ideas; the binding María Esther Jiménez Capriles is releasing the pages consulted most often. After reading the articles in this issue, you Articulating Arcadelt’s Swan . 23 may discover why and find your own copy. By Wendy Powers This isn’t a typical AR issue. With few Departments events taking place, and thus not much news Advertiser Index and Classified Ads. 48 in Tidings, it gives us the opportunity to run an entire large article on articulation in one Education . 38 issue, plus a shorter one on madrigals—with Michael Lynn decodes what you should play the authors outlining historical guidelines when you see those small signs in the music (like Quantz) and living sources, then pro- viding music demonstrating ways you can President’s Message . 3 apply articulation on your own (page 9). ARS President David Podeschi recaps the past few Quantz also makes a brief appearance months, and looks ahead, thanking those who have in the first of a series of Education pieces been guiding the ARS’s efforts on ornamentation. In this issue (page 38), Michael Lynn covers the appoggiatura Reviews and trill, with the promise of more infor- Recording . -

Stylistic Features of the Compositions of the Modern American Composer Peter Williams, Particularly As Found in His Missa Brevis
Stylistic Features of the Compositions of the Modern American Composer Peter Williams, Particularly as Found in His Missa Brevis Item Type text; Electronic Dissertation Authors Wachsman, Todd Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction, presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 01:57:30 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/645789 STYLISTIC FEATURES OF THE COMPOSITIONS OF THE MODERN AMERICAN COMPOSER PETER WILLIAMS, PARTICULARLY AS FOUND IN HIS MISSA BREVIS by Todd Wachsman ________________________________________ Copyright © Todd Wachsman 2020 A Document Submitted to the Faculty of the FRED FOX SCHOOL OF MUSIC In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2020 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Doctor of Musical Arts Document Committee, we certify that we have read the document prepared by: Todd Wachsman titled: Stylistic Features of the Compositions of the Modern American Composer Peter Williams, Particularly as Found in His Missa Brevis, and recommend that it be accepted as fulfilling the document requirement for the Degree of Doctor of Musical Arts. Bruce Chamberlain _________________________________________________________________ Date: ____________Aug 19, 2020 Bruce Chamberlain _________________________________________________________________ Date: ____________Jul 29, 2020 John T. Brobeck _________________________________________________________________ Date: ____________Aug 19, 2020 Matthew Mugmon Final approval and acceptance of this document is contingent upon the candidate’s submission of the final copies of the document to the Graduate College. -

Pitoni Paper for Publication
Edinburgh Research Explorer Karl Proske’s Musica Divina and the popularity of Giuseppe Ottavio Pitoni’s Cantate Domino and Laudate Dominum Citation for published version: O'Regan, N 2009, Karl Proske’s Musica Divina and the popularity of Giuseppe Ottavio Pitoni’s Cantate Domino and Laudate Dominum. in Giuseppe Ottavio Pitoni e la Musica del suo Tempo. Atti del Convegno di studi su Pitoni, Rieti 28-29 April 2008. Istituto Italiana per la Storia della Musica, Rome, pp. 61-70. Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Giuseppe Ottavio Pitoni e la Musica del suo Tempo. Atti del Convegno di studi su Pitoni, Rieti 28-29 April 2008 Publisher Rights Statement: ©Karl Proske’s Musica Divina and the popularity of Giuseppe Ottavio Pitoni’s Cantate Domino and Laudate Dominum. / O'Regan, Noel. Giuseppe Ottavio Pitoni e la Musica del suo Tempo. Atti del Convegno di studi su Pitoni, Rieti 28-29 April 2008. Rome : Istituto Italiana per la Storia della Musica, 2009. p. 61-70. General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. -

Sacred Music Volume 113 Number 4
Volume 113, Number 4 SACRED MUSIC (Winter) 1986 Giotto The Nativity SACRED MUSIC Volume 113, Number 4, Winter 1986 FROM THE EDITORS The Missa Romana cantata 3 Latin in the Seminaries 5 FLOR PEETERS: ORGANIST, COMPOSER, TEACHER 6 ELIPHANTIASIS OF THE WORD Deryck Hanshell, S.J. 7 ECHO, PERIODICAL OF THE AMERICAN CECILIAN SOCIETY /. Vincent Higginson 11 LITURGICAL FORMATION FOR CHOIR MEMBERS Gabriel Steinschulte 17 REVIEWS 22 NEWS 27 CONTRIBUTORS 29 EDITORIAL NOTES 29 INDEX OF VOLUME 113 30 SACRED MUSIC Continuation of Caecilia, published by the Society of St. Caecilia since 1874, and The Catholic Choirmaster, published by the Society of St. Gregory of America since 1915. Published quarterly by the Church Music Association of America. Office of publications: 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103. Editorial Board: Rev. Msgr. Richard J. Schuler, Editor Rev. Ralph S. March, S.O. Cist. Rev. John Buchanan Harold Hughesdon William P. Mahrt Virginia A. Schubert Cal Stepan Rev. Richard M. Hogan Mary Ellen Strapp Judy Labon News: Rev. Msgr. Richard J. Schuler 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103 Music for Review: Paul Salamunovich, 10828 Valley Spring Lane, N. Hollywood, Calif. 91602 Rev. Ralph S. March, S.O. Cist., Eintrachstrasse 166, D-5000 Koln 1, West Germany Paul Manz, 1700 E. 56th St., Chicago, Illinois 60637 Membership, Circulation and Advertising: 548 Lafond Avenue, Saint Paul, Minnesota 55103 CHURCH MUSIC ASSOCIATION OF AMERICA Officers and Board of Directors President Monsignor Richard J. Schuler Vice-President Gerhard Track General Secretary Virginia A. Schubert Treasurer Earl D. Hogan Directors Rev. Ralph S. March, S.O. -

Musikalische Schätze in Regensburger Bibliotheken
RSM 13 Im vorliegenden Buch werden musikalische Quellen aus den Beständen der Bischöflichen Zentralbibliothek, der Staatlichen Bibliothek und der Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek vorgestellt. Sie stehen gewissermaßen stellvertretend für die Bandbreite der vorhandenen Quellentypen sowie deren Provenienz, Überlieferungszustand und -kontext: Es werden sowohl Prachtcodices als auch Gebrauchshandschriften behandelt, fragmentarisch überlieferte oder zu Konvoluten zusammengebundene Musikalien, Quellen für die Musikpraxis und musiktheoretische Abhandlungen sowie Musik für den klösterlichen Gebrauch oder für einen städtischen Kontext – und dies vom Mittelalter bis zum 18. Jahr- hundert. In der Verbindung von lokalhistorischen Spezifika und überregionalen 3 – ja, sogar internationalen – Perspektiven wird die Bedeutung der Regensburger 1 Bestände umso exponierter. usikalische Schätze in Regensburger Bibliotheken in Regensburger Schätze usikalische M · Musikalische Schätze in Regensburger Bibliotheken Regensburger Studien zur Musikgeschichte zur Studien Regensburger Katelijne Schiltz Katelijne Herausgegeben von Katelijne Schiltz CB 1282 ConBrio ISBN 978-3-940768-82-7 ConBrio Musikalische Schätze in Regensburger Bibliotheken REGENSBURGER STUDIEN ZUR MUSIKGESCHICHTE HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG HORN, DAVID HILEY UND KATELIJNE SCHILTZ BAND 13 Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Universität Regensburg Umschlagbild: Einband von Regensburg, Staatliche Bibliothek, Hist.pol. 1376. Pergamentfragment aus einem Antiphonar des 15. Jahrhunderts; Wappen -

Some Overlooked Manuscript Music in the Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg
Richard Charteris Some Overlooked Manuscript Music in the Bischöfiche Zentralbibliothek Regensburg One of the great bibliographical achievements of the last fve decades is the series Kataloge Bayerischer Musiksammlungen, which comprises nearly ffy volumes to date and contains vital information about the holdings of many of Bavaria’s music collections, focusing largely on manuscript music. About ffy diferent libraries are covered in the series, and whereas large collections occupy multiple volumes, small ones ofen share space with others in a single volume. Historically, the collections were established variously by royal and noble households, by religious institutions such as churches, monasteries and schools, and by public institutions and private collectors. Published in Mu- nich by G. Henle and edited by the Bayerische Staatsbibliothek München, the series was launched in 1971 with Robert Münster and Robert Machold, Die Musikhandschrifen der ehemaligen Klosterkirchen Weyarn, Tegernsee, Benediktbeuern (Munich, 1971), and its most recent publication is Raymond Dittrich, Die Liturgika der Proskeschen Musikabteilung. Drucke und Hand- schrifen der Signaturengruppe Ch (Munich, 2010), vol. 15 of the fourteenth set, devoted to materials in the Bischöfiche Zentralbibliothek Regensburg. It is to the latter library that I1 shall now turn in order to disclose details about some overlooked manuscript music that I have uncovered. Te neglected materials date from the sixteenth and seventeenth centuries and add to our knowledge of one of Bavaria’s most important libraries. Te largest component of music editions and manuscripts in the Bischöf- liche Zentralbibliothek Regensburg was previously owned and collected by the well-known musicologist, physician and priest, Carl Joseph Proske (1794 – 1861). -

EMH-Merged 305..329
Reviews OWEN REES, TheRequiemofTomásLuisdeVictoria. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2019. xiv 262 pp. ISBN 9781107294301. doi:10.1017/S0261127920000054 As anni mirabiles go, 1605 was an exceptional one for the printing of masterpieces in Madrid. Mid-winter saw the minting of Miguel de Cervantes’s El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha at Juan de la Cuesta’s print shop and late summer witnessed the emergence of Tomás Luis de Victoria’s Officium defunctorum from the Royal Press. But if Cervantes’s knight errant and his illiterate sidekick immediately entered the popular imagination, thereby initiating an uninterrupted and insistent demand for reprints (not to mention mov- ies, musicals and merchandise) that is still being met, Victoria’s Requiem was born comatose. The composer’s ‘Krone aller Werke unsers Meisters’, to borrow the epithet coined (in 1853) by the Cecilian movement’s Karl Proske (1794–1861), would have to wait until the second half of the nineteenth century for its awakening and even- tual elevation to the chef d’oeuvre status that it now enjoys. In his wide- ranging and masterful study, Owen Rees examines Victoria’sRequiem as both text and icon. He does so with a scholar’s nose for forensic minutiae,ananalyst’s eye for the telling detail, and a choral director’s ear for precision and rigour. His study is a model of its kind. Sandwiched between an Introduction and an Epilogue – entitled respectively, and interrogatively, ‘“Requiem for an Age”?’ and ‘Requiem for Our Age?’–stand five chapters that systematically consider Victoria’s rôle as chaplain of the Empress María, the wider contexts of the exequies celebrated in the wake of her demise, the printing of the Officium defunctorum two years after her death, a close analysis of the Requiem’s compositional devices and strategies, and a commentary on the work’s reception since its nineteenth-century revival. -
Choral and Church Music
BOUGHT WITH THE INCOME OF THE SAGE ENDOWMENT FUND THE GIFT OF Mcnrg m. Sage 1891 9306 MUSIC Cornell University Library ML 100.M39 V 6 The art of music :a comDrehensjv^^^ 3 1924 022 385 318 Cornell University Library The original of tiiis book is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924022385318 THE ART OF MUSIC v The Singing Angels AUdf piece Hg Hubert and Jan van Eyck The Art of Music A Comprehensive Library of Information for Music Lovers and Musicians Editor-in-Chief DANIEL GREGORY MASON Columbia University Associate Editors EDWARD B. HILL LELAND HALL Harvard University Fast Professor, Univ. of Wisconsin Managing Editor CESAR SAERCHINGER Modern Music Society of New Yorlc In Fourteen Volumes Profusely Illustrated NEW YORK THE NATIONAL SOCIETY OF MUSIC THE AET OP MUSIC: VOLUME SIX Choral and Church Music ROSSETTER GLEASON COLE, M.A. Introduction by FRANK DAMROSCH, Mus. Doc. Director Institute of Musical Art in the City of New York Conductor, Musical Art Society of New York, etc. NEW YORK THE NATIONAL SOCIETY OF MUSIC Copyright, 1915, by THE NATIONAL SOCIETY OF MUSIC, Inc. [All Eights Reserved] PREFATORY NOTE The field of choral and church music is so vast and the subject so inclusive that the author has felt the con- stant pressure of the necessity for sifting and abbrevi- ating and condensing the voluminous material at hand in order not to go far beyond the prescribed limits of this volume. -

Giovanni Maria Nanino-Richard Schuler
Giovanni Maria Nanino-Richard Schuler VOLUME 90, NO,. 2 SUMMER, 1963 CAECILIA Published four times a year, Spring, Summer, Autumn and Winter. Second·Class Postage Paid at Omaha, Nebraska Subscription Price-$3.00 per year All articles for publication must be in the hands of the editor, 3558 Cass St., Omaha 31, Nebraska, 30 days before month of publication. Business Manager: Norbert Letter Change of address should be sent to the circulation manager: Paul Sing, 3558 Cass St., Omaha 31, Nebraska Postmaster: Form 3579 to Caecilia, 3558 Cass St., Omaha 31, Nebr. caeci la TABLE OF CONTENTS Editorial " " .c -_ - - .. - ___ __ __ _ 43 Life of Giovanni Maria Nanino . .____________________________________________ 46 11th Annual Boys Town Liturgical Music Workship________________________________ 69 William Ripley Dorr c .. ~______________________________ 74 Sounds of Te Deum ~ ._________________________________________ 77 Reviews-Masses . .. 84 Other Music . ~ 86 Organ Music .______________________________________________________________________________________ 94 Music Received. .... .---- 96 VOLUME 90, NO. 2 SUMMER, 1963 RONCKA BROS.~OMAHA.NEBR. CAECILIA A Quarterly Reyiewdeyoted to the lit.urgical music apostolate. Published with ecclesiastical approval by the Society of Saint Caecilia in Spring, Swnmer, Autumn and Winter. Established in 1874 by John B. Singenberger,K.C.S.G., K.C.S.S. (1849-1924). Editor -------------------------- Very Rev. Msgr. Francis P. Schmitt CONTRIBUTING EDITORS Francis A. Brunner, C.Ss.R. Elmer Pfeil Louise Cuyler Richard Schuler David Greenwood Lavern Wagner Paul Koch Roger Wagner Paul Manz Rembert Weakland, O.S.B. Alex Peloquin James Welch CAECILIA ASSOCIATES Dr. Caspar Koch, Pittsburgh, Pa. The Hon. Arthur Reilly, Boston, Mass. Sr. Alphonse· Marie, C.P.P.S., Joseph Leahy, Notre Dame, Ind.