Z.Rcher Beitr.Ge 60 Fertig 8.Qxd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pathways out of Violence Desecuritization and Legalization of Bildu and Sortu in the Basque Country Bourne, Angela
Roskilde University Pathways out of violence Desecuritization and legalization of Bildu and Sortu in the Basque Country Bourne, Angela Published in: Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Publication date: 2018 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Citation for published version (APA): Bourne, A. (2018). Pathways out of violence: Desecuritization and legalization of Bildu and Sortu in the Basque Country. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 17(3), 45-66. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain. • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 01. Oct. 2021 Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Vol 17, No 3, 2018, 45-66. Copyright © ECMI 2018 This article is located at: http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/201 8/Bourne.pdf Pathways out of Violence: Desecuritization and Legalization of Bildu and Sortu in the Basque Country Angela Bourne Roskilde University Abstract In this article, I examine political processes leading to the legalization of the Batasuna- successor parties, Bildu and Sortu. -
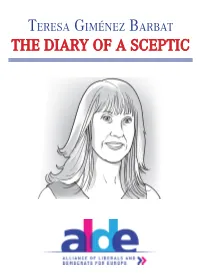
The Diary of a Sceptic (Pdf)
TERESA GIMÉNEZ BARBAT THE DIARY OF A SCEPTIC The Diary of a Sceptic Teresa Giménez Barbat (Introduction by Albert Boadella) Translated by Sandra Killeen © Teresa Giménez Barbat, 2018 © Introduction by Albert Boadella, 2018 © Translated by Sandra Killeen, 2018 © Cover illustration by José María Beroy, 2018 Editorial coordination, page layout and front cover: Editorial Funambulista INTRODUCTION I’m going to try and write as comprehensibly and naturally as Te- resa does in the pages that follow this prologue. The first thing that springs to mind is that this is a book that takes numerous risks. Its diary format is a risk on the current writing scene. Such a realistic narrative form implies the likelihood of a minority reception right from the outset. The elimination of any fictional perspective is cur- rently a sort of literary suicide. Anyone who writes a book free of fantasies could be said to walk a fine line with their readers. The majority want to read simulations. The book also has a feminist air to it, which together with the ostentation of scepticism may initially cause readers to shy away from these pages. Obviously, I write this hypothesis from a masculine point of view and in it I’m attempting to express my first impression when the book I had in my hands was fresh out of the oven. Nonetheless, as I knew the writer person- ally I was inclined to take the theoretical risk. I have to admit here, that I opened the pages of this account out of curiosity about my friend, though this didn’t prevent a certain degree of scepticism on my part and a slight willingness to be distracted when faced with the first undigested page. -

Pdf Pasado Y Memoria. Revista De Historia Contemporánea. Núm. 9
PASADO Y MEMORIA n.º 9, 2010 http://www.ua.es/hum.contemporaneas/pasado-memoria Los números anteriores de Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea pueden consultarse en el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante a través del enlace http://rua.ua.es Dirección: Glicerio Sánchez Recio Secretaría: Rafael Fernández Sirvent y Francisco Sevillano Calero Consenso y enfrentamiento Consejo de redacción: Gloria Bayona Fernández, Salvador Forner Muñoz, Rosa Ana Gutiérrez Lloret, Emilio La Parra López, Alicia Mira Abad, Roque Moreno Fonseret, Mónica Moreno Seco, José Miguel Santacreu Soler, Heydi Senante en la Democracia española Berendes y Rafael Zurita Aldeguer, Universidad de Alicante; Paul Aubert, Universidad de Aix-en-Provence; Alfonso Botti, Universidad de Urbino. Consejo asesor: Julio Aróstegui Sánchez Manuel Pérez Ledesma (Universidad Complutense) (Universidad Autónoma de Madrid) Gérard Chastagnaret Manuel Redero San Román (Universidad de Provenza) (Universidad de Salamanca) José Luis de la Granja Maurizio Ridolfi (Universidad del País Vasco) ( ) Gérard Dufour Universidad de Viterbo (Universidad de Aix-en-Provence) Fernando Rosas Eduardo González Calleja (Universidad Nueva de Lisboa) (Universidad Carlos III) Ismael Saz Campos Jesús Millán (Universidad de Valencia) (Universidad de Valencia) Manuel Suárez Cortina Conxita Mir Curcó (Universidad de Cantabria) ( ) Universidad de Lleida Julio Tascón Fernández Mª Encarna Nicolás Marín (Universidad de Oviedo) (Universidad de Murcia) Marco Palla Ramón Villares (Universidad -

NCTB Counterterrorism Strategies in Spain Written By
Instituto andaluz interuniversitario de Criminología Universidad de Málaga Campus de Teatinos, s/n Edif. Institutos de Investigación E – 29010 Málaga, España (SPAIN) Tel. (+34) 952 13 2325 Fax (+34) 952 132242 E-mail: [email protected] Web page: www.uma.es/criminologia NCTB Counterterrorism strategies in Spain Written by: Dr. Alejandra Gómez-Céspedes, (Ph.D.) Supervised by: Prof. Dr. Ana Isabel Cerezo Domínguez, (J.D.) 31 January 2006 CONTENTS I. Introduction.......................................................................................................... 4 1. Brief history of ETA..................................................................................................4 2. ETA structure..........................................................................................................5 3. Victims of ETA ........................................................................................................5 4. Social support.........................................................................................................5 5. Political support ......................................................................................................6 6. International links ...................................................................................................7 7. Counterterrorist strategies against ETA.......................................................................7 8. The Islamic-jihad related terrorism in Spain ................................................................7 II. Legislation -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Krisenherd Baskenland: Nationalismus – Terrorismus – Autonomie“ Verfasser Marco A. Bernal angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Mai 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Politikwissenschaft Betreuerin / Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Hannes Wimmer Danksagungen: An erster Stelle bedanke ich mich bei meinen Eltern für die Unterstützung in meinem bisherigen Leben, und ganz besonders in meiner Studienzeit. Bei der Erstellung dieser Arbeit war die Betreuung durch Univ. -Doz. Dr. Hannes Wimmer, der meine Diplomarbeit ihren gesamten Enstehungsprozess hindurch mit wertvollen Anregungen begleitet hat, eine wertvolle Unterstützung. Auch haben mir seine Vorlesungen zur Gesellschafts- und Staatstheorie wichtige Erkenntnisse gebracht. Für beides danke ich ihm sehr herzlich. Mein Dank gilt weiters Frau Prof. Dr. Irene Etzersdorfer für ihre Vorlesungen und Seminare zu den Themenkreisen Krieg, Menschenrechtsdiskurse und Politik der Identität als auch Herrn ao.Univ.–Prof. Dr. iur. René Kuppe, in dessen Kursen ich mich eingehend mit den Aspekten des Selbstbestimmungsrechts als auch des Rechts auf Sezession auseinander setzen konnte. Für die Geduld und Genauigkeit beim Korrekturlesen dieser Arbeit danke ich Mag. Thomas Arlt sehr herzlich. 2 3 Inhaltsverzeichnis: Einleitung 5 I: Nationalismus 7 1. Die Nation Denken 10 2. Nation als Phänomen der Moderne 12 a) Die Phasen des Nationalismus 15 b) Konflikt mit der Moderne 18 3. Nation als singuläre Identität 21 II: Die baskische Identität 24 III: Das Baskenland im Ancien Régime 32 1. Das Baskenland bis zur französischen Revolution 32 Exkurs: Eingliederung Navarras, Alavas, Guipuzcoas und Vizcayas in das Königreich Kastilien 37 2. -

The EP's Sakharov Prize for Freedom of Thought 1988-2013
DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES OF THE UNION DIRECTORATE B POLICY DEPARTMENT STUDY THE EUROPEAN PARLIAMENT’S SAKHAROV PRIZE FOR FREEDOM OF THOUGHT, 1988-2013 - A QUARTER CENTURY’S ENGAGEMENT IN HUMAN RIGHTS Abstract The Sakharov Prize for Freedom of Thought stands out among other initiatives as the best-known and most widely appreciated instrument of the European Parliament in the field of human rights. In some countries, it is as well-known as the Nobel Prize. Over its 25-year history, it has come to be associated with the European Union’s principled commitment to freedom of thought. However, empirical research on the personal and political circumstances of Sakharov Prize laureates, as well as on the political impact of the prize in five case studies – China, Cuba, Israel and Palestine, and Russia – shows that its potential remains under-utilised. Drawing on unique perspectives from the laureates themselves, this report offers suggestions to enhance its impact, including: the prize must be targeted more tightly at contexts where it could have tangible impact; it must be dovetailed with other policy instruments; it must guard more carefully against unintended effects; and it must serve as a platform for broader international linkages in the defence of human rights. On the occasion of its quarter-century anniversary, the European Parliament must reflect on how the prize can continue to be relevant in a world whose contours and predicaments look vastly different from those that prevailed at its inception. EXPO/B/DPHR/2013/11 December 2013 PE 433.758 EN Policy Department DG External Policies This study was requested by the European Parliament's Democracy Support and Election Coordination Group. -

Ethnicity and Violence: the Case of Radical Basque Nationalism Diego
Ethnicity and Violence: The Case of Radical Basque Nationalism Diego Muro Ruiz Thesis submitted in partial requirement for the Degree of Doctor of Philosophy The London School of Economics and Political Science University of London 2004 UMI Number: U615471 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615471 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 I HESfcS /' ^ 77 The aim of this thesis is to study the role of ethnicity in ETA’s 35 year campaign of political violence. I argue that both Francoism and a long tradition of Basque radical nationalism are important in understanding ETA’s emergence. In this tradition Spain and the Spaniards (regardless of their political regime) are blamed for the continuous decline of the Basque nation. In order for the Basque nation to return to its glorious Golden Age, it is argued, the Basques need to expel the Spaniards using whatever means are necessary. I maintain that Basque radical nationalism precedes ETA by at least 60 years. It was the founder of Basque nationalism, Sabino Arana, who looked nostalgically at the Basque past and first proposed a racially pure Basque nation with his motto ‘Euzkadi is the land of the Basques’. -

Roskilde University
Roskilde University Pathways out of violence Desecuritization and legalization of Bildu and Sortu in the Basque Country Bourne, Angela Published in: Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Publication date: 2018 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Citation for published version (APA): Bourne, A. (2018). Pathways out of violence: Desecuritization and legalization of Bildu and Sortu in the Basque Country. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 17(3), 45-66. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain. • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 26. Sep. 2021 Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Vol 17, No 3, 2018, 45-66. Copyright © ECMI 2018 This article is located at: http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/201 8/Bourne.pdf Pathways out of Violence: Desecuritization and Legalization of Bildu and Sortu in the Basque Country Angela Bourne Roskilde University Abstract In this article, I examine political processes leading to the legalization of the Batasuna- successor parties, Bildu and Sortu.