Otto Kern: Wilamowitz in Greifswald*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Memory and Performance: Strategies of Identity in the Orphic-Bacchic Lamellae by Mark Frederick Mcclay
Memory and Performance: Strategies of Identity in the Orphic-Bacchic Lamellae By Mark Frederick McClay A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classics in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Mark Griffith, Chair Professor Nikolaos Papazarkadas Professor James I. Porter Fall 2018 Copyright 2018, Mark Frederick McClay Abstract Memory and Performance: Strategies of Identity in the Orphic-Bacchic Lamellae by Mark Frederick McClay Doctor of Philosophy in Classics University of California, Berkeley Professor Mark Griffith, Chair This dissertation is a treatment of the Orphic-Bacchic lamellae, a collection of small gold tablets that were deposited in the graves of Dionysiac mystery initiates, mostly during the 4th/3rd c. BCE. So far, thirty-eight of these have been discovered, from various sites in Sicily, Magna Graecia, Northern Greece, Crete, and the Peloponnese. The tablets were deposited in the graves of both men and women, and they are inscribed with short poetic texts, mostly in hexameters, that offer promises of postmortem happiness. Scholarship on these objects has traditionally focused on the sacral and eschatological language of the texts and their underlying doctrinal structure. Past interpretations, and discussions of “Orphism” more generally, have relied on propositional definitions of “religion” that are centered on belief and on the scriptural authority of sacred texts rather than ritual or sensory experience. Following recent critiques of these models in general (and of their application to Orphic phenomena in particular), I consider the gold leaves in their social context as objects produced, handled, and disseminated by ritual performers. -
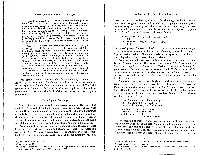
The Eleusinian Mysteries of Demeter and Persephone Part 2
40 Journal of Feminist Studies in Religion Keller: Fertility, Sexuality, and Rebirth 41 Persephone gathers three sheaves of wheat and three poppies, their own actions the fertility of the Earth. This magic probably included takes the torch Demeter has prepared for her, and begins her descent invocations, singing, dancing and lovemaking, the people celebrating their down into a deep chasm into the underworld. After a long journey, own sexuality in harmony with the creative powers of nature, as natural, she comes to a place where many spirits are milling about, moaning. human and divine. A story related by Homer in the Odyssey tells of the She moves among them, and after preparing an altar, she beckons them to her, saying, “If you come to me, I will initiate you into your EartWGrain Mother making love with Iason of Crete: new world.” As each spirit approaches, she embraces the form and So too fair-haired Demeter once in the spring looks deeply into the eyes, saying: “You have waxed into the fullness did yield of life, and waned into darkness, may you be renewed in peace and To love, and with Iason lay in a new-ploughed wisdom.” field. After several months, Persephone decides she will return again . to the upper world. Her mother Demeter has grown sorrodul, her In Homer’s poetry, Demeter yielded not to Iason, but to her own feelings of bountiful energies departing from the earth, leaving it barren, with love, an experience conveyed by the word thoicnios, one word translated as no crops growing to feed the humans. -

The Beginning of Time: Vedic and Orphic Theogonies and Poetics Kate Alsobrook
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2008 The Beginning of Time: Vedic and Orphic Theogonies and Poetics Kate Alsobrook Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES THE BEGINNING OF TIME: VEDIC AND ORPHIC THEOGONIES AND POETICS By KATE ALSOBROOK A Thesis submitted to the Department of Classics in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Degree Awarded: Spring Semester, 2008 The members of the Committee approve the thesis of Kate Alsobrook defended on December 3, 2007. ______________________________ James Sickinger Professor Directing Thesis ______________________________ Kathleen Erndl Committee Member ______________________________ John Marincola Committee Member ______________________________ Svetla Slaveva-Griffin Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii TABLE OF CONTENTS List of Tables ..................................................................................................................... v List of Figures................................................................................................................... vi List of Abbreviations ....................................................................................................... vii Abstract.......................................................................................................................... -

Illinois Classical Studies
17 Eva Sachs on Ulrich von Wilamowitz-Moellendoiff WILLIAM M. CALDER, III I. Introduction Theodor Klauser in his exemplary life of Henri Leclerq (1869-1945) remarks at its beginning the rapidity with which the details of a scholar's life are scattered and forgotten soon after his decease: • Schon wenige Jahre nach dem Tode eines prominenten Mannes von heute sind seine Lebensumstande nur dann noch feststellbar, wenn sie in irgendwelchen wohlbehUteten Personalakten nachzulesen sind. Wer keinem Verband angehort hat, der solche Personalakten fijhrt, ist bald nach seinem Tode nur noch ein blasser Schatten; es fehlen alle deutlichen Konturen. Only three women of great age are alive today who knew Eva Sachs (1882- 1936). The one who could say most will say nothing. Eva Sachs' name has been forgotten by all except the most specialized of Platonists and historians of ancient mathematics. Even for them, it is but a name on a title-page. She wrote her dissertation with the greatest Hellenist of modem times. Her work was praised by the highest authority and its contribution to knowledge is agreed to be a permanent one. Her unselfish aid eased the publication of one of the three or four most influential books on Plato of this century. Of classical philologists of the golden age who were women she has only one rival—the editor of Suidas, the Danish Jewess, Ada Adler.^ The discovery of two new documents that cast light on the brief and unhappy life of this brilliant woman, one of which reveals much about her great teacher, have caused me to gather what can be known still and seek to restore contours to the pale shadow. -

The Role of Internal Politics in American Diplomacy
Horace’s Mythological Lexicon: Repeated Myths and Meaning in Odes 1-3 Blanche Conger McCune Augusta, Georgia B.A., Wheaton College, 2007 M.A., University of Virginia, 2009 A Dissertation presented to the Graduate Faculty of the University of Virginia in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Classics University of Virginia May, 2014 i ©Copyright by Blanche Conger McCune All rights reserved May 2014 ii ABSTRACT This dissertation examines repeated mythological references in the first three books of Horace’s Odes. Several mythological figures occur more than once in the Odes; those studied in this dissertation are Daedalus and Icarus, Prometheus, Tantalus, Hercules, and Castor and Pollux. I argue that in Odes 1-3 recurrent myths constitute part of a personal lexicon, a mythological vocabulary Horace uses to speak about themes such as hubris, poetry, and immortality; for example, Daedalus and Icarus, Prometheus, and Tantalus are consistently linked with immoderation, and Hercules and the Dioscuri are consistently emblematic of complementary aspects of Augustus’ rule and of his future deification. This mythological lexicon can be read across poems so that the interpretation of a mythological figure in one poem can aid in understanding the use of the same mythological figure in another poem, and the collective effect of all of the uses of that figure is itself something that can be analyzed and interpreted. iii ACKNOWLEDGEMENTS The first word of thanks goes to my advisor, Jenny Strauss Clay, whose Odes seminar in the spring of 2010 first taught me how to love this seemingly impenetrable poet. She has consistently supported and guided me, since I first embarked on this project, even during one year when neither of us was in residence in Charlottesville. -

Cannibalism, Vegetarianism, and the Community of Sacrifice: Rediscovering Euripides’ Cretans and the Beginnings of Political Philosophy
CANNIBALISM, VEGETARIANISM, AND THE COMMUNITY OF SACRIFICE: REDISCOVERING EURIPIDES’ CRETANS AND THE BEGINNINGS OF POLITICAL PHILOSOPHY JOHAN TRALAU NLY SHARDS REMAIN OF Euripides’ tragedy Cretans. Yet the fragments that we do have reveal a drama that is intriguingly packed with logical Oand argumentative peculiarities. Previous scholarship on this tragedy has, as we will see, been unable to account for these incongruencies. I will suggest a novel interpretation, namely, that Euripides elucidates a normative principle that is fundamental to his polity, and that the self-contradictions and tensions serve to present this principle in a curious yet systematic manner. Moreover, I will argue that this discovery yields general insights about the role of logical thinking in Greek tragedy and in the early development of po- litical thought. We will see that all these argumentative peculiarities have to do with food and sacrifice. My contention is that one needs to address these strange passages with an eye to the role of sacrifice, eating, and meat in the moral and religious universe of the Greek city—and that in light of a certain interpretation of sacrifice as a political institution, the strangenesses in Euripides’ tragedy will appear remarkably reasonable. In making sense of a tragedy that seems to ex- clude any search for rationality and philosophical argument, I wish to make two contributions. First, given the interpretation suggested below, we will be able to understand a series of logical and argumentative improprieties that have haunted Euripides studies and, by extension, to understand Euripides, his political thought, and the polis itself in new and better ways. -

Forgetting Delphi Between Apollo and Dionysus Author(S): Marcel Detienne Source: Classical Philology, Vol
Forgetting Delphi between Apollo and Dionysus Author(s): Marcel Detienne Source: Classical Philology, Vol. 96, No. 2 (Apr., 2001), pp. 147-158 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1215486 . Accessed: 03/08/2011 11:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at . http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ucpress. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The University of Chicago Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Classical Philology. http://www.jstor.org ESSAY FORGETTINGDELPHI BETWEEN APOLLO AND DIONYSUS MARCEL DETIENNE L ET US BE CLEAR who is at fault if we are still today attracted and fascinated by the opposition between Apollonian and Dionysiac, be it in a Poussin painting or at the origins of Greek religion. -

Plato's Orpheus: the Philosophical Appropriation of Orphic Formulae
University of New Mexico UNM Digital Repository Foreign Languages & Literatures ETDs Electronic Theses and Dissertations 6-9-2016 Plato's Orpheus: The hiP losophical Appropriation of Orphic Formulae Dannu Hütwohl Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/fll_etds Recommended Citation Hütwohl, Dannu. "Plato's Orpheus: The hiP losophical Appropriation of Orphic Formulae." (2016). https://digitalrepository.unm.edu/fll_etds/20 This Thesis is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Foreign Languages & Literatures ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Dannu J. Hutwohl Foreign Languages and Literatures Professor Lorenzo F. Garcia Jr. Professor Monica S. Cyrino Professor Osman Umurhan by THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico Acknowledgements I wish to extend a heart felt thanks to all the members of my thesis committee, without whom this project would not have been possible: first and foremost to my brilliant and inspiring advisor and mentor, Dr. Lorenzo F. Garcia Jr., for your endless patience, wisdom, and dedication; Just as the Orphic initiates would have been lost in the darkness of the Underworld without the help of their Gold Tablets, so too would I have been lost in this undertaking without the illuminating light of your golden advice. To Dr. Monica S. Cyrino, for your incredible editing skills and for always believing in and supporting me over the years in countless ways; Just as Demeter moved heaven and earth for Persephone, so too have you nurtured and championed my research. -

A Study of Semi-Divine Beings and Non-Human Species in European Mythologies
Wesleyan University College of Letters Spiritual Descent: A Study of Semi-Divine Beings and Non-Human Species in European Mythologies by Jared Joseph Gimbel Class of 2011 A thesis submitted to the faculty of Wesleyan University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Arts with Departmental Honors from the College of Letters Middletown, Connecticut April, 2011 2 Table of Contents Acknowledgments…………………………………………………………………………3 Introduction………………………………………………………………………………..4 Chapter One……………………………………………………………………………….9 Giants…………………………………………………………………………….10 Trolls……………………………………………………………………………..14 Cyclopes………………………………………………………………………….19 Centaurs and Satyrs………………………………………………………………22 Djinn……………………………………………………………………………..27 Demons…………………………………………………………………………..30 Fallen Angels and Nephilim……………………………………………………..36 Chapter Two Faeries……………………………………………………………………………42 Elves……………………………………………………………………………...48 Nymphs and Wood Spirits (Ents)………………………………………………..53 Leprechauns……………………………………………………………………...58 Water Spirits, Selkies, Merpeople, and Other Aquatic Creatures……………….64 Dwarves………………………………………………………………………….75 Chapter Three………………………………………………………………………….....82 Dragons and Dragonslayers………………………………………………….......83 Ifrits………………………………………………………………………………89 Fire Giants………………………………………………………………………..94 Frost Giants ……………………………………………………………………...98 Overall Conclusions…………………………………………………………………….103 ACKNOWLEDGEMENTS The ideas and research in this work, their formation, and the conclusions I reached could have not been realized were I alone -

Views of This Work, but No Assessment That Embraces the Several Poetic Systems Within This Large Satire Has Yet Appeared
INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photo graph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the original text directly from the copy submitted. Thus, some dissertation copies are in typewriter face, while others may be from a computer printer. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyrighted material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are re produced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each oversize page is available as one exposure on a standard 35 mm slide or as a 17" x 23" black and white photographic print for an additional charge. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. 35 mm slides or 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. Accessing theUMI World’s Information since 1938 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA Order Number 8824587 A new interpretation of Juvenal HI Parmer, Jess Henry, Ph.D. The Ohio State University, 1988 UMI 300 N. Zeeb Rd. Ann Arbor, MI 48106 A NEW INTERPRETATION OF JUVENAL III DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By Jess Henry Parmer, B.A., M.A., M.F.A * * * * * The Ohio State University 1988 Dissertation Committee: Approved by C. -
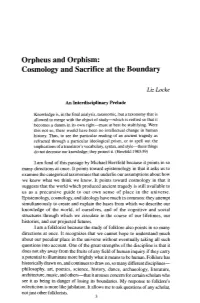
Orpheus and Orphism: Cosmology and Sacrifice at the Boundary
Orpheus and Orphism: Cosmology and Sacrifice at the Boundary Liz Locke An Interdisciplinary Prelude Knowledge is, in the final analysis, taxonomic, but a taxonomy that is allowed to merge with the object of study-which is reified so that it becomes a datum in its own right-must at best be stultifying. Were this not so, there would have been no intellectual change in human history. Thus, to see the particular reading of an ancient tragedy as refracted through a particular ideological prism, or to spell out the implications of a translator's vocabulary, syntax, and style-these things do not decrease our knowledge; they protect it. (Herzfeld 198359) I am fond of this passage by Michael Herzfeld because it points in so many directions at once. It points toward epistemology in that it asks us to examine the categorical taxonomies that underlie our assumptions about how we know what we think we know. It points toward cosmology in that it suggests that the world which produced ancient tragedy is still available to us as a precursive guide to our own sense of place in the universe. Epistemology, cosmology, and ideology have much in common: they attempt simultaneously to create and explain the bases from which we describe our knowledge of the world, of ourselves, and of the cognitive and social structures through which we circulate in the course of our lifetimes, our histories, and our projected futures. I am a folklorist because the study of folklore also points in so many directions at once. It recognizes that we cannot hope to understand much about our peculiar place in the universe without eventually taking all such questions into account. -

Inscriptions and Memory in the Temples of Late Antique Greece and Asia Minor
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2017 The Writing On The Wall: Inscriptions And Memory In The Temples Of Late Antique Greece And Asia Minor Anna Marie Sitz University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Classics Commons, and the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons Recommended Citation Sitz, Anna Marie, "The Writing On The Wall: Inscriptions And Memory In The Temples Of Late Antique Greece And Asia Minor" (2017). Publicly Accessible Penn Dissertations. 2886. https://repository.upenn.edu/edissertations/2886 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/2886 For more information, please contact [email protected]. The Writing On The Wall: Inscriptions And Memory In The Temples Of Late Antique Greece And Asia Minor Abstract This dissertation documents late antique (fourth to seventh century CE) Christian responses to earlier, pagan inscriptions at sanctuaries, as seen in the archaeological record. I argue that Christians in Greece and Asia Minor neither ignored nor unthinkingly destroyed older inscriptions, but rather were generally tolerant toward these legible reminders of the pagan past, selectively editing them only occasionally. In order to clarify the types of inscriptions that Christians encountered on temple walls and architraves, I have assembled the first catalog of inscriptions on temples, which er veals that the majority of texts inscribed on sacred structures between the seventh century BCE and the third century CE were, counterintuitively, not about religion, but rather civic matters: political privileges, economic/territorial rights, and elite social structures.