Teufelskraut. Zur Historischen Anthropologie Des Tabaks
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

When One Person's Habit Becomes Everyone's Problem: the Battle Over Smoking Bans in Bars and Restaurants
Volume 14 Issue 1 Article 5 2007 When One Person's Habit Becomes Everyone's Problem: The Battle over Smoking Bans in Bars and Restaurants Marot Williamson Follow this and additional works at: https://digitalcommons.law.villanova.edu/mslj Part of the Entertainment, Arts, and Sports Law Commons Recommended Citation Marot Williamson, When One Person's Habit Becomes Everyone's Problem: The Battle over Smoking Bans in Bars and Restaurants, 14 Jeffrey S. Moorad Sports L.J. 161 (2007). Available at: https://digitalcommons.law.villanova.edu/mslj/vol14/iss1/5 This Comment is brought to you for free and open access by Villanova University Charles Widger School of Law Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal by an authorized editor of Villanova University Charles Widger School of Law Digital Repository. Williamson: When One Person's Habit Becomes Everyone's Problem: The Battle ov WHEN ONE PERSON'S HABIT BECOMES EVERYONE'S PROBLEM: THE BATTLE OVER SMOKING BANS IN BARS AND RESTAURANTS I. INTRODUCTION For many, smoking a cigarette while enjoying a drink while out at a bar or restaurant are activities that go hand in hand.1 Despite the social popularity of this duo, recent smoking bans around the country are putting an end to smoking in bars and restaurants. 2 Scientists have found that smoking not only harms the smoker, but also those surrounding the smoker.3 Although society once consid- ered smoking a fashionable and generally acceptable activity, knowledge of its health risks is compelling lawmakers to pass laws prohibiting smoking in public places. -

Chapter 13: Tobacco Control
Chapter 13: Tobacco control SUMMARY POINTS · The foundation for effective national tobacco control policies lies in comprehensive implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). · Once it enters into force, the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products could provide a comprehensive framework for national legislation to eliminate smuggled, counterfeit and illicit tobacco products that increase the accessibility and affordability of tobacco and undermine government revenues. · The Conference of the Parties to the WHO FCTC has issued detailed guidelines to assist Parties to implement specific provisions of the WHO FCTC in an effective, evidence-based manner. · In entering trade and investment agreements, countries should ensure that they do not unduly restrict their health sovereignty or unduly diminish their capacity to implement and enforce effective tobacco control measures. · Countries should coordinate the activities of their health, trade and finance ministries in order to ensure that they do not undertake trade and investment obligations that unduly conflict with their health goals, including their capacity to effectively regulate tobacco, alcohol and unhealthy food products. · Tax policy is a powerful instrument for raising the price and reducing the affordability of tobacco products. Uniformly high tobacco prices help to discourage initiation, encourage quitting, and reduce the amount of tobacco consumed by those who do not quit. Countries can use tobacco excise tax increases, applied -

Tobacco Use by Indian Adolescents
Tobacco Induced Diseases Vol. 1, No. 2: 111–119 (2002) © PTID Society Tobacco use by Indian adolescents Chadda RK, Sengupta SN Department of Psychiatry, Institute of Human Behavior & Allied Sciences, Delhi, India ABSTRACT. Adolescents are the most vulnerable population to initiate tobacco use. It is now well estab- lished that most of the adult users of tobacco start tobacco use in childhood or adolescence. There has been a perceptible fall in smoking in the developed countries after realization of harmful effects of tobac- co. The tobacco companies are now aggressively targeting their advertising strategies in the developing countries like India. Adolescents often get attracted to tobacco products because of such propaganda. There has been a rapid increase in trade and use of smokeless tobacco products in recent years in the coun- try, which is a matter of serious concern to the health planners. It is important to understand various fac- tors that influence and encourage young teenagers to start smoking or to use other tobacco products. The age at first use of tobacco has been reduced considerably. However, law enforcing agencies have also taken some punitive measures in recent years to curtail the use of tobacco products. This paper focuses on vari- ous tobacco products available in India, the extent of their use in adolescents, factors leading to initiation of their use, and the preventive strategies, which could be used to deal with this menace. KEY WORDS: Smoking, nicotine, tobacco abuse, smokeless tobacco. INTRODUCTION Tobacco use in children and adolescents is reaching pandemic India; its use has unfortunately been well recognized among levels. -

Smoke-Free Laws Do Not Harm Business at Restaurants and Bars
SMOKE-FREE LAWS DO NOT HARM BUSINESS AT RESTAURANTS AND BARS In recent years a groundswell of support for smoke-free restaurant and bar laws has developed from states and localities across the country. As of August 15, 2020, 66.4 percent of the U.S. population (or more than 200 million people) live in areas that have passed strong smoke-free laws covering restaurants and bars.1 Strong smoke-free restaurant and bar laws are important because: Everyone has the right to breathe clean, smoke-free air at work and while visiting public places like restaurants and bars. There is overwhelming scientific evidence that secondhand tobacco smoke causes serious illnesses, including lung cancer and heart disease in non-smokers.2 Smoke-free laws help protect restaurant and bar employees and patrons from the harms of secondhand smoke.3 Smoke-free laws help the seven out of every ten smokers who want to quit smoking by providing them with public environments free from any pressure or temptation to smoke.4 Accompanying the growth in smoke-free laws nationwide has been a parallel increase in false allegations that smoke-free laws will hurt local economies and businesses.5 In fact, numerous careful scientific and economic analyses show that smoke-free laws do not hurt restaurant and bar patronage, employment, sales, or profits.6 At worst, the laws have no effect at all on business activity, and they sometimes even produce slightly positive trends. For example: The National Cancer Institute, with the World Health Organization, in December 2016 conducted an extensive review of the economic literature on tobacco control, concluding, “. -

The Effect of Vaping and Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking-Attributable Deaths
International Journal of Environmental Research and Public Health Article US Nicotine Vaping Product SimSmoke Simulation Model: The Effect of Vaping and Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking-Attributable Deaths David T. Levy 1,* , Luz María Sánchez-Romero 1, Nargiz Travis 1 , Zhe Yuan 1, Yameng Li 1, Sarah Skolnick 2 , Jihyoun Jeon 2 , Jamie Tam 3 and Rafael Meza 2 1 Lombardi Comprehensive Cancer Center, Georgetown University, Washington, DC 20007, USA; [email protected] (L.M.S.-R.); [email protected] (N.T.); [email protected] (Z.Y.); [email protected] (Y.L.) 2 Department of Epidemiology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA; [email protected] (S.S.); [email protected] (J.J.); [email protected] (R.M.) 3 Department of Health Policy and Management, Yale University School of Public Health, Hartford, CT 06520, USA; [email protected] * Correspondence: [email protected] Abstract: The public health impact of nicotine vaping products (NVPs) is subject to a complex set of uncertain transitions between NVP and cigarette use. Instead, we apply an indirect method to gauge the impact of NVP use on smoking prevalence and smoking-attributable deaths (SADs) using the well-established SimSmoke tobacco control policy simulation model. Upon validating the Citation: Levy, D.T.; model before NVPs were more widely used, we project a No-NVP (i.e., in the absence of NVPs) Sánchez-Romero, L.M.; Travis, N.; while controlling for the impact of cigarette-oriented policies. The net impact of NVPs on smoking Yuan, Z.; Li, Y.; Skolnick, S.; Jeon, J.; prevalence is inferred by comparing the projected No-NVP smoking trends to corresponding trends Tam, J.; Meza, R. -

From Science to Politics German Cancer Research Center, Heidelberg
From Science to Politics German Cancer Research Center, Heidelberg The failure of partial smoking bans in hospitality venues: The example of Germany and Spain Background Conclusive evidence and international consensus demonstrate 85 percent of the inspected larger venues, the smoking rooms that there is no safe level of exposure to tobacco smoke. After were bigger than allowed and in 37 percent the physical separa- the ratification of the WHO Framework Convention on Tobacco tion was not provided18. Control (FCTC) in 2003 and the adoption of guidelines on "Protec- Evaluation: Healthcare experts and health advocates thus tion against the exposure to tobacco smoke" (Article 8, FCTC) describe the outcome of the "Spanish model" as "chaotic" and by the Conference of the Parties in 20074,21, several EU Member ineffective19,20: States like Finland, France, Ireland, Italy, Sweden and the United ▪ Hospitality workers remain unprotected from tobacco smoke Kingdom introduced comprehensive smoking bans in public in their workplaces. places. However, some countries, such as Spain, Germany, ▪ The vast majority of hospitality venues is not smoke-free18. Denmark and Austria, decided to introduce partial smoking ▪ According to opinion polls, the majority of Spaniards are in favour bans, which only cover some hospitality venues. The two case of a comprehensive ban on smoking in bars and restaurants3,11. studies below demonstrate why partial smoking bans are not an ▪ Owners of larger restaurants have come out in favour of an alter native to comprehensive smoke-free legislation in Europe uniform solution in order to correct the crass distortions of and undermine international tobacco control efforts. -
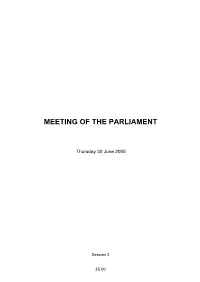
Official Report Will Confirm Tomorrow— Support
MEETING OF THE PARLIAMENT Thursday 30 June 2005 Session 2 £5.00 Parliamentary copyright. Scottish Parliamentary Corporate Body 2005. Applications for reproduction should be made in writing to the Licensing Division, Her Majesty‘s Stationery Office, St Clements House, 2-16 Colegate, Norwich NR3 1BQ Fax 01603 723000, which is administering the copyright on behalf of the Scottish Parliamentary Corporate Body. Produced and published in Scotland on behalf of the Scottish Parliamentary Corporate Body by Astron. CONTENTS Thursday 30 June 2005 Debates Col. BUSINESS MOTION ........................................................................................................................................ 18571 Motion moved—[George Lyon]—and agreed to. George Lyon (Argyll and Bute) (LD) ........................................................................................................ 18571 ECONOMIC DEVELOPMENT (CROSS-CUTTING EXPENDITURE REVIEW) ............................................................. 18572 Motion moved—[Des McNulty]. Des McNulty (Clydebank and Milngavie) (Lab) ....................................................................................... 18572 Jim Mather (Highlands and Islands) (SNP) ............................................................................................. 18576 Mr Ted Brocklebank (Mid Scotland and Fife) (Con) ................................................................................ 18578 Mr Andrew Arbuckle (Mid Scotland and Fife) (LD) ................................................................................. -
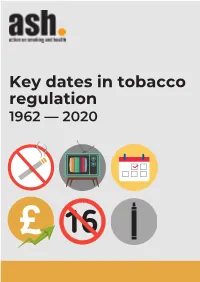
Key Dates in Tobacco Regulation 1962 — 2020
Key dates in tobacco regulation 1962 — 2020 16 Further information about the early history of tobacco is available at: www.tobacco.org/History/history.html 1962 The first Royal College of Physicians (RCP) report, "Smoking and Health", was published. It received massive publicity. The main recommendations were: restriction of tobacco advertising; increased taxation on cigarettes; more restrictions on the sales of cigarettes to children, and smoking in public places; and more information on the tar/nicotine content of cigarettes. For the first time in a decade, cigarette sales fell. The Tobacco Advisory Committee (subsequently Council, and now known as the Tobacco Manufacturers’ Association) - which represents the interests of the tobacco industry - agreed to implement a code of advertising practice for cigarettes which was intended to take some of the glamour out of cigarette advertisements. The code was based on the former ITA code governing cigarette advertisements on TV (before they were removed in 1964, with the co-operation of the ITA) 1964 The US Surgeon General produced his first report on "Smoking and Health". Its conclusions corroborated those of the RCP and the US Surgeon General has produced annual reports since 1967 on the health consequences on smoking. Doll and Hill published the results of a nationwide prospective survey on "mortality in relation to smoking: 10 years' observations in British Doctors". Between 1951 and 1964 about half the UK's doctors who smoked gave up and there was a dramatic fall in lung cancer incidence among those who gave up as opposed to those who continued to smoke. 1965 After considerable debate, the government used the powers vested in it under the terms of the 1964 Television Act to ban cigarette advertisements on television. -
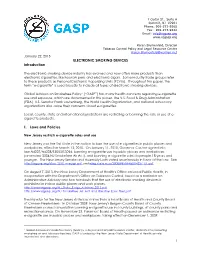
White Paper on E-Cigarettes
7 Cedar St., Suite A Summit, NJ 07901 Phone: 908-273-9368 Fax: 908-273-9222 Email: [email protected] www.njgasp.org Karen Blumenfeld, Director Tobacco Control Policy and Legal Resource Center [email protected] January 22, 2015 ELECTRONIC SMOKING DEVICES Introduction The electronic smoking device industry has evolved and now offers more products than electronic cigarettes, like hookah pens and electronic cigars. Some industry trade groups refer to these products as Personal Electronic Vaporizing Units (PEVUs). Throughout this paper, the term “e-cigarette” is used broadly to include all types of electronic smoking devices. Global Advisors on Smokefree Policy1 (“GASP”) has many health concerns regarding e-cigarette use and exposure, which are documented in this paper. The U.S. Food & Drug Administration (FDA), U.S. Senator Frank Lautenberg, the World Health Organization, and national advocacy organizations also voice their concerns about e-cigarettes. Local, county, state and international jurisdictions are restricting or banning the sale or use of e- cigarette products. I. Laws and Policies New Jersey restricts e-cigarette sales and use New Jersey was the first state in the nation to ban the use of e-cigarettes in public places and workplaces, effective March 13, 2010. On January 11, 2010, Governor Corzine signed into law A4227/A4228/S3053/S3054, banning e-cigarette use in public places and workplaces (amended 2006 NJ Smokefree Air Act), and banning e-cigarette sales to people 18 years and younger. The New Jersey Senate and Assembly both voted unanimously in favor of the law. See http://njgasp.org/sfaa_2010_w-ecigs.pdf and njleg.state.nj.us/2008/Bills/A4500/4227_U1.pdf. -

Severe Damage Hampers Fire Probe
GULF ISLANDS DRIFTWOOD | WEDNESDAY, JULY 18, 2007 | 21 Island NEW TRUCKS Big honkin’ truck releases ‘inner Albertan’ Wheels 2007 Chev Silverado king of the crop BY ANDREA RABINOVITCH DRIFTWOOD STAFF You can take the Albertan out of Alberta, but your neck INSIDE Designers’ Showcase spotlight. will always be just a little bit red. Fibre Fest Born and raised in the City of Champions — Edmonton — I know kno that its beef eatin’ culture is as inbred as West Coast- ers’ hedonisonistictici treks to MMexicoMe in January. BecauseBec I dadatedted a few rurural-with-an-artistic-bentral-with-an-hanartistic types, a hybrid bidth thatt thaat doesd do s exist in WilWildd RoseRose Country, or because I dated in Alberta att allall,ll soonerer oro llater ateratetryoufi you y fi ndn yourselfy try- SEE PAGE 18 ing to navigateag getting into a truck in a shortt skirt.s Those daysysas aarere long ggone,one,,t thank God, but I thoughthtt thatth it was about titimeime to reconn recreconnectnectec with my “inn“innerinner AAlbertan” after residing forr four years yea ini lotus s land. lanlandd. Casting a spell Off I wentnntt ttoo corral a 22007007 Chevr ChevroleChevrolethevrolevrolet SilvSSilveraSilverSilveradolveradveradoradodo ata VicVVictoriaicto Motor Productsdduduccts on the cocornerrner offFin FinlFinlaysonlaysonayysonon anda d DoDDouglas.ouglauglas.uglugglas.s Gerald OO’TO’Toole,Toole, ssalesales mamanager,nager, enligenlightenedhtenedhtennedd meme onon thethhee differencee bbetweeneetween WWestest CCoastersoasters and the buyersyers of ththehee “b“bigbigg Harry Potter fever strikes. SEE PAGE 12 honkin’ truck”rruuck” in the neneighbouringighbouring provinces.provinces. Apparently,eenntltly, people hhereere use them for pragmatic rreasons:eaeasonons:ns:: for towing,nngg, for work, foforr landscaping needs.needs. -

HOUSE of REPRESENTATIVES STAFF ANALYSIS BILL #: HB 7027 PCB HQS 19-02 Vaping SPONSOR(S): Health Quality Subcommittee, B
HOUSE OF REPRESENTATIVES STAFF ANALYSIS BILL #: HB 7027 PCB HQS 19-02 Vaping SPONSOR(S): Health Quality Subcommittee, Beltran, Mike TIED BILLS: IDEN./SIM. BILLS: SB 7012 REFERENCE ACTION ANALYST STAFF DIRECTOR or BUDGET/POLICY CHIEF Orig. Comm.: Health Quality Subcommittee 14 Y, 0 N Gilani McElroy 1) Government Operations & Technology 10 Y, 0 N Helpling Topp Appropriations Subcommittee 2) Health & Human Services Committee 17 Y, 0 N Gilani Calamas SUMMARY ANALYSIS Chapter 386, Part II, F.S., the Florida Clean Indoor Air Act (FCIAA), protects people from the health hazards of secondhand tobacco smoke and implements Article X, Section 20 of the Florida Constitution. The FCIAA prohibits a person from smoking tobacco in an enclosed indoor workplace, with certain exceptions. The Department of Health (DOH) and the Department of Business and Professional Regulation (DBPR) enforce the FCIAA. In the general election of November 2018, Floridians passed Amendment No. 9, which, in part, amends Article X, Section 20 of the Florida Constitution. The Amendment bans the use of vapor-generating electronic devices, or vaping, consistent with the current prohibition of tobacco smoking in enclosed indoor workplaces. The amendment further requires the Legislature to adopt legislation to implement these changes by July 1, 2019. The bill amends the FCIAA to implement Amendment No. 9 by prohibiting vaping in enclosed indoor workplaces consistent with the current prohibition on indoor smoking. Specifically, the bill: Provides exceptions for vaping in enclosed -

Impact and Effectiveness of Legislative Smoking Bans and Anti
healthcare Article Impact and Effectiveness of Legislative Smoking Bans and Anti-Tobacco Media Campaigns in Reducing Smoking among Women in the US: A Systematic Review and Meta-Analysis Yelena Bird 1, Ladan Kashaniamin 2, Chijioke Nwankwo 3 and John Moraros 4,* 1 Director iCAN Research Group, Brandon, MB R7A 0V6, Canada; [email protected] 2 Department of Community Health and Epidemiology, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK S7N 2Z4, Canada; [email protected] 3 School of Public Health, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK S7N 2Z4, Canada; [email protected] 4 Faculty of Health Studies, Brandon University, Brandon, MB R7A 6A9, Canada * Correspondence: [email protected] Received: 19 November 2019; Accepted: 11 January 2020; Published: 16 January 2020 Abstract: Background: The purpose of this study is to systematically review the literature addressing the effectiveness of legislative smoking bans and anti-tobacco media campaigns in reducing smoking among women. Methods: MEDLINE, PubMed, CINAHL, and ABI/INFORM were searched for studies published from 2005 onwards. Meta-analysis was conducted using a random effects model and subgroup analysis on pre-selected characteristics. Results: In total, 652 articles were identified, and five studies satisfied the inclusion criteria. The studies varied from school-based to workplace settings and had a total of 800,573 women participants, aged 12 to 64 years old. Three studies used legislative bans, one study used anti-tobacco campaigns and another one used both as their intervention. The overall pooled effect of the five studies yielded an odds ratio (OR) = 1.137 (C.I. = 0.976–1.298 and I2 = 85.6%).