Julius Sachs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Heinrich Anton De Bary
日 植 病 報 54: 668-670 (1988) Ann. Phytopath. Soc. Japan 54: 668-670 (1988) 特 別 講 演 Heinrich Anton de Bary Johan Dekker President of ISPP We briefly reviewed the development of our young International Society for Plant Pathology during the past five years. We should remember, however, that also the science of plant pathology itself is not very old. This year we commemorate that 100 years ago, in 1888, Anton de Bary died. This famous German botanist put the study of plant diseases on a scientific basis, and is therefore known as the father of plant pathology. The organizing committee asked me to say a few words about this great pioneer and his work. Heinrich Anton de Bary was born on 27 January 1831 at Frankfurt am Main, in Germany. The French sounding name De Bary stems from the village of Barry, where his forbears came from, situated in the French speaking part of Belgium, 10km east of Tournai or Doornik. Anton followed the profession of his father and became a medical doctor in 1853. However, his prime interest was in plants, algae and fungi, which he investigated as a hobby already at school and during his medical study. In the same year that he became a medical doctor, in 1853, he published his first major work in this direction: 'Untersuchungen fiber die Brandpilze and die durch sic verursachten Krank heiten der Pflanzen' (Research on smut fungi and the plant diseases caused by them). He was the first one who proved that fungi could infect and attack healthy plants. -
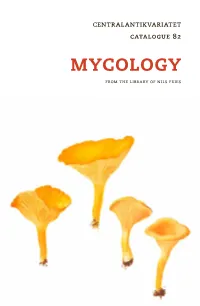
Mycology from the Library of Nils Fries
CENTRALANTIKVARIATET catalogue 82 MYCOLOGY from the library of nils fries CENTRALANTIKVARIATET catalogue 82 MYCOLOGY from the library of nils fries stockholm mmxvi 15 centralantikvariatet österlånggatan 53 111 31 stockholm +46 8 411 91 36 www.centralantikvariatet.se e-mail: [email protected] bankgiro 585-2389 medlem i svenska antikvariatföreningen member of ilab grafisk form och foto: lars paulsrud tryck: eo grafiska 2016 Vignette on title page from 194 PREFACE It is with great pleasure we are now able to present our Mycology catalogue, with old and rare books, many of them beautifully illustrated, about mushrooms. In addition to being fine mycological books in their own right, they have a great provenance, coming from the libraries of several members of the Fries family – the leading botanist and mycologist family in Sweden. All of the books are from the library of Nils Fries (1912–94), many from that of his grandfather Theodor (Thore) M. Fries (1832–1913), and a few from the library of Nils’ great grandfather Elias M. Fries (1794–1878), “fa- ther of Swedish mycology”. All three were botanists and professors at Uppsala University, as were many other members of the family, often with an orientation towards mycology. Nils Fries field of study was the procreation of mushrooms. Furthermore, Nils Fries has had a partiality for interesting provenances in his purchases – and many international mycologists are found among the former owners of the books in the catalogue. Four of the books are inscribed to Elias M. Fries, and it is probable that more of them come from his collection. Thore M. -

GEWASBESCHERMING Mededelingenblad Van De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging 6NUMMER GEWASBESCHERMING | JAARGANG 47 | JUBILEUMNUMMER
GEWASBESCHERMING Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging 6NUMMER GEWASBESCHERMING | JAARGANG 47 | JUBILEUMNUMMER Terugblik activiteiten jubileumjaar COLOFON ] Afbeelding voorpagina: Cystenaaltje op plantenwortel, gechilderd door Gera van Os, gemaakt tijdens de workshop op de najaarsbijeenkomst. Gewasbescherming, Rekeningnummers: Fytobacteriologie het mededelingenblad van de KNPV, NL 11 INGB 0000923165 en voorzitter: Leo van Overbeek (Wageningen verschijnt zes keer per jaar. NL 43 ABNA 0539339768, ten name van KNPV, Plant Research) Wageningen. Betalingen o.v.v. uw naam. secretaris: Jan van der Wolf (Wageningen Redactie Plant Research) Jan-Kees Goud Adreswijzigingen e-mail: [email protected] (Wageningen University & Research/KNPV), - zelf aanpassen op www.knpv.org hoofdredacteur, - doorgeven aan [email protected] Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat e-mail: [email protected]; mediator blog: Nicoline Roozen (NVWA) José van Bijsterveldt-Gels (NVWA), Bestuur Koninklijke Nederlandse e-mail: [email protected] secretaris, Plantenziektekundige Vereniging Annemarie Breukers (LTO) [email protected]; Piet Boonekamp, voorzitter Jan Buurma (Wageningen Economic Research) Marianne Roseboom-de Vries, Frits van der Zweep, secretaris Roland Verweij (CS Consultancy) administratief medewerker, Marleen Riemens (Wageningen Plant Harrie Hoeben (Wingssprayer) [email protected]; Research), penningmeester Irene Koomen(Wageningen University & Erno Bouma Jan-Kees Goud (Wageningen University -

Robert Lauterborn (1869—1952) and His Paulinella Chromatophora
ARTICLE IN PRESS Protist, Vol. 156, 253—262, August 2005 http://www.elsevier.de/protis Published online date 11 July 2005 FROM THE ARCHIVES Robert Lauterborn (1869—1952) and his Paulinella chromatophora Michael Melkoniana,1and Dieter Mollenhauerb aBotanisches Institut, Lehrstuhl I, Universita¨ tzuKo¨ ln, Gyrhofstr. 15, 50931 Ko¨ ln, Germany bForschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main, Forschungsstation fu¨ r Mittelgebirge, Lochmu¨ hle 2, 63599 Biebergemu¨ nd, Germany In 1895, in his second, short contribution about among the most interesting representatives of its protozoa (Protozoenstudien II.), Robert Lauter- division in freshwater.’’ ? born, then at the Zoology Department of the In the second half of the 19th century the socio- University of Heidelberg, described a novel organ- economic situation in Germany (i.e. urbanization, ism (nov. gen. et nov. spec.) which he named industrialization and the rise of an urban proletar- Paulinella chromatophora. He must have been iat) led to pronounced and lasting environmental very exited about his discovery which he made on changes (e.g. degradation of soil and natural Christmas Eve 1894, since he clearly recognized waters, epidemic human diseases, plant diseases, the importance of his observations for symbiosis decline of forests). The Janus face of prosperity research and biology, in general. And although his were difficulties of supply, lack of hygiene in Paulinella featured only occasionally in scientific settlements, and various kinds of diseases. publications during the next 100 years, it now Gradually, questions were raised which today are appears to be taking center stage in discussions known as problems of waste disposal. Careful about the endosymbiotic origin of plastids (some observers such as Ferdinand Cohn (1828—1898) recent reviews in this field that mention Paulinella had early recognized the problems and with the include Bhattacharya et al. -

Anton De Bary – Wikipedia
Anton de Bary – Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_de_Bary aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Heinrich Anton de Bary (* 26. Januar 1831 in Frankfurt am Main; † 19. Januar 1888 in Straßburg) war ein deutscher Naturwissenschaftler, Mediziner, Mykologe und Botaniker. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet „DE BARY“. 1 Leben 2 Forschung 3 Schriften(Auswahl) 4 Literatur Anton de Bary 5 Einzelnachweise 6 Weblinks De Bary wurde als Sohn eines angesehenen Frankfurter Arztes geboren. Er entstammt einer uradeligen Familie aus Barry bei Tournai in Belgien. Sein Vater unterstützte die früh beginnende Forscherneigung des Sohnes, indem er ihm die heute nicht mehr existente „Maininsel“ pachtete, damit dieser dort seinem Entdeckungsdrang nachgehen konnte. Bei seinen stundenlangen Kahnfahrten auf dem Main lernte er Pflanzen kennen und untersuchte einzellige Algen mikroskopisch. Als Abiturient hatte er schon ein umfangreiches Herbarium, das er später dem Straßburger Botanischen Institut hinterließ. Durch seinen frühen Kontakt zum damaligen Leiter des Senckenbergischen Instituts in Frankfurt, Georg Fresenius entwickelte De Bary sein Interesse für Algen und Pilze sowie die Arbeit am Mikroskop. Bereits mit 21 Jahren fertigte er eine Abhandlung über den Phycomyceten Achyla, die von der hervorragenden Beobachtungsgabe de Barys zeugt. Dabei zeigte er, dass die Saprolegnia-Schwärmer zwei terminale Geißeln besitzen, während die Schwärmer von Achyla zwei seitliche Geißeln tragen. Mit dieser Arbeit widerlegte er unter anderem auch den bekannten Botaniker Nathanael Pringsheim (1823–1894), der für die Saprolegnia-Schwärmer nur eine Geißel angegeben hatte. In den Jahren 1849/1850 studierte De Bary Medizin in Heidelberg und in Marburg. Ab 1850 studierte er in Berlin, wo er 1853 zum Dr. med. -
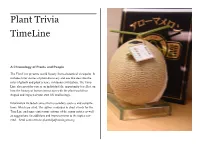
Reader 19 05 19 V75 Timeline Pagination
Plant Trivia TimeLine A Chronology of Plants and People The TimeLine presents world history from a botanical viewpoint. It includes brief stories of plant discovery and use that describe the roles of plants and plant science in human civilization. The Time- Line also provides you as an individual the opportunity to reflect on how the history of human interaction with the plant world has shaped and impacted your own life and heritage. Information included comes from secondary sources and compila- tions, which are cited. The author continues to chart events for the TimeLine and appreciates your critique of the many entries as well as suggestions for additions and improvements to the topics cov- ered. Send comments to planted[at]huntington.org 345 Million. This time marks the beginning of the Mississippian period. Together with the Pennsylvanian which followed (through to 225 million years BP), the two periods consti- BP tute the age of coal - often called the Carboniferous. 136 Million. With deposits from the Cretaceous period we see the first evidence of flower- 5-15 Billion+ 6 December. Carbon (the basis of organic life), oxygen, and other elements ing plants. (Bold, Alexopoulos, & Delevoryas, 1980) were created from hydrogen and helium in the fury of burning supernovae. Having arisen when the stars were formed, the elements of which life is built, and thus we ourselves, 49 Million. The Azolla Event (AE). Hypothetically, Earth experienced a melting of Arctic might be thought of as stardust. (Dauber & Muller, 1996) ice and consequent formation of a layered freshwater ocean which supported massive prolif- eration of the fern Azolla. -

Corals and Sponges Under the Light of the Holobiont Concept: How Microbiomes Underpin Our Understanding of Marine Ecosystems
fmars-08-698853 August 11, 2021 Time: 11:16 # 1 REVIEW published: 16 August 2021 doi: 10.3389/fmars.2021.698853 Corals and Sponges Under the Light of the Holobiont Concept: How Microbiomes Underpin Our Understanding of Marine Ecosystems Chloé Stévenne*†, Maud Micha*†, Jean-Christophe Plumier and Stéphane Roberty InBioS – Animal Physiology and Ecophysiology, Department of Biology, Ecology & Evolution, University of Liège, Liège, Belgium In the past 20 years, a new concept has slowly emerged and expanded to various domains of marine biology research: the holobiont. A holobiont describes the consortium formed by a eukaryotic host and its associated microorganisms including Edited by: bacteria, archaea, protists, microalgae, fungi, and viruses. From coral reefs to the Viola Liebich, deep-sea, symbiotic relationships and host–microbiome interactions are omnipresent Bremen Society for Natural Sciences, and central to the health of marine ecosystems. Studying marine organisms under Germany the light of the holobiont is a new paradigm that impacts many aspects of marine Reviewed by: Carlotta Nonnis Marzano, sciences. This approach is an innovative way of understanding the complex functioning University of Bari Aldo Moro, Italy of marine organisms, their evolution, their ecological roles within their ecosystems, and Maria Pia Miglietta, Texas A&M University at Galveston, their adaptation to face environmental changes. This review offers a broad insight into United States key concepts of holobiont studies and into the current knowledge of marine model *Correspondence: holobionts. Firstly, the history of the holobiont concept and the expansion of its use Chloé Stévenne from evolutionary sciences to other fields of marine biology will be discussed. -

Concerning the Cohabitation of Animals and Algae – an English Translation of K
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Infoscience - École polytechnique fédérale de Lausanne Symbiosis DOI 10.1007/s13199-016-0439-2 Concerning the cohabitation of animals and algae – an English translation of K. Brandt’s 1881 presentation BUeber das Zusammenleben von Thieren und Algen^ Thomas Krueger1 Received: 19 April 2016 /Accepted: 7 July 2016 # Springer Science+Business Media Dordrecht 2016 Abstract so, (2) is this chlorophyll of endogenous animal origin, rem- nant of ingested food, or due to the presence of chlorophyll- Keywords Symbiosis . Cnidaria . Zoochlorella . containing microorganisms? Siebold (1849) had already stat- Zooxanthella . Coral Reefs . Hydra ed that the greenish bubbles and grains in Hydra, Turbellaria and some infusoria Bare likely closely related to chlorophyll, if not identical^, but it was only later that chemical and 1 Introduction spectroscopical characterization confirmed the presence of chlorophyll in these animals (reviewed in Buchner 1953). In BThis investigation shows that self-formed chlorophyll is ab- addition to the general interest in green animals, the British sent in animals. If chlorophyll can be found in animals, it is biologist Thomas Huxley initiated another line of research, due to invading plants that have kept their morphological and when he made a rather unremarkable observation about the physiological independence^. This conclusion, published by occurrence of Bspherical bright yellow cells^ in the colonial the German botanist Karl Andreas Heinrich Brandt (1854– radiolarian Thallasicolla whileonboardtheH.M.S. 1931) in 1881, represents the final quintessence of a number Rattlesnake (Huxley 1851). Things became particularly inter- of ideas and experimental findings in the field of symbiosis esting when Leon Cienkowski reported that these yellow cells research at that time. -

The "Cycle of Life" in Ecology
The “Cycle of Life” in Ecology: Sergei Vinogradskii’s Soil Microbiology, 1885-1940 by Lloyd T. Ackert Jr., Ph.D. Whitney Humanities Center Yale University 53 Wall Street P.O. Box 208298 New Haven, CT 06520-8298 Office (203)-432-3112 [email protected] Abstract Historians of science have attributed the emergence of ecology as a discipline in the late nineteenth century to the synthesis of Humboldtian botanical geography and Darwinian evolution. In this essay, I begin to explore another, largely-neglected but very important dimension of this history. Using Sergei Vinogradskii’s career and scientific research trajectory as a point of entry, I illustrate the manner in which microbiologists, chemists, botanists, and plant physiologists inscribed the concept of a “cycle of life” into their investigations. Their research transformed a longstanding notion into the fundamental approaches and concepts that underlay the new ecological disciplines that emerged in the 1920s. Pasteur thus joins Humboldt as a foundational figure in ecological thinking, and the broader picture that emerges of the history of ecology explains some otherwise puzzling features of that discipline—such as its fusion of experimental and natural historical methodologies. Vinogradskii’s personal “cycle of life” is also interesting as an example of the interplay between Russian and Western European scientific networks and intellectual traditions. Trained in Russia to investigate nature as a super-organism comprised of circulating energy, matter, and life; over the course of five decades—in contact with scientists and scientific discourses in France, Germany, and Switzerland—he developed a series of research methods that translated the concept of a “cycle of life” into an ecologically- conceived soil science and microbiology in the 1920s and 1930s. -

A Moléstia Da Cana De Açúcar No Recôncavo Baiano: Política, Saberes, Práticas E Polêmicas Científicas (1865-1904)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS VINICIUS SANTOS DA SILVA A MOLÉSTIA DA CANA DE AÇÚCAR NO RECÔNCAVO BAIANO: POLÍTICA, SABERES, PRÁTICAS E POLÊMICAS CIENTÍFICAS (1865-1904) Tese Apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em Convênio com o Museu de Astronomia e Ciências Afins (PPGH – UNIRIO/MAST), como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em História. Área de Concentração: Instituições, Poder e Ciências Orientação: Profª. Drª. Moema de Rezende Vergara Rio de Janeiro 2019 BANCA EXAMINADORA _________________________________________________________________________ Profª. Drª. Moema de Rezende Vergara (Orientadora) Programa de Pós-Graduação em História Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-UNIRIO) Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) _________________________________________________________________________ Profª. Drª. Heloisa Maria Bertol Domingues Programa de Pós-Graduação em História Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-UNIRIO) Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) _________________________________________________________________________ Profª. Drª. Alda Lucia Heizer Escola Nacional de Botânica Tropical Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) _________________________________________________________________________ Profº. Drº. André Felipe Cândido da Silva Casa de Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS-COC-FIOCRUZ) _________________________________________________________________________ Profº. Drº. Bruno Rangel Capilé de Souza Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) Rio de Janeiro/RJ, 26 abril de 2019. DEDICATÓRIA A minha família dedico este trabalho em retribuição a todo o reconhecimento de que o nosso momento histórico é marcado pelo suor e sangue para garantir um futuro melhor. -

The Triumph of the Fungi the Triumph of the Fungi
The Triumph of the Fungi The Triumph of the Fungi A Rotten History NICHOLAS P. MONEY 2007 Oxford University Press, Inc., publishes works that further Oxford University's objective of excellence in research, scholarship, and education. Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Copyright © 2007 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Money, Nicholas P. The triumph of the fungi: a rotten history/ Nicholas P. Money. p.cm. Includes index. ISBN-13 978–0–19–518971–1 ISBN 0–19–518971–X 1. Fungal diseases of plants—History. 2. Fungi—History. I. Title. SB733 .M59 2006 632′.4—dc22 2005037223 987654321 For Adam, my stepson Preface This book is concerned with the most devastating fungal diseases in history. These are the plagues of trees and crop plants, caused by invisible spores that have reshaped entire landscapes and decimated human populations. Everyone is aware of the Irish potato famine, but while many other fungal diseases are less familiar, they have had similarly disastrous consequences. -

Entomopathogenic Fungal Endophytes
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln U.S. Department of Agriculture: Agricultural Publications from USDA-ARS / UNL Faculty Research Service, Lincoln, Nebraska 2008 Entomopathogenic fungal endophytes Fernando E. Vega United States Department of Agriculture Francisco Posada United States Department of Agriculture M. Catherine Aime United States Department of Agriculture Monica Pava-Ripoll University of Maryland Francisco Infante El Colegio de la Frontera Sur See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub Part of the Agricultural Science Commons Vega, Fernando E.; Posada, Francisco; Aime, M. Catherine; Pava-Ripoll, Monica; Infante, Francisco; and Rehner, Stephen A., "Entomopathogenic fungal endophytes" (2008). Publications from USDA-ARS / UNL Faculty. 385. https://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/385 This Article is brought to you for free and open access by the U.S. Department of Agriculture: Agricultural Research Service, Lincoln, Nebraska at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Publications from USDA-ARS / UNL Faculty by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Authors Fernando E. Vega, Francisco Posada, M. Catherine Aime, Monica Pava-Ripoll, Francisco Infante, and Stephen A. Rehner This article is available at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln: https://digitalcommons.unl.edu/ usdaarsfacpub/385 Available online at www.sciencedirect.com