Pieh, A. 2001. Testudo Graeca Soussensis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Preliminary Analysis of Correlated Evolution of Morphology and Ecological Diversification in Lacertid Lizards
Butll. Soc. Cat. Herp., 19 (2011) Preliminary analysis of correlated evolution of morphology and ecological diversification in lacertid lizards Fèlix Amat Orriols Àrea d'Herpetologia, Museu de Granollers-Ciències Naturals. Francesc Macià 51. 08402 Granollers. Catalonia. Spain. [email protected] Resum S'ha investigat la diversitat morfològica en 129 espècies de lacèrtids i la seva relació amb l'ecologia, per mitjà de mètodes comparatius, utilitzant set variables morfomètriques. La mida corporal és la variable més important, determinant un gradient entre espècies de petita i gran mida independentment evolucionades al llarg de la filogènia dels lacèrtids. Aquesta variable està forta i positivament correlacionada amb les altres, emmascarant els patrons de diversitat morfològica. Anàlisis multivariants en les variables ajustades a la mida corporal mostren una covariació negativa entre les mides relatives de la cua i les extremitats. Remarcablement, les espècies arborícoles i semiarborícoles (Takydromus i el clade africà equatorial) han aparegut dues vegades independentment durant l'evolució dels lacèrtids i es caracteritzen per cues extremadament llargues i extremitats anteriors relativament llargues en comparació a les posteriors. El llangardaix arborícola i planador Holaspis, amb la seva cua curta, constitueix l’única excepció. Un altre cas de convergència ha estat trobat en algunes espècies que es mouen dins de vegetació densa o herba (Tropidosaura, Lacerta agilis, Takydromus amurensis o Zootoca) que presenten cues llargues i extremitats curtes. Al contrari, les especies que viuen en deserts, estepes o matollars amb escassa vegetació aïllada dins grans espais oberts han desenvolupat extremitats posteriors llargues i anteriors curtes per tal d'assolir elevades velocitats i maniobrabilitat. Aquest és el cas especialment de Acanthodactylus i Eremias Abstract Morphologic diversity was studied in 129 species of lacertid lizards and their relationship with ecology by means of comparative analysis on seven linear morphometric measurements. -
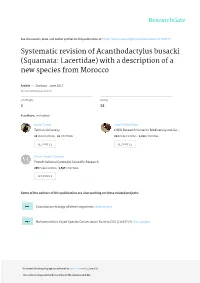
Systematic Revision of Acanthodactylus Busacki (Squamata: Lacertidae) with a Description of a New Species from Morocco
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/317568775 Systematic revision of Acanthodactylus busacki (Squamata: Lacertidae) with a description of a new species from Morocco Article in Zootaxa · June 2017 DOI: 10.11646/zootaxa.4276.3.3 CITATIONS READS 0 53 4 authors, including: Karin Tamar José Carlos Brito Tel Aviv University CIBIO Research Center in Biodiversity and Ge… 24 PUBLICATIONS 32 CITATIONS 313 PUBLICATIONS 2,333 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Pierre-André Crochet French National Centre for Scientific Research 295 PUBLICATIONS 2,587 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Evolutionary ecology of desert organisms View project Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund to CGV (11052707) View project All content following this page was uploaded by Karin Tamar on 19 June 2017. The user has requested enhancement of the downloaded file. Zootaxa 4276 (3): 357–386 ISSN 1175-5326 (print edition) http://www.mapress.com/j/zt/ Article ZOOTAXA Copyright © 2017 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) https://doi.org/10.11646/zootaxa.4276.3.3 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:CB669212-EF39-4D3B-9B87-C729FEC2E15C Systematic revision of Acanthodactylus busacki (Squamata: Lacertidae) with a description of a new species from Morocco KARIN TAMAR1,2,6, PHILIPPE GENIEZ3, JOSÉ C. BRITO4 & PIERRE-ANDRÉ CROCHET5 1The Steinhardt Museum of Natural History, Israel National Center for Biodiversity Studies, Tel Aviv University, 6997801 Tel-Aviv, Israel 2Department of Zoology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel Aviv University, 6997801 Tel Aviv, Israel 3EPHE, PSL Research University, CNRS, UM, SupAgro, IRD, INRA, UMR 5175 Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE), F-34293 Montpellier cedex 5, France 4CIBIO/InBIO, Centro de Investigacão em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, R. -

Preliminary Analysis of Correlated Evolution of Morphology and Ecological Diversification in Lacertid Lizards
Butll. Soc. Cat. Herp., 19 (2011) Preliminary analysis of correlated evolution of morphology and ecological diversification in lacertid lizards Fèlix Amat Orriols Àrea d'Herpetologia, Museu de Granollers-Ciències Naturals. Francesc Macià 51. 08402 Granollers. Catalonia. Spain. [email protected] Resum S'ha investigat la diversitat morfològica en 129 espècies de lacèrtids i la seva relació amb l'ecologia, per mitjà de mètodes comparatius, utilitzant set variables morfomètriques. La mida corporal és la variable més important, determinant un gradient entre espècies de petita i gran mida independentment evolucionades al llarg de la filogènia dels lacèrtids. Aquesta variable està forta i positivament correlacionada amb les altres, emmascarant els patrons de diversitat morfològica. Anàlisis multivariants en les variables ajustades a la mida corporal mostren una covariació negativa entre les mides relatives de la cua i les extremitats. Remarcablement, les espècies arborícoles i semiarborícoles (Takydromus i el clade africà equatorial) han aparegut dues vegades independentment durant l'evolució dels lacèrtids i es caracteritzen per cues extremadament llargues i extremitats anteriors relativament llargues en comparació a les posteriors. El llangardaix arborícola i planador Holaspis, amb la seva cua curta, constitueix l’única excepció. Un altre cas de convergència ha estat trobat en algunes espècies que es mouen dins de vegetació densa o herba (Tropidosaura, Lacerta agilis, Takydromus amurensis o Zootoca) que presenten cues llargues i extremitats curtes. Al contrari, les especies que viuen en deserts, estepes o matollars amb escassa vegetació aïllada dins grans espais oberts han desenvolupat extremitats posteriors llargues i anteriors curtes per tal d'assolir elevades velocitats i maniobrabilitat. Aquest és el cas especialment de Acanthodactylus i Eremias Abstract Morphologic diversity was studied in 129 species of lacertid lizards and their relationship with ecology by means of comparative analysis on seven linear morphometric measurements. -

Amphibians and Reptiles of the Mediterranean Basin
Chapter 9 Amphibians and Reptiles of the Mediterranean Basin Kerim Çiçek and Oğzukan Cumhuriyet Kerim Çiçek and Oğzukan Cumhuriyet Additional information is available at the end of the chapter Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.70357 Abstract The Mediterranean basin is one of the most geologically, biologically, and culturally complex region and the only case of a large sea surrounded by three continents. The chapter is focused on a diversity of Mediterranean amphibians and reptiles, discussing major threats to the species and its conservation status. There are 117 amphibians, of which 80 (68%) are endemic and 398 reptiles, of which 216 (54%) are endemic distributed throughout the Basin. While the species diversity increases in the north and west for amphibians, the reptile diversity increases from north to south and from west to east direction. Amphibians are almost twice as threatened (29%) as reptiles (14%). Habitat loss and degradation, pollution, invasive/alien species, unsustainable use, and persecution are major threats to the species. The important conservation actions should be directed to sustainable management measures and legal protection of endangered species and their habitats, all for the future of Mediterranean biodiversity. Keywords: amphibians, conservation, Mediterranean basin, reptiles, threatened species 1. Introduction The Mediterranean basin is one of the most geologically, biologically, and culturally complex region and the only case of a large sea surrounded by Europe, Asia and Africa. The Basin was shaped by the collision of the northward-moving African-Arabian continental plate with the Eurasian continental plate which occurred on a wide range of scales and time in the course of the past 250 mya [1]. -

Checklist of Amphibians and Reptiles of Morocco: a Taxonomic Update and Standard Arabic Names
Herpetology Notes, volume 14: 1-14 (2021) (published online on 08 January 2021) Checklist of amphibians and reptiles of Morocco: A taxonomic update and standard Arabic names Abdellah Bouazza1,*, El Hassan El Mouden2, and Abdeslam Rihane3,4 Abstract. Morocco has one of the highest levels of biodiversity and endemism in the Western Palaearctic, which is mainly attributable to the country’s complex topographic and climatic patterns that favoured allopatric speciation. Taxonomic studies of Moroccan amphibians and reptiles have increased noticeably during the last few decades, including the recognition of new species and the revision of other taxa. In this study, we provide a taxonomically updated checklist and notes on nomenclatural changes based on studies published before April 2020. The updated checklist includes 130 extant species (i.e., 14 amphibians and 116 reptiles, including six sea turtles), increasing considerably the number of species compared to previous recent assessments. Arabic names of the species are also provided as a response to the demands of many Moroccan naturalists. Keywords. North Africa, Morocco, Herpetofauna, Species list, Nomenclature Introduction mya) led to a major faunal exchange (e.g., Blain et al., 2013; Mendes et al., 2017) and the climatic events that Morocco has one of the most varied herpetofauna occurred since Miocene and during Plio-Pleistocene in the Western Palearctic and the highest diversities (i.e., shift from tropical to arid environments) promoted of endemism and European relict species among allopatric speciation (e.g., Escoriza et al., 2006; Salvi North African reptiles (Bons and Geniez, 1996; et al., 2018). Pleguezuelos et al., 2010; del Mármol et al., 2019). -

A Multivariate Analysis of the Fringe-Toed Lizards of the Acanthodactylus Scutellatus Group (Squamata: Lacertidae): Systematic and Biogeographical Implications
Blackwell Science, LtdOxford, UKZOJZoological Journal of the Linnean Society0024-4082The Lin- nean Society of London, 2003January 2003 1371 Original Article Revision of the Acanthodactylus scutellatus groupPierre-André Crochet et al. Zoological Journal of the Linnean Society, 2003, 137, 117–155. With 21 figures A multivariate analysis of the fringe-toed lizards of the Acanthodactylus scutellatus group (Squamata: Lacertidae): systematic and biogeographical implications PIERRE-ANDRÉ CROCHET1,2, PHILIPPE GENIEZ1 and IVAN INEICH3 1Ecole Pratique des Hautes Etudes, Laboratoire de Biogéographie et Ecologie des Vertébrés, Université Montpellier II, Place Eugène Bataillon, F-34095 Montpellier cedex 5, France 2Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, CNRS, 1919 route de Mende, F-34293 Montpellier cedex 05, France 3Muséum national d’Histoire naturelle, Laboratoire de Zoologie (Reptiles & Amphibiens), 25 rue Cuvier, F-75005 Paris, France The taxonomy of the fringe-toed lizards of the Acanthodactylus scutellatus group has long been unstable and no con- sensus exists on the systematic status of its various forms. A multivariate analysis of morphological characters, per- formed on over 1000 specimens from most of the African range of this group, allowed us to clarify the specific allocation of most of the Saharan populations included in this species group. Based on comparisons of morphology between allopatric and sympatric populations of this complex, we propose the recognition of six biological species. Our results confirm the specific status of Acanthodactylus aureus, A. dumerili, A. scutellatus, A. longipes and the recently described A. taghitensis. In addition, we re-validate A. senegalensis (occurring from Mauritania and Mali south to Senegal), which has been treated as a synonym of A. -

Patterns of Species Richness, Endemism and Environmental Gradients of African Reptiles
Journal of Biogeography (J. Biogeogr.) (2016) ORIGINAL Patterns of species richness, endemism ARTICLE and environmental gradients of African reptiles Amir Lewin1*, Anat Feldman1, Aaron M. Bauer2, Jonathan Belmaker1, Donald G. Broadley3†, Laurent Chirio4, Yuval Itescu1, Matthew LeBreton5, Erez Maza1, Danny Meirte6, Zoltan T. Nagy7, Maria Novosolov1, Uri Roll8, 1 9 1 1 Oliver Tallowin , Jean-Francßois Trape , Enav Vidan and Shai Meiri 1Department of Zoology, Tel Aviv University, ABSTRACT 6997801 Tel Aviv, Israel, 2Department of Aim To map and assess the richness patterns of reptiles (and included groups: Biology, Villanova University, Villanova PA 3 amphisbaenians, crocodiles, lizards, snakes and turtles) in Africa, quantify the 19085, USA, Natural History Museum of Zimbabwe, PO Box 240, Bulawayo, overlap in species richness of reptiles (and included groups) with the other ter- Zimbabwe, 4Museum National d’Histoire restrial vertebrate classes, investigate the environmental correlates underlying Naturelle, Department Systematique et these patterns, and evaluate the role of range size on richness patterns. Evolution (Reptiles), ISYEB (Institut Location Africa. Systematique, Evolution, Biodiversite, UMR 7205 CNRS/EPHE/MNHN), Paris, France, Methods We assembled a data set of distributions of all African reptile spe- 5Mosaic, (Environment, Health, Data, cies. We tested the spatial congruence of reptile richness with that of amphib- Technology), BP 35322 Yaounde, Cameroon, ians, birds and mammals. We further tested the relative importance of 6Department of African Biology, Royal temperature, precipitation, elevation range and net primary productivity for Museum for Central Africa, 3080 Tervuren, species richness over two spatial scales (ecoregions and 1° grids). We arranged Belgium, 7Royal Belgian Institute of Natural reptile and vertebrate groups into range-size quartiles in order to evaluate the Sciences, OD Taxonomy and Phylogeny, role of range size in producing richness patterns. -
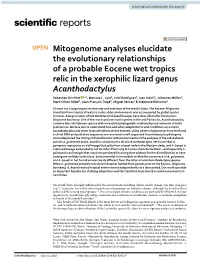
Mitogenome Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of a Probable Eocene Wet Tropics Relic in the Xerophilic Lizard
www.nature.com/scientificreports OPEN Mitogenome analyses elucidate the evolutionary relationships of a probable Eocene wet tropics relic in the xerophilic lizard genus Acanthodactylus Sebastian Kirchhof 1*, Mariana L. Lyra2, Ariel Rodríguez3, Ivan Ineich4, Johannes Müller5, Mark‑Oliver Rödel5, Jean‑François Trape6, Miguel Vences7 & Stéphane Boissinot1 Climate has a large impact on diversity and evolution of the world’s biota. The Eocene–Oligocene transition from tropical climate to cooler, drier environments was accompanied by global species turnover. A large number of Old World lacertid lizard lineages have diversifed after the Eocene– Oligocene boundary. One of the most speciose reptile genera in the arid Palearctic, Acanthodactylus, contains two sub‑Saharan species with unresolved phylogenetic relationship and unknown climatic preferences. We here aim to understand how and when adaptation to arid conditions occurred in Acanthodactylus and when tropical habitats where entered. Using whole mitogenomes from fresh and archival DNA and published sequences we recovered a well‑supported Acanthodactylus phylogeny and underpinned the timing of diversifcation with environmental niche analyses of the sub‑Saharan species A. guineensis and A. boueti in comparison to all arid Acanthodactylus. We found that A. guineensis represents an old lineage that splits from a basal node in the Western clade, and A. boueti is a derived lineage and probably not its sister. Their long branches characterize them—and especially A. guineensis—as lineages that may have persisted for a long time without further diversifcation or have undergone multiple extinctions. Environmental niche models verifed the occurrence of A. guineensis and A. boueti in hot humid environments diferent from the other 42 arid Acanthodactylus species. -
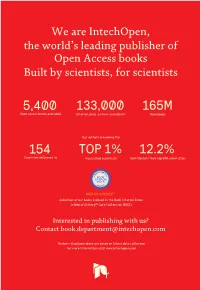
World's Largest Science, Technology & Medicine Open Access Book
We are IntechOpen, the world’s leading publisher of Open Access books Built by scientists, for scientists 5,400 133,000 165M Open access books available International authors and editors Downloads Our authors are among the 154 TOP 1% 12.2% Countries delivered to most cited scientists Contributors from top 500 universities Selection of our books indexed in the Book Citation Index in Web of Science™ Core Collection (BKCI) Interested in publishing with us? Contact [email protected] Numbers displayed above are based on latest data collected. For more information visit www.intechopen.com Chapter 9 Amphibians and Reptiles of the Mediterranean Basin Kerim Çiçek and Oğzukan Cumhuriyet Kerim Çiçek and Oğzukan Cumhuriyet Additional information is available at the end of the chapter Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.70357 Abstract The Mediterranean basin is one of the most geologically, biologically, and culturally complex region and the only case of a large sea surrounded by three continents. The chapter is focused on a diversity of Mediterranean amphibians and reptiles, discussing major threats to the species and its conservation status. There are 117 amphibians, of which 80 (68%) are endemic and 398 reptiles, of which 216 (54%) are endemic distributed throughout the Basin. While the species diversity increases in the north and west for amphibians, the reptile diversity increases from north to south and from west to east direction. Amphibians are almost twice as threatened (29%) as reptiles (14%). Habitat loss and degradation, pollution, invasive/alien species, unsustainable use, and persecution are major threats to the species. -

Padial Mauritania
Graellsia, 62(2): 159-178 (2006) COMMENTED DISTRIBUTIONAL LIST OF THE REPTILES OF MAURITANIA (WEST AFRICA) J. M. Padial1 ABSTRACT This is the first comprehensive review of the reptiles of Mauritania. It includes dis- tributional information and comments. Mauritania harbors 86 species of reptiles belon- ging to 21 families. Among these families, Colubridae and Lacertidae are the most diverse, with 14 and 13 species respectively. Other families, such as Agamidae, Gekkonidae, Scincidae or Viperidae are also well represented. Among the 80 continen- tal species, 47.5% are Saharan, 33.8% Afrotropical, 16.2% Sahelian and 2.5% Mediterranean. The marine turtles form another important group, with six species. Eight species are excluded from the country list because of old identification errors, there is not enough evidence of their presence or due to changes in political borders. Among the species expected to occur in Mauritania, at least nine may occur in Saharan environ- ments, 13 in the Sahel savannah and two may have been introduced. Key words: Distribution, checklist, Mauritania, Africa, Reptilia, Sahara, Sahel. RESUMEN Lista comentada de los reptiles de Mauritania (oeste de África) Esta es la primera lista de reptiles comentada con datos de distribución para la República Islámica de Mauritania. La fauna de reptiles de Mauritania se compone de 86 especies pertenecientes a 21 familias. Entres ellas, Colubridae y Lacertidae son las más diversas, con 14 y 13 especies respectivamente. Otras familias como Agamidae, Gekkonidae, Scincidae y Viperidae también son representativas. Entre las 80 especies continentales el 47.5% son de distribución sahariana, el 33.8% afrotropical, el 16.2% sahelianas y el 2.5% mediterráneas. -

Foraging Mode of Australolacerta Rupicola
Journal of Natural History Vol. 44, Nos. 47–48, December 2010, 2941–2953 ForagingTNAH0022-29331464-5262Journal of Natural History,History Vol. 1, No. 1, Jul 2010: pp. 0–0mode of Australolacerta rupicola (FitzSimons, 1933) (Sauria: Lacertidae): evidence of seasonal variation in an extremely active predator? SebastianS.Journal Kirchhof of Natural et al. History Kirchhofa*, Jabu Lindenb, Dennis Röddera and Klaus Richterc aBiogeography Department, Trier University, Am Wissenschaftspark 25+27, 54296 Trier, Germany; bP.O. Box 1536, Louis Trichardt, 0920 Limpopo Province, South Africa; cDepartment 1, Anhalt University of Applied Sciences, Strenzfelder Allee 28, 06406 Bernburg, Germany (Received 2 February 2010; final version received 16 June 2010) Foraging mode of the endemic Soutpansberg rock lizard (Australolacerta rupicola) was determined by (1) measuring the number of movements per minute (MPM) and the percentage time spent moving (PTM); and (2) analysing faecal samples. Furthermore, these criteria were related to diet composition, proportion of attacks initiated while moving and foraging substrate. The results are discussed in comparison to the foraging modes of 20 other lacertid species. Values for MPM and PTM as well as faecal analysis indicate an active foraging strategy for A. rupicola. Although rock living, this species mostly forages in leaf litter where it is well cam- ouflaged while actively searching for sedentary prey. Even in comparison to other active foragers of the family Lacertidae, A. rupicola displays the prototypic behaviour of a widely foraging lizard with very high PTM and very low MPM. Keywords: Soutpansberg; South Africa; foraging mode; autecology Introduction Traditionally, carnivorous lizards have been divided into active, widely foraging predators and ambush or sit-and-wait predators (Pianka 1966). -
Two New Types of Noose for Capturing Herps
Acta Herpetologica 5(2): 259-263, 2010 Two new types of noose for capturing herps Enrique García-Muñoz1, 2, Neftalí Sillero3 1 CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Campus Agrário de Vairão, P-4485-661, Vairão, Portugal. Corresponding author. E-mail: [email protected] 2 Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Campus de las Lagunillas s/n. Uni- versidad de Jaén. E-23071, Jaén, Spain. 3 Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais (CICGE); Universidade do Porto, Faculdade de Ciências, Rua do Campo Alegre, 687, P-4169-007, Porto, Portugal. E-mail: [email protected] Submitted on 2010, 20th July; Revised on 2010, 27th October; Accepted on 2010, 15th November. Abstract. We present two new types of noose for capturing herps, which allow adapt- ing the size of the loop to the size of prey rapidly. We use a plastic ring to make the loop: the thread moves perfectly without any impediment or friction, and remains in good conditions for a longer time. The plastic ring can be made during fieldwork. Both new types of noose increase capture effectiveness, as it is possible to noose dif- ferent types of preys with a simple and rapid adaptation of the loop. We have tested this methodology in different species of lacertids, some snakes under rocks, and also some amphibians. Keywords. Capture herps, loop, lizard, pastic ring. Multiple factors affect capture success, including animal body size, trap avoidance behaviour, and weather. Many techniques exist for sampling a vast array of lizard species, including noosing poles, grab sticks, scoop buckets, sticky sticks, rubber bands, sticky traps, and habitat traps (Bertram and Cogger, 1971; Bauer and Sadlier, 1992; Witz, 1996; Durtsche, 1996; Downes and Porges, 1998; Whiting, 1998; Hamilton et al., 2007).