Bernhard Waldenfels
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

World Philosophies in Dialogue: a Shared Wisdom?
Confluence Online Journal of World Philosophies Verlag Karl Alber Freiburg/Munich Vol. 2 · 2015 ISSN 2199-0360 · ISBN 978-3-495-46802-9 Confluence: Online Journal of World Philosophies Editors Confluence: Online Journal of World Philosophies is a bi-annual, Monika Kirloskar-Steinbach (University Konstanz, Germany) peer-reviewed, international journal dedicated to comparative Geeta Ramana (University Mumbai, India) thought. It seeks to explore common spaces and differences between James Maffie (University of Maryland, USA) philosophical traditions in a global context. Without postulating cul- tures as monolithic, homogenous, or segregated wholes, it aspires to address key philosophical issues which bear on specific methodologi- Manuscript Editor cal, epistemological, hermeneutic, ethical, social, and political ques- tions in comparative thought. Confluence aims to develop the con- James Garrison (University of Vienna, Austria) tours of a philosophical understanding not subservient to dominant paradigms and provide a platform for diverse philosophical voices, including those long silenced by dominant academic discourses and Advisory Board institutions. Confluence also endeavors to serve as a juncture where specific philosophical issues of global interest may be explored in an Robert Bernasconi (Pennsylvania State University, USA) imaginative, thought-provoking, and pioneering way. Claudia Bickmann (University of Cologne, Germany) We welcome innovative and persuasive ways of conceptualizing, Anat Biletzki (Quinnipiac University, USA) articulating, and representing intercultural encounters. Contribu- Jonardon Ganeri (New York University, Abu Dhabi, UAE) tions should be able to facilitate the development of new perspectives Raghunath Ghosh (University of North Bengal, India) on current global thought-processes and sketch the outlines of salient Peter S. Groff (Bucknell University, USA) future developments. -

Confluence 2015 G 1..292
Confluence Online Journal of World Philosophies Verlag Karl Alber Freiburg/Munich Vol. 2 · 2015 ISSN 2199-0360 · ISBN 978-3-495-46802-9 Confluence: Online Journal of World Philosophies Editors Confluence: Online Journal of World Philosophies is a bi-annual, Monika Kirloskar-Steinbach (University Konstanz, Germany) peer-reviewed, international journal dedicated to comparative Geeta Ramana (University Mumbai, India) thought. It seeks to explore common spaces and differences between James Maffie (University of Maryland, USA) philosophical traditions in a global context. Without postulating cul- tures as monolithic, homogenous, or segregated wholes, it aspires to address key philosophical issues which bear on specific methodologi- Manuscript Editor cal, epistemological, hermeneutic, ethical, social, and political ques- tions in comparative thought. Confluence aims to develop the con- James Garrison (University of Vienna, Austria) tours of a philosophical understanding not subservient to dominant paradigms and provide a platform for diverse philosophical voices, including those long silenced by dominant academic discourses and Advisory Board institutions. Confluence also endeavors to serve as a juncture where specific philosophical issues of global interest may be explored in an Robert Bernasconi (Pennsylvania State University, USA) imaginative, thought-provoking, and pioneering way. Claudia Bickmann (University of Cologne, Germany) We welcome innovative and persuasive ways of conceptualizing, Anat Biletzki (Quinnipiac University, USA) articulating, and representing intercultural encounters. Contribu- Jonardon Ganeri (New York University, Abu Dhabi, UAE) tions should be able to facilitate the development of new perspectives Raghunath Ghosh (University of North Bengal, India) on current global thought-processes and sketch the outlines of salient Peter S. Groff (Bucknell University, USA) future developments. -

Heidegger and Theology Philosophy and Theology Series
Heidegger and Theology PHILOSOPHY AND THEOLOGY SERIES Other titles in the Philosophy and Theology series include: Adorno and Theology, Christopher Craig Brittain Badiou and Theology, Frederiek Depoortere Derrida and Theology, Steven Shakespeare Foucault and Theology, Jonathan Tran Girard and Theology, Michael Kirwan Habermas and Theology, Maureen Junker-Kenny Hegel and Theology, Martin J. De Nys Kant and Theology, Pamela Sue Anderson and Jordan Bell Kierkegaard and Theology, Murray Rae Levinas and Theology, Nigel Zimmerman Merleau-Ponty and Theology, Christopher Ben Simpson Nietzsche and Theology, Craig Hovey Simone Weil and Theology, A. Rebecca Rozelle-Stone Vattimo and Theology, Thomas G. Guarino Wittgenstein and Theology, Tim Labron Žižek and Theology, Adam Kotsko Heidegger and Theology Judith Wolfe LONDON • NEW DELHI • NEW YORK • SYDNEY Bloomsbury T&T Clark An imprint of Bloomsbury Publishing Plc 50 Bedford Square 1385 Broadway London New York WC1B 3DP NY 10018 UK USA www.bloomsbury.com Bloomsbury is a registered trade mark of Bloomsbury Publishing Plc First published 2014 © Judith Wolfe, 2014 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers. Judith Wolfe has asserted her right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as Author of this work. No responsibility for loss caused to any individual or organization acting on or refraining from action as a result of the material in this publication can be accepted by Bloomsbury or the author. -

Welt Als Phänomen Anmerkungen Zu Husserl, Heidegger Und Rombach1
Original paper UDC 165.62(045) doi: 10.21464/sp34210 Received: 24 July 2019 Niels Weidtmann Eberhard Karls Universität Tübingen, Forum Scientiarum, Doblerstraße 33, DE–72074 Tübingen [email protected] Welt als Phänomen Anmerkungen zu Husserl, Heidegger und Rombach1 Zusammenfassung Einen Beitrag über Welt als Phänomen zu schreiben, impliziert die Annahme, dass die Welt überhaupt ein Phänomen im Sinne der philosophischen Phänomenologie ist. Das ist aber gerade in der Phänomenologie selbst nicht unstrittig. Dem husserlschen Verständnis nach kann die Welt nämlich tatsächlich nicht selbst Phänomen sein, weil jedes Phänomen in einem Verweisungszusammenhang, d.h. in einem Horizont erscheint, die Welt selbst aber gerade nicht. Die Welt ist der äußerste Horizont und kann daher nicht über sich hinaus auf einen weiteren Horizont verweisen. Daher ist es keineswegs selbstverständlich zu be- haupten, dass die Welt als Phänomen betrachtet werden kann. In meinem Beitrag werde ich nun allerdings noch über die Annahme, dass die Welt ein Phänomen ist, hinausgehen und zu zeigen versuchen, dass sie in Wirklichkeit das Phänomen par excellence ist. In gewisser Weise ist die Welt das einzige Phänomen überhaupt, weil sie nicht nur allem, was in ihr erscheint, seinen besonderen Sinn verleiht, sondern sich dabei zugleich selbst je anders, nämlich diesem besonderen Sinn entsprechend zeigt. Das will ich insbesondere mit Heideg- ger und Rombach zu zeigen versuchen. Auf diese Weise hoffe ich, zumindest einige Aspekte einer phänomenologischen Analyse von „Welt“ offenzulegen. Schlüsselwörter Welt, Sinn, Phänomenologie, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Heinrich Rombach, Maurice Merleau-Ponty „Der Begriff der Welt bzw. das damit bezeichnete Phänomen ist das, was bis- her in der Philosophie überhaupt noch nicht erkannt ist“, so Martin Heideg- ger.2 Deshalb sei „die Aufklärung des Welt-Begriffs (…) eine der zentralsten Aufgaben der Philosophie“. -

Eder Soares Santos Paths of Science of Man in Heidegger
Eder Soares Santos Paths of Science of Man in Heidegger LIBRI NIGRI 80 Edited by Hans Rainer Sepp Editorial Board Suzi Adams · Adelaide │ Babette Babich · New York │ Kimberly Baltzer-Jaray · Wa- terloo, Ontario │ Damir Barbarić · Zagreb │ Marcus Brainard · London │ Martin Cajthaml · Olomouc │ Mauro Carbone · Lyon │ Chan Fai Cheung · Hong Kong │ Cristian Ciocan · Bucure şti │ Ion Copoeru · Cluj-Napoca │ Renato Cristin · Trieste │ Eddo Evink · Groningen │ Matthias Flatscher · Wien │ Dimitri Ginev · Sofia │ Jean-Christophe Goddard · Toulouse │ Andrzej Gniazdowski · Warszawa │ Ludger Hagedorn · Wien │ Seongha Hong · Jeollabukdo │ Edmundo Johnson · Santiago de Chile │ René Kaufmann · Dresden │ Vakhtang Kebuladze · Kyjiw │ Dean Komel · Ljubljana │ Pavlos Kontos · Patras │ Kwok-ying Lau · Hong Kong │ Mette Lebech · Maynooth │ Nam-In Lee · Seoul │ Monika Małek · Wrocław │ Balázs Mezei · Buda- pest │ Viktor Molchanov · Moskwa │ Liangkang Ni · Hangzhou │ Cathrin Nielsen · Frankfurt am Main │ Ashraf Noor · Jerusalem │ Karel Novotný · Praha │ Markus Ophälders · Verona | Luis Román Rabanaque · Buenos Aires │ Rosemary Rizo- Patrón de Lerner · Lima │ Kiyoshi Sakai · Tokyo │ Javier San Martín · Madrid │ Alexander Schnell · Paris │ Marcia Schuback · Stockholm │ Agustín Serrano de Haro · Madrid │ Tatiana Shchyttsova · Vilnius │ Olga Shparaga · Minsk │ Michael Staudigl · Wien │ Georg Stenger · Wien │ Silvia Stoller · Wien │ Ananta Sukla · Cuttack │ Toru Tani · Kyoto │ Detlef Thiel · Wiesbaden │ Lubica Ucnik · Perth │ Pol Vande- velde · Milwaukee │ Chung-chi -

Kritik Zwischen Sorge Und Gelassenheit Grundformen
Kritik zwischen Sorge und Gelassenheit Grundformen ethischer Praxis im Denken Martin Heideggers und Michel Foucaults Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt von Marcel Mietzel (M.A.) 10318 Berlin 1. Gutachterin: Prof. Dr. Hilge Landweer 2. Gutachter: Prof. Dr. Gunter Gebauer eingereicht im Juni 2018 Tag der Disputation: 20. Mai 2019 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung........................................................................................................................................3 1.1 Zwischenbilanz zur Forschung.............................................................................................14 1.2 Methodische Vorbemerkungen.............................................................................................37 2. Zum ethos der Kritik bei Foucault und Heidegger...................................................................49 2.1 Zum Begriff ethos..................................................................................................................63 2.2 Ethos bei Heidegger .............................................................................................................69 2.3 Aufenthalt im Sein ................................................................................................................78 2.4 Ethos bei Foucault ................................................................................................................89 -
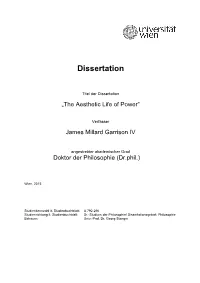
Dissertation FINAL Submission
Dissertation Titel der Dissertation „The Aesthetic Life of Power“ Verfasser James Millard Garrison IV angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr.phil.) Wien, 2015 Studienkennzahl lt. Studienbuchblatt: A 792 296 Studienrichtung lt. Studienbuchblatt: Dr.-Studium der Philosophie/ Dissertationsgebiet: Philosophie Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Georg Stenger Plagiarism Declaration (Plagiatserklärung) Hiermit erkläre ich, die vorgelegte Arbeit selbständig verfasst und ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommenen Textpassagen und Gedankengänge sind durch genaue Angabe der Quelle in Form von Anmerkungen bzw. In-Text-Zitationen ausgewiesen. Dies gilt auch für Quellen aus dem Internet, bei denen zusätzlich URL und Zugriffsdatum angeführt sind. Mir ist bekannt, dass jeder Fall von Plagiat zur Nicht-Bewertung der gesamten Lehrveranstaltung führt und der Studienprogrammleitung gemeldet werden muss. Ferner versichere ich, diese Arbeit nicht bereits andernorts zur Beurteilung vorgelegt zu haben. James Garrison Wien, 1. Juli 2015 Table of Contents Introduction (I) Subjectivation (II) Autonomy (III) Ritual Propriety - Lǐ (IV) Subjectality (V) Technique in Appearance (VI) Somaesthetics Conclusion Intercultural and Interdisciplinary Work: A Statement on Method a. Rhizomes, Embryos, and Growth in Between b. Intercultural Philosophy c. Growing the Rhizome (I) Subjectivation a. Preliminary Remarks: Butler on Subjectivation b. Foucault’s Prison: Subjectivation in the Panopticon c. Hailed into Existence: Interpellation d. Misrecognition and Limited Freedom from Sign Chains e. Kantian Responses to Subjectivation f. Kant on Purposiveness and the Artwork’s Negative Freedom g. Hegel on the Artisan and Recognition h. Nietzsche on the Artistically Creating Subject i. Art as Another “Other” and Novelty in Self-Recognition Conclusion (II) Autonomy and Appearance in Artful Ritual Practice a. -

Mimesis International
MIMESIS INTERNATIONAL HASEKURA LEAGUE INTERCULTURAL STUDIES EDITIONS n. 1 Editorial Board Raffaele Milani (University of Bologna), Rolando Minuti (University of Florence), Ikuko Sagiyama (University of Florence), Andreas Niehaus (Ghent University), Judit Arokay (Heidelberg University), Harald Fuess (Heidelberg University), Ivo Smits (Leiden University), Franco Mazzei (University of Naples “L’Orientale”), Giangiorgio Pasqualotto (University of Padua), Matilde Mastrangelo (Sapienza University of Rome), Glenn Hook (University of Sheffield), Akihiro Ozaki 尾崎彰宏 (Tohoku University), Ryūsaku Nagaoka 長岡龍作 (Tohoku University), Hiroo Satō 佐藤弘夫 (Tohoku University), Yoshimichi Satō 佐藤嘉倫 (Tohoku University), Akinori Takahashi 高橋章則 (Tohoku University), Paul Ziche (Utrecht University), Bonaventura Ruperti (Ca’ Foscari University of Venice), Georg Stenger (University of Vienna) HOW TO LEARN? 学びの作法 NIPPON/JAPAN AS OBJECT, NIPPON/JAPAN AS METHOD 対象としてニッポン、方 法としてニッポン Acts of the 1st Symposium of the Hasekura League University of Florence Palazzo Marucelli-Fenzi, 29-30 October 2015 Edited by Christopher Craig, Enrico Fongaro, and Akihiro Ozaki MIMESIS INTERNATIONAL © 2016 – MIMESIS INTERNATIONAL www.mimesisinternational.com e-mail: [email protected] Isbn: 9788869770524 Book series: Hasekura League Intercultural Studies Editions, n. 1 © MIM Edizioni Srl P.I. C.F. 02419370305 TABLE OF CONTENTS GREETING ADDRESS by Luigi Dei 11 OPENING REMARKS by Toshiya Ueki 植木俊哉 15 Executive Vice President of Tohoku University KEYNOTE LECTURE THE BIRTH OF GHOSTS.