Download Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Neue Adels-Bibliographie: Neuerscheinungen 1
Bill: Neue Adels-Bibliographie: Neuerscheinungen 1. Quartal 2021 und Nachträge 2000-2020 (Supplement) Dr. phil. Claus Heinrich Bill, M.A., M.A., B.A.: NeueNeue Adels-Adels- BibliographieBibliographie Arbeitspapier der Neuerscheinungen des 1. Quartals (Jänner bis März) 2021 mitsamt Nachträgen für 2000 bis 2020 der Monographien, Sammelbände und Aufsätze zum Adel in den deutschsprachigen Ländern. Die Inhalte dieser Quartals-Liste werden bei ihrem Erscheinen zugleich in den Hauptband eingefügt. Zweck der vorliegenden Liste ist es, Forschenden ein aktuelles Monitoring über die Novitäten zu geben. Herausgegeben vom Institut Deutsche Adelsforschung Forstweg 14 in 24105 Kiel - Düsternbrook im Selbstverlag des Instituts Deutsche Adelsforschung in Sonderburg © April 2021 1 / 8 Bill: Neue Adels-Bibliographie: Neuerscheinungen 1. Quartal 2021 und Nachträge 2000-2020 (Supplement) Achnitz, Wolfgang (Hg.): Wappen als Zeichen. Mittelalterliche Heraldik aus kommunikations- und zeichentheoretischer Perspektive, Berlin 2006, 209 Seiten [Aufsatzband mit sieben Beiträgen, die naturgemäß auch den Adel tangieren]. Aichinger, Philipp: Mit Adelstitel in den Arrest? Was künftig passieren kann. Wird das Adelsaufhebungsgesetz weiter- hin nicht novelliert, darf man Verstöße entweder gar nicht oder nur noch sehr hart sanktionieren, in: Die Presse (Wien), Ausgabe vom 7. November 2019, Seite 4 [betrifft den Fall Karl Habsburg und dessen Vorgehen wider das Adelsaufhe- bungsgesetz von 1919]. Aichinger, Philipp: Wo die Prinzenrolle noch erlaubt ist, in: Die Presse (Wien), Ausgabe vom 27. Dezember 2019, Seite 4 [betrifft Grundbucheinträge mit ehemaligem Adelstitel in Österreich; ferner den Fall von Karl Habsburg und dessen Klage wider das Adelsaufhebungsgesetz 1919]. Andermann, Kurt: Die Vornehmen in der Gemeinde. Überlegungen zu dörflichen Oberschichten im deutschen Südwes- ten während des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Gustav Pfeifer / Kurt Andermann (Hg.): Soziale Mobili- tät in der Vormoderne. -

Milch Casefertig.Rtf
TRIALS OF WAR CRIMINALS BEFORE THE NUERNBERG MILITARY TRIBUNALS UNDER CONTROL COUNCIL LAW No. 10 VOLUME II NUERNBERG OCTOBER 1946-APRIL 1949 ________ For sale by the Superintendent of Documents, U. S. Government Printing Office Washington 25, D. C. - Price $2.75 (Buckram "The Milch Case " CASE NO. 2 MILITARY TRIBUNAL NO. II THE UNITED STATES OP AMERICA —against — ERHARD MILCH VII.JUDGMENT........................................................................................................................ 5 A. Opinion and Judgment of the United States Military Tribunal II* ................................... 5 COUNT TWO.................................................................................................................... 5 COUNT ONE..................................................................................................................... 9 COUNT THREE .............................................................................................................. 18 SENTENCE ............................................................................................................................. 22 B. Concurring Opinion by Judge Michael A. Musmanno.................................................... 23 COUNT ONE................................................................................................................... 23 COUNT TWO.................................................................................................................. 23 COUNT THREE ............................................................................................................. -

Trials of War Criminals Before Nuernberg
JUDGMENT A. Opinion and Judgment of the United States Military Tribunal II * The indictment in this case contains three counts, which may be summarized as follows: Count One: War crimes, involving murder, slave labor, de- portation of civilian population for slave labor, cruel and inhuman treatment of foreign laborers, and the use of prisoners of war in war operations by force and compulsion. Count Two: War crimes, involving murder, subjecting involun- tary victims to low-pressure and freezing experiments resulting in torture and death. Count Three: Crimes against humanity, involving murder and the same unlawful acts specified in counts one and two against German nationals and nationals of other countries. For reasons of its own, the Tribunal will first consider counts two and one, in that order, followed by consideration of count three. COUNT TWO More in detail, this count alleges that the defendant was a principal in, accessory to, ordered, abetted, took a consenting part in and was connected with, plans and enterprises involving medi- cal experiments without the subjects' consent, in the course of which experiments, the defendant, with others, perpetrated mur- ders, brutalities, cruelties, tortures, and other inhuman acts. The so-called medical experiments consisted of placing the subject in an airtight chamber in which the air pressure is mechanically reduced so that it is comparable with the pressure to which an aviator is subjected at high altitudes, and in experimenting upon the effect of extreme dry and wet cold upon the human body. For these experiments inmates of the concentration camp at Dachau were selected. These inmates presented a motley group of pris- oners of war, dissenters from the philosophy of the National Socialist Party, Jews, both from Germany and the eastern coun- tries, rebellious or indifferent factory workers, displaced civilians from eastern occupied countries, and an undefined group known as "asocial or undesirable persons." * Concurring opinions were filed by Judge Musmanno, see PP, 737-869, and by Judge Phillips, see PP. -

THE RISE and FALL of the Luftwaffe
David Irving THE RISE AND FALL OF THE Luftwaffe The Life of Field Marshal Erhard Milch F FOCAL POINT Copyright © by David Irving Electronic version copyright © by Parforce UK Ltd All rights reserved No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. Copies may be downloaded from our website for research purposes only. No part of this publication may be commercially reproduced, copied, or transmitted save with written permission in accordance with the provisions of the Copyright Act (as amended). Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. CONTENTS Introduction .........................................................................vi Acknowledgements...............................................................ix Air Power Conserved Death of a Rich Uncle, Death of a Rich Aunt ...................... The Luftwaffe Reborn .......................................................... More Bluff than Blood......................................................... World War Too Soon The Rainmaker ..................................................................... A Question of Time ............................................................ ‘If Eight Million Go Mad . .’............................................. A New Campaign................................................................ Exit a Hero.......................................................................... The -
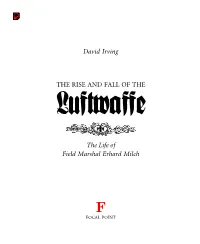
THE RISE and FALL of the Luftwaffe
David Irving THE RISE AND FALL OF THE Luftwaffe The Life of Field Marshal Erhard Milch F FOCAL POINT Copyright © by David Irving Electronic version copyright © by Parforce UK Ltd All rights reserved No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. Copies may be downloaded from our website for research purposes only. No part of this publication may be commercially reproduced, copied, or transmitted save with written permission in accordance with the provisions of the Copyright Act (as amended). Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. CONTENTS Introduction .........................................................................vi Acknowledgements...............................................................ix Air Power Conserved Death of a Rich Uncle, Death of a Rich Aunt ...................... The Luftwaffe Reborn .......................................................... More Bluff than Blood......................................................... World War Too Soon The Rainmaker ..................................................................... A Question of Time ............................................................ ‘If Eight Million Go Mad . .’............................................. A New Campaign................................................................ Exit a Hero.......................................................................... The -

Skulptur Projekte Archiv Title Works Public Collection %
Skulptur Projekte Archiv https://www.skulptur-projekte-archiv.de title works Public Collection % 1977 Skulptur Ausstellung in Münster 1977 July 03 – November 13 8 3 37.5% Klaus Bußmann Kasper König Norbert Nobis Brigitte Kühn, Petra Haufschild Sculpture Exhibition in Münster, 1977 exhibition director projects exhibition assistant exhibition office 1987 Skulptur Projekte in Münster 1987 June 14 – October 04 53 21 39.6% Klaus Bußmann Kasper König Friedrich Meschede, Ulrich Wilmes Sculpture Projects in Münster, 1987 concept and exhibition director concept and exhibition director exhibition office and project support 1997 Skulptur. Projekte in Münster 1997 June 22 – September 28 66 9 13.6% Klaus Bußmann Kasper König Florian Matzner Ulrike Groos Claudia Büttner, Barbara Engelbach, Martina Ward Sculpture. Projects in Münster 1997 director, Landesmuseum curator project director exhibition office, manager exhibition office 2007 skulptur projekte münster 07 June 17 – September 30 33 8 24.2% Kasper König Brigitte Franzen, Carina Plath Christine Litz sculpture projects muenster 07 curator curator project management 2017 Skulptur Projekte Münster 2017 June 10 – October 01 35 6 17.1% Kasper König Britta Peters, Marianne Wagner Imke Itzen Sculpture Projects Münster 2017 artistic director curator managing director 195 47 24.1% https://www.skulptur-projekte- Skulptur Ausstellung in Münster 1977 archiv.de artist title title (English) year material Location Owner artist Concrete sculpture Outer ring: height 0.9 m, width 0.6 m, diameter 15 Lake Aa meadows -

19 Disintegration
19 Disintegration Doom did not descend on the Third Reich with a single blow. It struck at irregular intervals and shifted from one theatre to another. In between, there were moments of relief during which Speer, Goebbels and the rest did their best to rekindle the flame of fanatical belief. July 1943 had seen a nightmarish coincidence of setbacks on every front: in the air war, in Italy and at Kursk. In the East, the six months that followed brought a seemingly endless retreat. Nevertheless, by frantic manoeuvr- ing, Army Group South somehow managed to end 1943 still in control of the vital iron and metal ore deposits of the Ukraine. 1 This kept alive the hopes of the German war economy, at least for a few more months. Even in Italy, Mussolini's demise did not spell immediate calamity. Making best use of the impassable terrain and Allied caution, a modest Wehrmacht contingent of 20 divisions was able to stop the British 8th Army well short of Rome and to contain the under-strength American landing at Anzio. 2 Meanwhile, as the autumn wore on, the nightmare of Hamburg lifted. Instead of concentrating on industrial targets in western Germany, RAF bomber command exhausted itself in the per- verse attempt to 'win the war' by wrecking Berlin. 3 There were nights when British aim was good and terrible damage was done to the 'big city'. On 22 November 1943 Harris's bombers killed 3,500 people, left 400,000 homeless and scored direct hits on the administrative centre of German government, including the offices of Speer's Ministry and army procurement. -

Gedruckte Traueranzeigen Des Deutschen Adels 1912-2009
Gedruckte Todesanzeigen deutscher Adeliger 1912-2009 Claus Heinrich Bill M.A. B.A.: Gedruckte Traueranzeigen des deutschen Adels 1912-2009 Zusammengestellt vom Institut Deutsche Adelsforschung (Kiel). Möchten Sie einzelne Quellennachweise zu den folgenden Vorkommen beziehen? Dann richten Sie bitte eine Anfrage an unsere Mail-Adresse: [email protected] Historische Todesanzeigen, die aus Anlaß des Ablebens von Adeligen aus deutschen Ländern der Jahre 1912 bis 2009 gedruckt worden sind, können als wertvolle Quellen für die Ahnenforschung, die Familienforschung, aber auch die wissenschaftliche Forschung, gelten. Die hier präsentierte Liste nimmt sich dieser bisher vernachlässigten Quellengruppe an und erschließt bibliographisch den Quellenbestand. Mithilfe dieses Register-Vorhabens wird jetzt dieser Massenbestand erschließbar gemacht. Denn weil im Gotha und seinen Nachfolgern nicht alle Familienstammfolgen und „Stammbäume“ erschienen sind, die der deutsche Adels aufzuweisen hat, bilden Todesanzeigen eine gute Ergänzung zu den Personaldaten des deutschen Adels an. Sterbedaten und auch die Namen von Hinterbliebenen lassen sich hierüber sehr gut ermitteln. Die hier präsentierten Register wurden zwischen November 2008 und April 2009 erstellt. Benötigt wurden dazu rund 126 Arbeitsstunden in der Kieler Landesbibliothek und entstanden sind dabei Register zu 19.228 Anzeigen, die aus verschiedenen deutschsprachigen Zeitschriften, Tages-, und Wochenzeitungen zusammengestellt worden sind. Sie alle stammen aus dem Zeitraum der Jahre 1912 bis 2009. Zu -

Nuernberg War Crimes Trials Interrogations, 1946-1949
Publication Number: M-1019 Publication Title: Records of the United States Nuernberg War Crimes trials Interrogations, 1946-1949 Date Published: 1977 RECORDS OF THE UNITED STATES NUERNBERG WAR CRIMES TRIALS INTERROGATIONS, 1946-1949 On the 91 rolls of this microfilm publication are reproduced nearly 15,000 pretrial interrogation transcripts, summaries, and related records of over 2,250 individuals. The interrogation records were compiled by the Interrogation Branch of the Evidence Division of the Office, Chief of Counsel for War Crimes (OCCWC). These records were used primarily in the prosecution of 185 officials or citizens of the Third Reich in the 12 separate proceedings listed below that were held before U.S. Military Tribunals I-VI from 1946 to 1949 at Nuernberg in the U.S. Zone of Occupation in Germany. No. of Case No. United States v. Popular Name Defendants 1 Karl Brandt et al. Medical Case 23 2 Erhard Milch Milch Case 1 (Luftwaffe) 3 Josef Altstoetter Justice Case 16 et al. 4 Oswald Pohl et al. Pohl Case (SS) 18 5 Friedrich Flick Flick Case 6 et al. (Industrialist) 6 Carl Krauch et al. I. G. Farben Case 24 (Industrialist) 7 Wilhelm List et al. Hostage Case 12 8 Ulrich Greifelt RuSHA Case (SS) 14 et al. 9 Otto Ohlendorf Einsatzgruppen 24 et al. Case (SS) 10 Alfried Krupp Krupp Case 12 et al. (Industrialist) 11 Ernst von Weizscrecker Ministries Case 21 Et al. 12 Wilhelm von Leeb High Command 14 et al. Case Authority for the proceedings of the International Military Tribunal (IMT) against the major Nazi war criminals derived from the Declaration on German Atrocities (Moscow Declaration) released November 1, 1943, Executive Order 9547 of May 2, 1945, the London Agreement of August 8, 1945, the Berlin Protocol of October 6, 1945, and the IMT Charter.