Andreas E. Eckl Konfrontation Und Kooperation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Namibia Country Operational Plan COP 2017 Strategic Direction
Namibia Country Operational Plan COP 2017 Strategic Direction Summary April 28, 2017 Table of Contents Abbreviations and Acronyms…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……..………..….4 1.0 Goal Statement…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………….………6 2.0 Epidemic, Response, and Program Context…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………….8 2.1 Summary Statistics, Disease Burden and Epidemic Profile…………..………….…………..…………..……………………..8 2.2 Investment Profile………...…………..….………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………………..20 2.3 Sustainability Profile…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……….……..25 2.4 Alignment of PEPFAR Investments Geographically to Burden of Disease………..…………..……….….…..………27 2.5 Stakeholder Engagement..………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…..………..……….31 3.0 Geographic and Population Prioritization…………..…………..…………..…………..…………..…………..………..…..…………..34 4.0 Program Activities for Epidemic Control in Scale-up Locations and Populations…………..………..…..…………39 4.1 Targets for Scale-up Locations and Populations…….…..…………..…………..…………..…………..……………..…………39 4.2 Priority Population Prevention…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……….…..………….45 4.3 Voluntary Medical Male Circumcision (VMMC) .…….…..…………..…………..………………..…………..………………..47 4.4 Preventing Mother-to-Child Transmission (PMTCT) …………..…………..………..…………..…………..……..………..48 4.5 HIV Testing Services (HTS) ………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………….…..49 4.6 Facility and Community-based Care and Support ………..…………..…………..…………..…………..……………….…….51 -
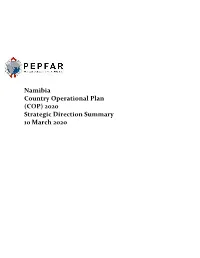
Namibia Country Operational Plan (COP) 2020 Strategic Direction Summary 10 March 2020
Namibia Country Operational Plan (COP) 2020 Strategic Direction Summary 10 March 2020 Table of Contents 1.0 Goal Statement 2.0 Epidemic, Response, and Updates to Program Context 2.1 Summary statistics, disease burden, and country profile 2.2 New Activities and Areas of Focus for COP20, Including Focus on Client Retention 2.3 Investment profile 2.4 National sustainability profile update 2.5 Alignment of PEPFAR investments geographically to disease burden 2.6 Stakeholder engagement 3.0 Geographic and population prioritization 4.0 Client-centered Program Activities for Epidemic Control 4.1 Finding the missing, getting them on treatment 4.2 Retaining clients on treatment and ensuring viral suppression 4.3 Prevention, specifically detailing programs for priority programming 4.4 Additional country-specific priorities listed in the planning level letter 4.5 Commodities 4.6 Collaboration, Integration, and Monitoring 4.7 Targets for scale-up locations and populations 4.8 Cervical Cancer Programs 4.9 Viral Load and Early Infant Diagnosis Optimization 5.0 Program Support Necessary to Achieve Sustained Epidemic Control 6.0 USG Management, Operations and Staffing Plan to Achieve Stated Goals Appendix A - Prioritization Appendix B - Budget Profile and Resource Projections Appendix C - Tables and Systems Investments for Section 6.0 Appendix D – Minimum Program Requirements 2 | P a g e Abbreviations and Acronyms AGYW Adolescent Girls and Young Women (aged 15-24) ANC Antenatal Clinic APR Annual Progress Report ART Antiretroviral Therapy ARV Antiretroviral -

Namibia Country Operational Plan 2019 Strategic Direction Summary April 5, 2019
Namibia Country Operational Plan 2019 Strategic Direction Summary April 5, 2019 Table of Contents 1.0 Goal Statement 2.0 Epidemic, Response, and Program Context 2.1 Summary statistics, disease burden and country profile 2.2 Investment profile 2.3 National sustainability profile update 2.4 Alignment of PEPFAR investments geographically to disease burden 2.5 Stakeholder engagement 3.0 Geographic and population prioritization 4.0 Program Activities for Epidemic Control in Scale-up Locations and Populations 4.1 Finding the missing, getting them on treatment, and retaining them 4.2 Prevention, specifically detailing programs for priority programming 4.3 Additional country-specific priorities listed in the planning level letter 4.4 Commodities 4.5 Collaboration, Integration and Monitoring 4.6 Targets for scale-up locations and populations 5.0 Program Activities for Epidemic Control in Attained and Sustained Locations and Populations 5.1 COP19 programmatic priorities 5.2 Targets for attained and sustained locations and populations 5.3 Establishing service packages to meet targets in attained and sustained districts 6.0 Program Support Necessary to Achieve Sustained Epidemic Control 7.0 USG Management, Operations and Staffing Plan to Achieve Stated Goals Appendix A - Prioritization Appendix B- Budget Profile and Resource Projections Appendix C- Tables and Systems Investments for Section 6.0 Appendix D – Minimum Program Requirements Appendix E – Faith and Community Initiative (as applicable) 2 | P a g e Abbreviations and Acronyms AGYW Adolescent -

When Will the Land Reserves in the Kavango Region Be Depleted?
Words of thanks My thanks to the people of Kavango and especially my former colleagues in the MLR for their kind hosting. "Ich versichere, diese Master Thesis ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung anderer als der angeführten Quellen angefertigt zu haben, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen hat. Alle Ausführungen der Arbeit die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden sind entsprechend gekennzeichnet." Ibadan, 26.02.2015 Martin Mueller Abstract This text deals with the increasing shortage of land for settlement for the 'average' Kavango settler who practices small scale crop farming and is dependend on natural resources and a communal water supply in the rural areas of Kavango Region. It tries to answer the question „When will the land reserves be depleted?“ by identifying deterministic weight factors for the main influencing factors of settlement in the remote rural areas: water access, road network, soil suitability, local availability of land. As a result it shall be possible to quantify the attractivity of a not yet occupied plot in order to facilitate planning. Fragile data qualities and quantities are usual challenges and require to find pragmatic answers in this interdisciplinary analysis. Under a scenario in which current trends of land allocation continue „business as usual“, an overall answer is that the area of land might not limit settlement. The urbanization factor carries the most vague factor. In the last census decade, it absorbed in numbers the entire rural population growth. That shows a new trend towards expansion of cropland while supplying the townlands with food which again requires logistics. -

Unam Press Reviewng Resistance Silke.Indd 55 3/4/15 8:44 AM 56 Shampapi Shiremo
The Vagciriku-Lishora Massacre of 1894: Revisited 55 3 The Vagciriku-Lishora Massacre of 1894 Revisited Shampapi Shiremo Introduction One day in March or April 1894,1 the Vagciriku community of the Kavango Region in Namibia and Cuando-Cubango Province in Angola lost almost all its able-bodied men. This happened after a force of armed BaTawana men on horseback, commanded by Kgosi2 Sekgoma, which had travelled from Botswana, shot in cold-blood all the able- bodied Vagciriku men at a place called Shantjefu.3 Hompa Nyangana of the Vagciriku, his son, Mbambo, women and children were captured and taken into captivity in Ngamiland. The BaTawana army also confiscated all the Vagciriku cattle, guns and horses as booty. Compared with colonial massacres in Namibian historiography such as the Hornkranz Massacre of 1893, the Old Location Massacre of 1959 or the Cassinga Massacre of 1978, the Lishora Massacre of 1894 is relatively unknown. The small body of literature about the Lishora Massacre of 1894 is generally one sided and situated outside the ‘colonial narrative’. In Vagciriku oral history, Hompa Nyangana’s despotism is usually blamed for the Lishora Massacre of 1894 as it is described as being a response to the conflict between Hompa Nyangana and the section of the Vashambyu led by Hompaghona (Prince) Kanyetu. Hompa Nyangana is sometimes remembered as an authoritarian leader who used violence to settle scores with his rivals. The view that Hompa Nyangana played a direct role in the Lishora massacre has never been critically questioned, because the existing secondary literature and oral narratives ignored the primary and archival sources kept in Botswana’s National Archives. -

Michael Proepper (Universität Hamburg)
Michael Proepper (Universität Hamburg) Der ethnographische Forschungsstand zum Kavangogebiet in Nordost Namibia 2006 – eine kommentierte Bibliographie Ethnographic Research Literature on the Kavango Area of North-Eastern Namibia 2006 – a Commented Bibliography BAB Working Paper No 1: 2007 ISSN 1422-8769 © The author © Basler Afrika Bibliographien Basler Afrika Bibliographien Klosterberg 23 CH 4051 Basel Switzerland Tel. 061 228 93 33 Fax 061 228 93 30 Email [email protected] Der ethnographische Forschungsstand zum Kavangogebiet in Nordost Namibia 2006 – eine kommentierte Bibliographie Ethnographic Research Literature on the Kavango Area of North-Eastern Namibia 2006 – a Commented Bibliography Michael Proepper (Universität Hamburg) In diesem Aufsatz wird die vorhandene ethnographische Literatur zum namibischen Kavangogebiet quellenkritisch diskutiert. Vor allem wissenschaftliche Texte von Ethnologen, aber auch anderen Ethnographen, werden auf ihre Datengrundlage und Entstehungsumstände hin untersucht und kommentiert. Es handelt sich im ersten Teil der anhängenden Bibliographie weitgehend um Arbeiten, die lokalisiert und beschafft werden konnten. In einigen Fällen sind jedoch auch Arbeiten aufgenommen worden, die nicht beschafft werden konnten, aber deren Aufnahme gerechtfertigt schien. Nicht alle Arbeiten sind streng ethnographisch und auch nicht als solche intendiert. Eingang fanden sie aufgrund ihres Informationsgehaltes zum Thema Lebensweisen und Kultur im Kavango. Die anhängende Bibliographie enthält – im zweiten unkommentierten Teil -

They Had Lived on Namibian Soil
THEY HAD LIVED ON NAMIBIAN SOIL Windhoek Priory - Namibia THEY HAD LIVED ON NAMIBIAN SOIL By: Sr. Scholastica Kaliki, OSB and Sr. Mary Clemens Hamukoto, OSB Windhoek Priory - Namibia THEY HAD LIVED ON NAMIBIAN SOIL CONTENTS Preface ............................................................................................... v Introduction .........................................................................................vii 1. Sr. Anselma Schnitzbauer ............................................................... 1 2. Sr. Beatrix Biefel ............................................................................. 3 3. Sr. Constantia Mayr ........................................................................ 8 4. Sr. Franziska Mövenkamp............................................................. 10 5. Sr. Gabriela Reiter......................................................................... 13 6. Sr. Ingridis Meiller.......................................................................... 16 7. Sr. Relindis Bessinger ................................................................... 20 8. Sr. Sophia Ohnmacht ................................................................... 22 9. Sr. Adelinde Rohrmoser ................................................................ 25 10. Sr. Adeline Vogel ........................................................................ 27 11. Sr. Adula Stiegler ........................................................................ 28 12. Sr. Alypia Schröttke .................................................................... -

The Accumulation of Knowledge of Kavango and Its Peoples by the German Colonial Administration 1891 – 19111 Andreas Eckl
Journal of Namibian Studies, 1 (2007): 7–37 ISSN: 1863-5954 Reports from ‘beyond the line’: The accumulation of knowledge of Kavango and its peoples by the German colonial administration 1891 – 19111 Andreas Eckl Abstract This paper explores the accumulation of knowledge of the Kavango region and its peoples by analysing twenty reports on expeditions which cover a wide range of observations. The article intends to determine the internal logic of the accumulation of knowledge by German officials as part of the deconstruction of colonial discourse. Kavango became a matter of interest for the colonial administration only at a late stage. It will be shown that all reports by German officials on the region paid tribute to the fact that Kavango was always a region which still had to be brought under control, but actually never was. As a result, the accumulation of knowledge was mostly limited to the economic value of the region while interest in the Kavango peoples themselves remained weak. Introduction The Kavango region is to be found in the far north of Namibia, alongside the Kavango River where for some 360 km it forms the border between former Portuguese Angola and German South West Africa.2 During the period of German colonial administration, the Kavango region was never part of the police zone (Polizeizone) which had been demarcated by what later became known as the ‘Red Line’ – hence Kavango has to be considered as a territory ‘beyond the line’ at that time; in some respects it still is that in modern-day Namibia. Until today it is inhabited mainly by five Bantu groups, namely from west to east by the Kwangali, Mbunza, Sambyu, Gciriku and Mbukushu.3 As early as 30 December 1886, Portugal and Germany signed an agreement on the demarcation of mutual spheres of interest in Southern Africa which defined the ‘Kubango’ river as the 1 An earlier version of this paper was presented at the conference “Public History – Forgotten History”, University of Namibia, August 2004. -

A Preliminary Profile of the Kavango Region in Namibia.Pdf
A Preliminary Profi le of the Kavango Region in Namibia by IRDNC Selma el Obeid and John Mendelsohn for the Every River has its People Project Rössing Foundation A Preliminary Profi le of the Kavango Region in Namibia Contents Introduction 1 The physical environment 5 People and social conditions 16 Livelihoods and environmental pressures 26 Acknowledgements, notes and sources 45 Selma el Obeid and John Mendelsohn © Research and Information Services of Namibia (RAISON) PO Box 80044 Windhoek, Namibia E-mail: [email protected] Published by the Namibia Nature Foundation January 2001 A view of the Okavango Basin and the Cuito River, as photo- For information on the “Every River has its People Project” contact: graphed from a space shuttle in August 1991. The many fi res Namibia Nature Foundation burning in and around the region provide a background of PO Box 245, Windhoek, Namibia smoke. Courtesy of NASA. Tel +264 61 248345 Fax +264 61 248344 www.nnf.org.na E-mail: [email protected] Chapter 1: Introduction A Preliminary Profi le of the Kavango Region in Namibia has been produced to provide background material for Equator the “Every River has its People” project1. The bulk of the report consists of maps and graphs derived largely from analyses of recent surveys, censuses and mapping projects. Brief comments are offered to help users " Luanda interpret the analyses and to highlight major issues and processes in the region, especially those relating to ANGOLA natural resources. References to notes and sources of information on page 45 are indicated by superscript numbers. -

Regional Development Profile for the Kavango East Region December 2015
REGIONAL DEVELOPMENT PROFILE FOR THE KAVANGO EAST REGION DECEMBER 2015 Final Report FOREWORD BY THE HONOURABLE GOVERNOR The need to understand the current status of Development in the Kavango East Region has prompted us to formulate a Regional Development Profile to provide factual information on the state of development in the region across all sectors. The division of the former Kavango Region into East and West further enhanced the need for a Regional Development Profile specifically targeting the Kavango East Region. The profile serves as lead on potential programmes and projects that need to be implemented in the region. It is a tool that the public and private sectors should use as a guide towards achieving regional development and socio-economic growth. It should be used in conjunction with the Local Economic Development Strategy for the Kavango Region as well as with the Kavango Integrated Regional Land Use Plan. Information contained in the Kavango East Regional Development Profile is up-to-date and has been sourced from existing publications and from the regional stakeholders. As a result, it provides a clear reflection of the state of development in the region as well as outlining the regional strengths, weaknesses, opportunities and threats. It is imperative that both the public and private sectors acquaint themselves with the regional comparative advantages to determine how they can contribute towards the social and economic development of the Kavango East Region. The regional development profile fully documents regional socio-economic development challenges which provide factual information to political and public office bearers to present their cases to the central government for budget allocation. -

Apartheid Namibia: a Focus on State Sponsored Cultural Festivals in Kavango Region
THE FORMATION OF 'NATIONAL CULTURE' IN POST- APARTHEID NAMIBIA: A FOCUS ON STATE SPONSORED CULTURAL FESTIVALS IN KAVANGO REGION. MICHAEL UUSIKU AKUUPA STUDENT NO: 2559867 Dissertation presented for the degree of Doctor of Philosophy (Anthropology) at University of the Western Cape PROMOTER: PROF HEIKE BECKER 2011 1 ABSTRACT This dissertation investigates colonial and postcolonial practices of cultural representations in Namibia. The state sponsored Annual National Culture Festival in Namibia was studied with a specific focus on the Kavango Region in northeastern Namibia. I was particularly interested in how cultural representations are produced by the nation-state and local people in a post-colonial African context of nation-building and national reconciliation, by bringing visions of cosmopolitanism and modernity into critical dialogue with its colonial past During the apartheid era, the South African administration encouraged the inhabitants of its „Native Homelands‟ to engage in „cultural‟ activities aimed at preserving their traditional cultures and fostering a sense of distinct cultural identity among each of Namibia‟s officially recognized „ethnic groups‟. This policy was in line with the logic of South African colonial apartheid rule of Namibia, which relied upon the emphasis of ethnic differences, in order to support the idea that the territory was inhabited by a collection of „tribes‟ requiring a central white government to oversee their development. The colonial administration resorted to concepts of „tradition‟ and „cultural heritage‟ in order to construct Africans as members of distinct, bounded communities („tribes‟) attached to specific localities or „homelands‟. My central argument is that since Namibian independence in 1990, the postcolonial nation-state has placed emphasis on cultural pride in new ways, and on identifying characteristics of „Namibian-ness‟. -

Economy Profile for Rundu
Issue 3: 2018 Economy Profile for Rundu August 2018 Contributors Martin Mwinga : Team Leader Milner Siboleka : Manager Research Clarinda Kavezuva : Statistician Frieda Amadhila: Investment Analyst © FCL2018 Economy Profile for Rundu CONTENTS LIST OF TABLES ............................................................................................................... iv ACRONYMS ...................................................................................................................... iv SECTION ONE: DEMOGRAPHIC, SOCIAL AND GEOGRAPHIC SITUATION ........................ 3 1. INTRODUCTION ....................................................................................................... 3 2. POPULATION DEMOGRAPHICS ............................................................................... 4 2.1. Population Trends .............................................................................................. 4 2.1.1. Rundu Population Trend .................................................................................. 4 2.1.2. Population Comparisons by town ..................................................................... 5 2.2. Trend of Population Growth ..................................................................................... 6 2.3. Population Age Distribution ..................................................................................... 6 3.1. Land Size ........................................................................................................... 8 3.2. Population Density ............................................................................................