Pro Civitate Austriae
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mittelalter“ »Rad-Kulturreise an Der Donau „Mittelalter“« 2 / 59
Rad-Kulturreise an der Donau „Mittelalter“ »Rad-Kulturreise an der Donau „Mittelalter“« 2 / 59 Rad-Kulturreise an der Donau „Mittelalter“ „Faszination Donau - mittelalterlich erleben“ Die Donau ist mit 2.888 km Länge der zweitgrößte Strom Europas. Auf der Reise von ihrem Ursprung im bayerischen Schwarzwald zu ihrer Mündung im Schwarzen Meer durchquert sie zehn Staaten. Kein Wunder also, dass dieser Fluss seit jeher Kulturen verbindet. Ob als Naturraum, Grenzfluss, Handelsweg, Reiseroute, Heerstraße, … Die einst überragende Bedeutung des Donaustromes ist heute etwas in Vergessenheit geraten, ihr Mythos übt jedoch ungebrochen eine starke Faszination aus. Die Donau - die Lebensader Europas! Auf dieser Rad-Kulturreise entlang der österreichischen Donau begeben wir uns auf die Spur der mittelalterlichen Faszination der Donau. Burgen, Kreuzritter, Machtkämpfe, … das ist der Stoff, aus dem spannende Mittelaltergeschichten sind. Der Donauraum bietet jedoch viel mehr: Die Lebensader des mittelalterlichen Europas lässt förmlich in diese Epoche eintauchen und erlaubt auch abseits der Klischees interessante Einblicke in die Welt des Mittelalters. Viel Spaß beim Entdecken! Ausgangsort: Passau Endort: Hainburg Gesamtlänge: ~ 360 km Dauer: 9 Tage Tipp: In Hinblick auf die Öffnungszeiten der Museen empfiehlt es sich, diese Reise an einem Samstag zu beginnen. Die Reiseplanung ist als Vorschlag zu verstehen, den Sie gerne nach Ihren persönlichen Vorlieben adaptieren können. Sehenswürdigkeiten, die als zusätzliche Insidertipps oder Varianten angeführt sind, -

Comparison of the Shear Bond Strength of 3D Printed Temporary Bridges Materials, on Different Types of Resin Cements and Surface Treatment
J Clin Exp Dent. 2019;11(5):e367-72 Journal section: Operative Dentistry and Endodontics doi:10.4317/jced.55617 Publication Types: Research http://dx.doi.org/10.4317/jced.55617 Comparison of the shear bond strength of 3D printed temporary bridges materials, on different types of resin cements and surface treatment Holmer Lorenz 1, Ahmed Othman 2, Anne-Katrin Lührs 3, Constantin von See 4 1 Dr. med. dent student, Danube Private University, Krems an der Donau, Austria 2 Dr., M.Sc., Digital Orthodontic Researcher, Digital technology in dentistry and CAD/CAM department, Danube Private Univer- sity, Krems an der Donau, Austria 3 DDS, PhD, Senior Lecturer, Department of Conservative Dentistry, Periodontology and Preventive Dentistry, Hannover Medical School, Hannover 3 Prof. Dr., Director of the Center for Digital Technologies in Dentistry and CAD/CAM, Danube Private University, Krems an der Donau, Austria Correspondence: Steiner Landstrasse 124 3500 Krems an der Donau- Austria Lorenz H, Lührs AK, von See C. Comparison of the shear bond strength of [email protected] 3D printed temporary bridges on different types of resin cements and surface treatment. J Clin Exp Dent. 2019;11(5):e367-72. http://www.medicinaoral.com/odo/volumenes/v11i4/jcedv11i4p367.pdf Received: 04/02/2019 Accepted: 18/02/2018 Article Number: 55617 http://www.medicinaoral.com/odo/indice.htm © Medicina Oral S. L. C.I.F. B 96689336 - eISSN: 1989-5488 eMail: [email protected] Indexed in: Pubmed Pubmed Central® (PMC) Scopus DOI® System Abstract Background: Thus, purpose of this study was to compare the shear bond strength of the resin cement and the resin modified glass ionomer cement on 3D printed temporary material for crowns and bridges in combination with di- fferent surface treatment modalities. -

Toponymic Guidelines for Map and Other Editors, For
TOPONYMIC GUIDELINES FOR MAP AND OTHER EDITORS, FOR INTERNATIONAL USE AUSTRIA Revised edition 2006 / 2007 Hubert Bergmann and Isolde Hausner Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (AKO), Vienna TABLE OF CONTENTS 1 Languages 3 1.1 General remarks 3 1.2 National language 3 1.2.1 General remarks 3 1.2.2 The German alphabet 3 1.2.3 Spelling rules for German geographical names 3 1.2.4 Pronunciation of German geographical names 5 1.2.5 Linguistic substrata recognizable in German place names of Austria 7 1.2.6 German dialects 7 1.3 Minority languages 8 1.3.1 Slovenian 8 1.3.1.1 General remarks 8 1.3.1.2 The Slovenian alphabet 8 1.3.1.3 Pronunciation 9 1.3.1.4 Geographical names 9 1.3.2 Burgenland Croatian 9 1.3.2.1 General remarks 9 1.3.2.2 The Burgenland Croatian alphabet 9 1.3.2.3 Pronunciation 10 1.3.2.4 Geographical names 10 1.3.3 Hungarian 11 1.3.3.1 General remarks 11 1.3.3.2 The Hungarian alphabet 11 1.3.3.3 Pronunciation 11 1.3.3.4 Geographical names 11 2 Names authorities and names standardization 11 3 Source material 13 4 Glossary of words frequently occurring in geographical names as generic and/or specific elements and of descriptive terms, useful for the understanding of maps 14 4.1 German 14 4.2 Slovenian 17 4.3 Burgenland Croatian 18 4.4 Hungarian 18 5 Abbreviations used in the official Map of Austria 1:50 000 19 Annex: A. -
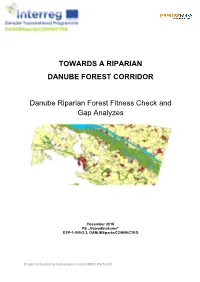
Danube Riparian Forest Corridor Fitness Check and Gap Analyses
TOWARDS A RIPARIAN DANUBE FOREST CORRIDOR Danube Riparian Forest Fitness Check and Gap Analyzes December 2018 PE „Vojvodinašume“ DTP-1-005-2.3, DANUBEparksCONNECTED Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA funds) Table of Content 1. INTRODUCTION 2. PURPOSE OF THE DOCUMENT AND METHODOLOGY FOR ITS ELABORATION 3. GEOGRAPHICAL SCOPE 4. LEGAL FRAMEWORK FOR DANUBE FOREST HABITAT CORRIDOR 5. DANUBE RIPARIAN FOREST FITNESS CHECK 5.1 Remote Land Service and GIS offise setting up 5.1.1 Cooperation platform with European Environmental Agency 5.1.2 Remote Land Service, GIS tools and GIS interpretation and gap analyses of Copernicus Monitoring Services 5.1.3 Methodology and objectives of the Fitness Check 5.1.3.1 Land use 5.1.3.2 Fragmentation, infrastructure and patchiness (patch cohesion) 5.1.3.3 Wilderness 5.1.3.4 Environmental protection (Protected areas) 5.1.3.5 Hydrological conditions, habitat patches/corridor/habitat network, Dead wood 5.1.3.6 Historic forms of forestry 5.1.3.7 Biodiversity 5.1.3.8 Population 5.1.4 Illustrative map of Riparian zones and forests along the Danube 6. LITERATURE AND REFERENCES Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA funds) 1. INTRODUCTION Riparian forests are habitats serving multiple functions for flora, fauna and humans. In the past century, around 90% of the original Danube wetlands have been lost due to human activities. Today, most of the last remaining large-scale floodplain forest complexes are protected by the Danube Protected Areas, famous for their richness in biodiversity. Riparian forests are of great ecological importance, playing an important role in both nature and human populations. -

Alien Plants in Central European River Ports
A peer-reviewed open-access journal NeoBiota 45: 93–115 (2019) Alien plants in Central European river ports 93 doi: 10.3897/neobiota.45.33866 RESEARCH ARTICLE NeoBiota http://neobiota.pensoft.net Advancing research on alien species and biological invasions Alien plants in Central European river ports Vladimír Jehlík1, Jiří Dostálek2, Tomáš Frantík3 1 V Lesíčku 1, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Czech Republic 2 Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, CZ-252 43 Průhonice, Czech Republic 3 Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, CZ-252 43 Průhonice, Czech Republic Corresponding author: Jiří Dostálek ([email protected]) Academic editor: Ingo Kowarik | Received 14 February 2019 | Accepted 27 March 2019 | Published 7 May 2019 Citation: Jehlík V, Dostálek J, Frantík T (2019) Alien plants in Central European river ports. NeoBiota 45: 93–115. https://doi.org/10.3897/neobiota.45.33866 Abstract River ports represent a special type of urbanized area. They are considered to be an important driver of biological invasion and biotic homogenization on a global scale, but it remains unclear how and to what degree they serve as a pool of alien species. Data for 54 river ports (16 German, 20 Czech, 7 Hungarian, 3 Slovak, and 8 Austrian ports) on two important Central European waterways (the Elbe-Vltava and Dan- ube waterways) were collected over 40 years. In total, 1056 plant species were found. Of these, 433 were alien, representing 41% of the total number of species found in all the studied Elbe, Vltava, and Danube ports. During comparison of floristic data from literary sources significant differences in the percentage of alien species in ports (50%) and cities (38%) were found. -

Country and City Codes
We hope this information will be useful to you in your travels! The information is believed to be reliable and up to date as of the time of publication. However, no warranties are made as to its reliability or accuracy. Check with Full Service Network Customer Service or your operator for official information before you travel. Country and City Codes Afghanistan country code: 93 Albania country code: 355 city codes: Durres 52, Elbassan 545, Korce 824, Shkoder 224 Algeria country code: 213 city codes: Adrar 7, Ain Defla 3, Bejaia 5, Guerrar 9 American Samoa country code: 684 city codes: City codes not required. All points 7 digits. Andorra country code: 376 city codes: City codes not required. All points 6 digits. Angola country code: 244 Anguilla country code: 264 Antarctica Casey Base country code: 672 Antarctica Scott Base country code: 672 Antigua (including Barbuda) country code: 268 city codes: City codes not required. * Footnote: You should not dial the 011 prefix when calling this country from North America. Use the country code just like an Area Code in the U.S. Argentina country code: 54 city codes: Azul 281, Bahia Blanca 91, Buenos Aires 11, Chilvilcoy 341, Comodoro Rivadavia 967, Cordoba 51, Corrientes 783, La Plata 21, Las Flores 224, Mar Del Plata 23, Mendoza 61, Merio 220, Moreno 228, Posadas 752, Resistencia 722, Rio Cuarto 586, Rosario 41, San Juan 64, San Rafael 627, Santa Fe 42, Tandil 293, Villa Maria 531 Armenia country code: 374 city codes: City codes not required. Aruba country code: 297 city codes: All points 8 plus 5 digits The Ascension Islands country code: 247 city codes: City codes not required. -

Distributor Settlement Agreement
DISTRIBUTORS’ 7.30.21 EXHIBIT UPDATES DISTRIBUTOR SETTLEMENT AGREEMENT DISTRIBUTORS’ 7.30.21 EXHIBIT UPDATES Table of Contents Page I. Definitions............................................................................................................................1 II. Participation by States and Condition to Preliminary Agreement .....................................13 III. Injunctive Relief .................................................................................................................13 IV. Settlement Payments ..........................................................................................................13 V. Allocation and Use of Settlement Payments ......................................................................28 VI. Enforcement .......................................................................................................................34 VII. Participation by Subdivisions ............................................................................................40 VIII. Condition to Effectiveness of Agreement and Filing of Consent Judgment .....................42 IX. Additional Restitution ........................................................................................................44 X. Plaintiffs’ Attorneys’ Fees and Costs ................................................................................44 XI. Release ...............................................................................................................................44 XII. Later Litigating -

Survival Guide V2 Survival Guide 22.08.2012 19:18 Seite 1 Survival Guide V2 Survival Guide 22.08.2012 19:18 Seite 2
Survival Guide V2_Survival Guide 22.08.2012 19:18 Seite 1 Survival Guide V2_Survival Guide 22.08.2012 19:18 Seite 2 Language Guide “Do you speak German?” This language guide helps you to use the most important words and sentences in German. Yes. No. Maybe. Ja. Nein. Vielleicht Please Bitte Thank you Danke Excuse me! Entschuldigen Sie bitte. Pardon Wie bitte? I don’t understand you Ich verstehe Sie/dich nicht I only speak a little… Ich spreche nur wenig … Could you please help me? Könnten Sie mir bitte helfen? I want … Ich möchte … I do (not) like this. Das gefällt mir (nicht). Do you have …? Haben Sie …? How much does this cost? Wie viel kostet es? What’s the time? Wie spät ist es? Good Morning! Guten Morgen! Good Afternoon! Guten Tag! Good Evening! Guten Abend! My name is … Mein Name ist … What’s your name? Wie ist dein Name? How are you? Wie geht es Ihnen / dir? Thank you. And how are you? Danke. Wie geht es Ihnen / dir? Goodbye! Auf Wiedersehen! Tschüss! Left/right Links/rechts Straight ahead Geradeaus Please, where is …? Bitte, wo ist …? Help! Hilfe! There happened an accident! Ein Unfall ist passiert! Please, call … Bitte rufen Sie … - ambulance - Krankenwagen - police - Polizei - fire brigade - Feuerwehr Please book a table for us tonight for Bitte reservieren Sie für uns heute X persons. Abend einen Tisch für X Personen. 2 Survival Guide V2_Survival Guide 22.08.2012 19:18 Seite 3 SURVIVAL GUIDE Copyright © 2012 by Valerie Semorad and Michael Zimmermann All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without the permission in writing of the publisher. -
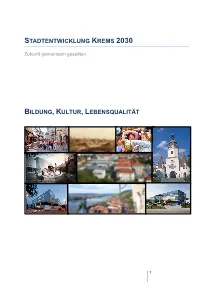
Langversion Konzept Stadtentwicklung
STADTENTWICKLUNG KREMS 2030 Zukunft gemeinsam gestalten. BILDUNG, KULTUR, LEBENSQUALITÄT 1 Impressum: Stadtentwicklung Krems 2030 Zukunft gemeinsam gestalten. Eigentümer und Herausgeber Magistrat der Stadt Krems an der Donau, Baudirektion Inhalt und Redaktion DI Reinhard M. Weitzer (Magistrat der Stadt Krems, Baudirektion) DI Franz Schlögl (SPS Strategie/Projekte/Schlögl) Inhaltliche Grundlagen Die Erstellung von Stadtentwicklung Krems 2030 erfolgte unter Einbeziehung der Beiträge aus den gemischten Arbeitsgruppen, Expertisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats sowie folgender externer Experten und Expertinnen: DI Franz Schlögl (SPS Strategie/Projekte/Schlögl) DI Michaela Krämer (NÖ Regional GmbH) Gender-Erklärung Falls in diesem Dokument personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen diese Frauen und Männer in gleicher Weise. Lektorat Mag. Marisa Fedrizzi (NÖ Regional GmbH) Graphik und Layout Nicole Horaczek (Magistrat der Stadt Krems, Baudirektion) Abbildungen www.donau-uni.ac.at; www.austria-forum.org; www.ecoplus.at; marte.marte; Krems Tourismus; Stadt Krems, Kulturamt Copyright © 2016, Magistrat der Stadt Krems www.krems.at 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort ..................................................................................................................................... 5 Kurzfassung ............................................................................................................................. 5 TEIL A: Stadtentwicklung Krems 2030 ................................................................................ -

Delightful Danube Tour Information
Delightful Danube Tour information Start: Passau Region End: Budapest The Tour Tour days: 14 Non-Driving days: 8 The tour starts near Passau situated at the confluence of the rivers Danube, Inn and Ilz in Max. daily mileage: 130 miles Southeast Germany. From there we follow the Danube through Austria passing the Total mileage: 394 miles Engeszell abbey, famous for its liqueurs, cheese and beer, and the Schlögener Schlinge, the Calais- Passau: 659 miles famous natural spectacle where the Danube winds itself narrowly around the Schlögenberg Pets allowed Mountain. We continue along the Danube and follow the dramatic stretch of river between Krems an der Donau and Melk, a UNESCO World Heritage Site called the Wachau, and characterised by vineyards, forested slopes, wine-producing villages and imposing Travel services fortresses at nearly every bend. We visit Vienna, renowned for its imperial palaces, ➢ Welcome Dinner grandiose buildings and old-world glamour and have two whole days to explore this wonderful city and its fascinating history and culture. The tour ends in Budapest, the ➢ Wine tasting and visit of a vibrant capital city of Hungary that prides itself on its breath-taking architecture, wine cellar in the Wachau photogenic river scenery, magnificent historic spas and outstanding cultural life. wine region in Austria ➢ Budapest city tour with water bus (amphibious coach) For Tour dates and prices visit our website ➢ All campsites / motorhome parks with electricity (where Highlights: available) ➢ Assistance of multi-lingual ➢ Wine -
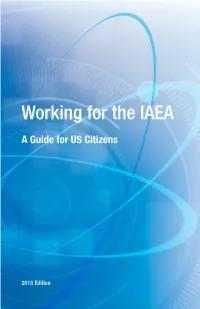
Working for the IAEA
Working for the IAEA A Guide for US Citizens 2018 Edition Working for the IAEA A Guide for US Citizens 2018 Edition From the Editors This Guidebook is intended to provide practical information for United States citizens embarking on or considering an assignment at the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna, Austria. Since its first appearance in 1989, the Guidebook has been revised frequently to reflect changes occurring at the IAEA, within the United States Support Program to IAEA Safeguards (USSP), and in Vienna. The 2018 Edition reflects these changes at the time of publication. Nevertheless, IAEA salaries, allowances, and other benefits change, as do telephone numbers, addresses, and websites. Currency exchange rates, prices, and store hours in Vienna inevitably fluctuate. We regret any inconvenience this may cause our readers. The 2018 Edition of the Guidebook was prepared by the International Safeguards Project Office (ISPO) under the auspices of the USSP and was published by Brookhaven National Laboratory (BNL). Jeanne Anderer, Ben Dabbs Editors November 2018 Working for the IAEA: A Guide for US Citizens 2018 Edition Prepared by the International Safeguards Project Office (ISPO) under the auspices of the United States Support Program to IAEA Safeguards (USSP) International Safeguards Project Office (ISPO) Brookhaven National Laboratory 30 Bell Avenue, Building 490C Upton, New York 11973‑5000, USA Telephone: (631) 344‑5902 Fax: (631) 344‑5266 Web: bnl.gov/ispo facebook.com/ISPObnl youtube.com/IAEAvideo Printed by Brookhaven -

Old World Prague & the Blue Danube 2017
Old World Prague & the Blue Danube 2017 13-Day River Cruise Tour EXTEND YOUR TRIP PRE-TRIPS Berlin & Dresden, Germany OR Highlights of Poland: Warsaw & Krakow POST-TRIP Budapest, Hungary Your Day-to-Day Itinerary GRAND CIRCLE CRUISE LINE Grand Circle Cruise Line is the leader in small ship and river cruising worldwide—offering American travelers a 4-star experience at a 3-star price aboard our privately owned and chartered fleet of 24- to 162-passenger ships. With each Small Ship Adventure or River Cruise vacation, you’ll enjoy unmatched discoveries, leisurely pacing, and more travel choices. Plus, Grand Circle Cruise Line is the only cruise line with expert, local Program Directors who ac- company you throughout your trip, enhancing your exploration with the kind of insight and passion that only a local can provide. INCLUDED IN YOUR PRICE » International airfare, airport transfers, » All port charges: a value of $125 per government taxes, fees, and airline fuel person surcharges, unless you choose to make » Baggage handling for 1 piece of luggage your own air arrangements per person, including tips » Accommodations for 8 nights aboard a » 5% Frequent Traveler Credit toward private river ship with wireless Internet your next Grand Circle trip—an average access now in all common areas and of $269 cabins, and 3 nights in Corinthia Hotel Prague or similar » 28 meals: Daily breakfasts, 8 lunches, 9 dinners—including 3 meals in local restaurants—plus all onboard house beer & wine, as well as soft drinks » 8 included tours with personal headsets and 3 exclusive Discovery Series events—Apfelstrudel baking demonstration • School visit • Home- Hosted Visit » Local Program Directors, a Grand Circle Cruise Line exclusive: These dedicated experts are with you (and no more than 47 travelers) every step of the way to provide insider’s knowledge and the perspective that will enrich your experience » Gratuities for local guides and motorcoach drivers Itinerary subject to change.