Dgaae Nachrichten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mutualistic Interactions with Phoretic Mites Poecilochirus Carabi Expand
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/590125; this version posted March 26, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 Title: 2 Mutualistic interactions with phoretic mites Poecilochirus carabi expand the 3 realised thermal niche of the burying beetle Nicrophorus vespilloides 4 5 Authors: Syuan-Jyun Sun1* and Rebecca M. Kilner1 6 Affiliations: 7 1 Department of Zoology, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, 8 CB2 3EJ, UK 9 10 Keywords: climate change, context dependency, phoresy, cooperation, niche theory, 11 interspecific interactions. 12 13 Corresponding author: Syuan-Jyun Sun; [email protected]; +44-1223 (3)34466 14 Statement of authorship: Both authors conceived the study, designed the 15 experiments, and wrote the draft. S.-J.S. conducted the experiments and carried out 16 data analysis. 17 18 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/590125; this version posted March 26, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 19 Abstract: 20 Mutualisms are so ubiquitous, and play such a key role in major biological processes, 21 that it is important to understand how they will function in a changing world. Here we 22 test whether mutualisms can help populations to persist in challenging new 23 environments, by focusing on the protective mutualism between burying beetles 24 Nicrophorus vespilloides and their phoretic mites (Poecilochirus carabi). -

Phylogeny, Biogeography, and Host Specificity
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.20.443311; this version posted May 22, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. 1 Cryptic diversity within the Poecilochirus carabi mite 2 species complex phoretic on Nicrophorus burying 3 beetles: phylogeny, biogeography, and host specificity 4 Julia Canitz1, Derek S. Sikes2, Wayne Knee3, Julia Baumann4, Petra Haftaro1, 5 Nadine Steinmetz1, Martin Nave1, Anne-Katrin Eggert5, Wenbe Hwang6, Volker 6 Nehring1 7 1 Institute for Biology I, University of Freiburg, Hauptstraße 1, Freiburg, Germany 8 2 University of Alaska Museum, University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, 9 99775, USA 10 3 Canadian National Collection of Insects, Arachnids, and Nematodes, Agriculture and 11 Agri-Food Canada, 960 Carling Avenue, K.W. Neatby Building, Ottawa, Ontario, 12 K1A 0C6, Canada 13 4 Institute of Biology, University of Graz, Universitätsplatz 2, 8010 Graz, Austria 14 5 School of Biological Sciences, Illinois State University, Normal, IL 61790-4120, USA 15 6 Department of Ecology and Environmental Resources, National Univ. of Tainan, 33 16 Shulin St., Sec. 2, West Central Dist, Tainan 70005, Taiwan 17 Correspondence: [email protected] 1 1/50 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.20.443311; this version posted May 22, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. -

Disturbance and Recovery of Litter Fauna: a Contribution to Environmental Conservation
Disturbance and recovery of litter fauna: a contribution to environmental conservation Vincent Comor Disturbance and recovery of litter fauna: a contribution to environmental conservation Vincent Comor Thesis committee PhD promotors Prof. dr. Herbert H.T. Prins Professor of Resource Ecology Wageningen University Prof. dr. Steven de Bie Professor of Sustainable Use of Living Resources Wageningen University PhD supervisor Dr. Frank van Langevelde Assistant Professor, Resource Ecology Group Wageningen University Other members Prof. dr. Lijbert Brussaard, Wageningen University Prof. dr. Peter C. de Ruiter, Wageningen University Prof. dr. Nico M. van Straalen, Vrije Universiteit, Amsterdam Prof. dr. Wim H. van der Putten, Nederlands Instituut voor Ecologie, Wageningen This research was conducted under the auspices of the C.T. de Wit Graduate School of Production Ecology & Resource Conservation Disturbance and recovery of litter fauna: a contribution to environmental conservation Vincent Comor Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of doctor at Wageningen University by the authority of the Rector Magnificus Prof. dr. M.J. Kropff, in the presence of the Thesis Committee appointed by the Academic Board to be defended in public on Monday 21 October 2013 at 11 a.m. in the Aula Vincent Comor Disturbance and recovery of litter fauna: a contribution to environmental conservation 114 pages Thesis, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands (2013) With references, with summaries in English and Dutch ISBN 978-94-6173-749-6 Propositions 1. The environmental filters created by constraining environmental conditions may influence a species assembly to be driven by deterministic processes rather than stochastic ones. (this thesis) 2. High species richness promotes the resistance of communities to disturbance, but high species abundance does not. -

Col., Silphidae) in Agriculturally Used Areas - 2297
Konieczna et al.: Assemblages of necrophilous carrion beetles (Col., Silphidae) in agriculturally used areas - 2297 - ASSEMBLAGES OF NECROPHILOUS CARRION BEETLES (COL., SILPHIDAE) IN AGRICULTURALLY USED AREAS KONIECZNA, K.* – CZERNIAKOWSKI, Z. W. – WOLAŃSKI, P. Department of Agroecology, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów, Poland *Corresponding author e-mail: [email protected] (Received 19th Oct 2018; accepted 2nd Jan 2019) Abstract. This study on Silphidae fauna was carried out at different sites forming part of an agricultural landscape. Catches were carried out in two selected habitats (Borek Stary and Widna Góra) in the Subcarpathian region (south-eastern Poland) during three growing seasons (2009-2010 and 2014) using Barber pitfall traps. It included potato, fodder beet and cereal crops (Widna Góra) as well as field margins (Borek Stary and Widna Góra). Four traps were placed at each of the sites studied then were emptied on average every two weeks. As a result of the observations, a total of 5491 beetles from 13 species were collected. Keywords: Silphidae, Thanatophilus sinuatus, Nicrophorus vespillo, crop culture, field margins Introduction Most representatives of carrion beetles (Col., Silphidae) are necrophagous and/or predatory. Herbivorous species are a minority (Anderson and Peck, 1985; Sikes, 2008). Alongside ground beetles (Col., Carabidae) and rove beetles (Col., Staphylinidae), beetles from this family are an important component of epigeic entomofauna of agricultural landscape from the ecological point of view (Tischler, 1955). Necrophagous carrion beetles perform important ecological functions, which can be particularly seen in the agricultural aspect. Biochemical transformations that accompany the decomposition of dead animals lead to an increased amount of mineral nutrients and humus in the soil and, as a further consequence, they affect soil fertility regeneration. -

The Occurrence and Species Richnes of Nicrophagous Silphidae (Coleoptera) in Wooded Areas in Different Degree of Urbanization
Baltic J. Coleopterol. 19(2) 2019 ISSN 1407 - 8619 The occurrence and species richnes of nicrophagous Silphidae (Coleoptera) in wooded areas in different degree of urbanization Karolina Konieczna, Zbigniew W. Czerniakowski, Paweł Wolański Konieczna K., Czerniakowski Z. W., Wolański P. 2019. The occurrence and species richnes of nicrophagous Silphidae (Coleoptera) in wooded areas in different degree of urbanization. Baltic J. Coleopterol., 19(2): 213 – 232. This study on the fauna of carrion beetles (Col., Silphidae) was conducted in various wooded areas located in Subcarpathian Voivodeship (south-eastern Poland). It covered habitats dif- fering in anthropogenic pressure and the degree of urbanization. Wooded grounds in less urbanized rural areas were located in the Borek Stary (mid-field tree stands I and II). Wooded grounds in more urbanized areas were located in a suburban district of the city of Rzeszów and included two following sites: a cluster of trees and shrubs, and an urban park. The present study covered four growing seasons (2009-2012). Entomological catches were carried out using baited pitfall traps. At each site, four traps were placed and emptied on average every two weeks. A total of 4282 carrion beetles were found, which were classified to 13 species. In the wooded areas with lower urbanization pressure, a higher number of individuals was caught (2907 exx.) than in the urban areas. These sites were also found to have higher values of the Shannon species diversity index (H’ln) and the Pielou evenness index (J’). Species preferring open areas and fields were also found to occur in greater numbers. Keywords: carrion beetles, trees, scale of urbanization Karolina Konieczna* , Zbigniew W. -
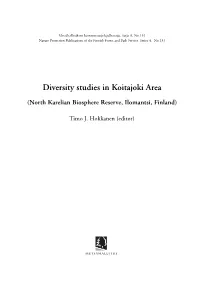
Diversity Studies in Koitajoki (3.4 MB, Pdf)
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, No 131 Nature Protection Publications of the Finnish Forest and Park Service. Series A, No 131 Diversity studies in Koitajoki Area (North Karelian Biosphere Reserve, Ilomantsi, Finland) Timo J. Hokkanen (editor) Timo J. Hokkanen (editor) North Karelian Biosphere Reserve FIN-82900 Ilomantsi, FINLAND [email protected] The authors of the publication are responsible for the contents. The publication is not an official statement of Metsähallitus. Julkaisun sisällöstä vastaavat tekijät, eikä julkaisuun voida vedota Metsähallituksen virallisesna kannanottona. ISSN 1235-6549 ISBN 952-446-325-3 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Cover picture:Veli-Matti Väänänen © Metsähallitus 2001 DOCUMENTATION PAGE Published by Date of publication Metsähallitus 14.9.2001 Author(s) Type of publication Research report Timo J. Hokkanen (editor) Commissioned by Date of assignment / Date of the research contract Title of publication Diversity studies in Koitajoki Area (North Karelian Biosphere Reserve, Ilomantsi, Finland) Parts of publication Abstract The mature forests of Koitajoki Area in Ilomantsi were studied in the North Karelian Biosphere Reserve Finnish – Russian researches in 1993-1998. Russian researchers from Petrozavodsk (Karelian Research Centre) , St Peters- burg (Komarov Botanical Institute) and Moscow (Moscow State University) were involved in the studies. The goal of the researches was to study the biolgical value of the prevailing forest fragments. An index of the value of the forest fragments was compiled. The index includes the amount and quality and suc- cession of the decaying wood in the sites. The groups studied were Coleoptera, Diptera, Hymenoptera and ap- hyllophoraceous fungi. Coleoptera species were were most numerous in Tapionaho, where there were over 200 spedies found of the total number of 282 found in the studies. -

Carrion Beetles Visiting Pig Carcasses During Early Spring in Urban, Forest and Agricultural Biotopes of Western Europe Abstract
Journal of Insect Science: Vol. 11 | Article 73 Dekeirsschieter et al. Carrion beetles visiting pig carcasses during early spring in urban, forest and agricultural biotopes of Western Europe Jessica Dekeirsschieter1a, François J. Verheggen1, Eric Haubruge1 and Yves Brostaux2 1Department of Functional and Evolutionary Entomology, Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liege, 2 Passage des Déportés, 5030 Gembloux, Belgium 2 Department of Applied Statistics, Computer Science and Mathematics, Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liege, 2 Passage des Déportés, 5030 Gembloux, Belgium Abstract Carrion beetles are important in terrestrial ecosystems, consuming dead mammals and promoting the recycling of organic matter into ecosystems. Most forensic studies are focused on succession of Diptera while neglecting Coleoptera. So far, little information is available on carrion beetles postmortem colonization and decomposition process in temperate biogeoclimatic countries. These beetles are however part of the entomofaunal colonization of a dead body. Forensic entomologists need databases concerning the distribution, ecology and phenology of necrophagous insects, including silphids. Forensic entomology uses pig carcasses to surrogate human decomposition and to investigate entomofaunal succession. However, few studies have been conducted in Europe on large carcasses. The work reported here monitored the presence of the carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) on decaying pig carcasses in three selected biotopes (forest, crop field, urban site) at the beginning of spring. Seven species of Silphidae were recorded: Nicrophorus humator (Gleditsch), Nicrophorus vespillo (L.), Nicrophorus vespilloides (Herbst), Necrodes littoralis L., Oiceoptoma thoracica L., Thanatophilus sinuatus (Fabricius), Thanatophilus rugosus (L.). All of these species were caught in the forest biotope, and all but O. thoracica were caught in the agricultural biotope. -

Carrion Beetles Visiting Pig Carcasses During Early Spring in Urban, Forest and Agricultural Biotopes of Western Europe Author(S): Jessica Dekeirsschieter, François J
Carrion Beetles Visiting Pig Carcasses during Early Spring in Urban, Forest and Agricultural Biotopes of Western Europe Author(s): Jessica Dekeirsschieter, François J. Verheggen, Eric Haubruge and Yves Brostaux Source: Journal of Insect Science, 11(73):1-13. 2011. Published By: Entomological Society of America DOI: http://dx.doi.org/10.1673/031.011.7301 URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.1673/031.011.7301 BioOne (www.bioone.org) is a nonprofit, online aggregation of core research in the biological, ecological, and environmental sciences. BioOne provides a sustainable online platform for over 170 journals and books published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses. Your use of this PDF, the BioOne Web site, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne’s Terms of Use, available at www.bioone.org/page/terms_of_use. Usage of BioOne content is strictly limited to personal, educational, and non-commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder. BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research. Journal of Insect Science: Vol. 11 | Article 73 Dekeirsschieter et al. Carrion beetles visiting pig carcasses during early spring in urban, forest and agricultural biotopes of Western Europe Jessica -

On Carrion-Associated Beetles in the Sonian Forest (Belgium): Observations on Five Deer Carcasses
On carrion-associated beetles in the Sonian Forest (Belgium): observations on five deer carcasses The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Haelewaters, Danny , Sofie Vanpoucke, Dirk Raes, René Krawczynski. 2015. On carrion-associated beetles in the Sonian Forest (Belgium): observations on five deer carcasses. Bulletin de la Société royale belge d’Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 151: 25-33. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:34900488 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Bulletin de la Société royale belge d’Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie, 151 (2015): 25-33 On carrion-associated beetles in the Sonian Forest (Belgium): observations on five deer carcasses Danny HAELEWATERS1,2, Sofie VANPOUCKE3, Dirk RAES4 & René KRAWCZYNSKI5 1 Ghent University, Faculty of Sciences, Department of Biology, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent 2 Current address: Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology, 22 Divinity Avenue, Cambridge, Massachusetts, US-02138 (e-mail: [email protected]) 3 National Institute for Criminalistics and Criminology, Laboratory Microtraces and Entomology, Vilvoordsesteenweg 100, B-1020 Brussels 4 Belgian Nature and Forest Agency (Agentschap voor Natuur en Bos), region Groenendaal, Waterloosteenweg 1, B-1640 Sint-Genesius-Rode 5 Brandenburg University of Technology Cottbus, Chair General Ecology, Siemens-Halske-Ring 8, D-03046 Cottbus Abstract Carrion is an important element of temperate ecosystems, although far less studied than dead and decaying wood. -

First Record of Poecilochirus Necrophori (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) from Turkey and Its Importance in Forensic Acarology
Acarological Studies Vol 3 (2): 96-100 doi: 10.47121/acarolstud.911455 RESEARCH ARTICLE First record of Poecilochirus necrophori (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) from Turkey and its importance in forensic acarology Kamila ONDREJKOVÁ1 , Gökhan EREN2,3 , Mustafa AÇICI2 1 Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovakia 2 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey 3 Corresponding author: [email protected] Received: 9 April 2021 Accepted: 18 July 2021 Available online: 31 July 2021 ABSTRACT: Poecilochirus necrophori Vitzthum, 1930 is a Palearctic distributed species, which deutonymphs are phoretic on some burying beetles (Coleoptera: Silphidae). The mites use adult beetles for transport to carcasses where the deu- tonymphs moult into adults and both mites and beetles feed and reproduce. A life cycle of Poecilochirus species is syn- chronized with their phoronts and they can be used in a forensic acarology as indicators of post mortem interval. We present the first record of P. necrophori from Turkey. Phoretic deutonymphs of P. necrophori were found on the beetle Nicrophorus vespillo (L.) (Coleoptera: Silphidae) in Sakarya province. The deutonymphs were also found on carcasses of marten (Marten sp.) and mole (Talpa sp.) from Sakarya, Turkey. Moreover, a significance of Poecilochirus species in fo- rensic acarology is briefly discussed. Keywords: Parasitidae, Poecilochirus necrophori, phoretic mites, carcasses, Turkey Zoobank: http://zoobank.org/B0359A97-7806-4A39-889B-4540972977F6 INTRODUCTION than their carriers which makes them better timeline markers than insects in forensic research (Perotti et al., Poecilochirus necrophori Vitzthum, 1930 is a phoretic mite 2009). species living in association with carrion and burying beetles (Baker and Schwarz, 1997). -

Insect Olfaction As an Information Filter for Chemo-Analytical Applications
Insect olfaction as an information filter for chemo-analytical applications Dissertation In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) of the Faculty of Forest Science and Forest Ecology Georg-August-University Göttingen Submitted by Sebastian Paczkowski, born in Berlin-Schöneberg Göttingen, 2013 1. Reviewer: Prof. Dr. Stefan Schütz 2. Reviewer: Prof. Dr. Ursula Kües Date of the oral examination: 29.05.2013 Acknowledgements I like to thank all the people who advised and supported my work at the department of forest zoology and forest protection. I also like to thank my supervisor, Prof. Dr. Stefan Schütz, for his support and advice. I further like to thank Prof. Dr. Ursula Kües for her supervision of this thesis and Prof. Dr. Edmone Roffael for the evaluation of my oral examination. I like to thank especially Dr. Bernhard Weissbecker and Dr. Gerrit Holighaus for their help and their critical opinions during so many discussions. Further thanks go to all of the present and former staff of the department of forest zoology and forest protection. Thank you very much: Dr. Kai Füldner, Prof. Dr. Sergio Angeli, Evelin Kistner, Brunhilde Brunotte, Dr. Prodepran Thakeow, Dr. Bettina Johne, Julian Heiermann, Dr. Sonja Weißsteiner, Christine Rachow, Jan Seelig, Dr. Maximilian von Fragstein und Niemstorff, Dr. Martin Gabriel, Sara Nicke, Friederike Maibaum, Kira Duntemann, Ulrike Eisenwiener, Jörg Berger, Ullrich Aschmann, Reinhold Dankworth, Dr. Ferdinant Rühe, and Roswita Walbrecht. I further like to thank all the external persons who supported my work: Prof. Dr. Claus-Dieter Kohl, Dr. Tilmann Sauerwald, Prof. Dr. Helmut Schmitz, Dr. -

Colour-Assisted Variation in Elytral ICP-OES-Based Ionomics in An
www.nature.com/scientificreports OPEN Colour‑assisted variation in elytral ICP‑OES‑based ionomics in an aposematic beetle Grzegorz Orłowski1*, Przemysław Niedzielski2, Jerzy Karg3 & Jędrzej Proch2 Very little is known about how the elemental composition (ionome) of an insect cuticle varies as a result of diferent colouration. Using inductively‑coupled plasma optical emission spectrometry (ICP‑OES), we established ionomic profles in microsamples of two adjacent regions of an insect cuticle with a contrasting colour pattern, namely, the black and orange regions of the elytra of the aposematic burying beetle Nicrophorus vespillo. The analysis revealed 53 elements (ranging in atomic weight from Na to Bi) occurring above the detection limit. The frequency of detectability of individual elements varied strongly, and only ten elements (Ba, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, Rb, Sb and Zn) were present in concentrations exceeding the detection limit in all the samples. The sum of concentrations of all elements in the orange regions of the elytra was 9% lower than in the black ones. The opposite distribution was displayed by the rare earth elements (REEs), the sum of which was 17% lower in the black elytral regions than in the orange ones. The concentrations of six elements were signifcantly higher in the black than in the orange regions: Al (by 97%), Cu (41%), Mn (14%), Na (46%), Se (97%) and W (47%). The concentrations of essential elements measured in both the black and orange regions exhibited very considerable variance: Ca (σ2 = 1834; 1882, respectively), K (145; 82) P (97; 76), Na (84; 53), Mg (24; 26) and Ba (9; 13).