Zeitschrift Der Deutschen Geologischen Gesellschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fachbeitrag Zur Aktualisierung Ausgewählter LRP-Schutzgüter
Fachbeitrag zur Aktualisierung ausgewählter LRP-Schutzgüter – Landkreis Northeim – Teilbericht Landschaftsbewertung Stand 30.06.2020 Auftragnehmer: Planungsgruppe Umwelt Stiftstraße 12, D-30159 Hannover Tel.: 0511/ 51 94 97 80 Fax: 0511/ 51 94 97 83 e-mail: [email protected] Bearbeitung: Dipl. Ing. Holger Runge M. Sc. Janna-Edna Bartels Auftraggeber: Landkreis Northeim Fachbereich 44 – Regionalplanung und Umweltschutz Medenheimer Straße 6/8 | 37154 Northeim Tel.: 05551 708-193 Tatiana Fahlbusch PLANUNGSGRUPPE UMWELT Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung und Anlass ................................................................................ 5 2 Untersuchungsgebiet ................................................................................. 6 3 Landschaftsbewertung .............................................................................. 8 3.1 Rechtliche Grundlagen ................................................................................. 8 3.2 Methodisches Vorgehen - Erfassung ............................................................ 9 3.2.1 Landschaftstypen ......................................................................................... 9 3.2.2 Erlebniswirksame Einzelelemente .............................................................. 12 3.2.3 Beeinträchtigungen .................................................................................... 12 3.3 Methodisches Vorgehen - Bewertung ......................................................... 12 3.3.1 Bewertung der Landschaftstypen .............................................................. -
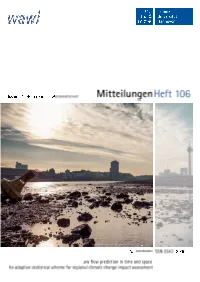
Low Flow Prediction in Time and Space
Low flow prediction in time and space An adaptive statistical scheme for regional climate change impact assessment Von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieurin - Dr.-Ing. - genehmigte Dissertation von Anne Fangmann, M.Sc. geboren am 26.07.1986 in Lohne 2017 Referent: Prof. Dr.-Ing. Uwe Haberlandt Korreferent: Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gregor Laaha Tag der Promotion: 01.12.2017 Danksagung Mein Dank richtet sich vor allem an Prof. Dr.-Ing. Uwe Haberlandt. Ohne seine Ideen, sein Wissen und die gute Betreuung während meiner Zeit am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen. Vielen Dank für die Unterstützung, die ständige Motivation und neuen Anregungen, und dafür, dass ich so viel bei Ihnen lernen durfte. Außerdem möchte ich mich bei den Mitgliedern meiner Promotionskommission bedanken: bei Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gregor Laaha für die Übernahme des Korreferats, sowie bei Prof. Dr. rer. nat. Insa Neuweiler und Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Rosenwinkel als Mitglieder des Promotionskollegiums. Ein großer Dank gilt außerdem Hannes Müller und Bastian Heinrich, die bei allen arbeitsbezogenen und privaten Sorgen zur Stelle waren und mir von Anfang an eine äußerst angenehme Zeit am Institut beschert haben. i Erklärung Hiermit versichere ich eidesstattlich, dass ich 1. die Regeln der geltenden Promotionsordnung kenne und eingehalten habe und mit einer Prüfung nach den Bestimmungen der Promotionsordnung einverstanden bin, 2. die Dissertation selbst verfasst habe, keine Textabschnitte von Dritten oder eigener Prüfungsarbeiten ohne Kennzeichnung übernommen und alle von mir benutzten Hilfsmittel und Quellen in meiner Arbeit angegeben habe, 3. -

Begründung Regionalen Raumordnungsprogramm 2016
Regionales Raumordnungsprogramm 2016, Begründung Seite 39 Begründung zum Regionalen Raumordnungsprogramm 2016 Seite 40 Regionales Raumordnungsprogramm 2016, Begründung Regionales Raumordnungsprogramm 2016, Begründung Seite 41 1 Gesamträumliche Entwicklung des Landes und seiner Teilräume 1.1. Entwicklung der räumlichen Struktur 01 Gemäß § 1 (1) des Raumordnungsgesetzes des Bundes (ROG) ist der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume durch zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Raumordnungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzu- stimmen, die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen und Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raumes zu treffen. In seiner ersten Festlegung definiert der Landkreis Hildesheim daher die Prinzipien, nach denen sich seine räumliche Entwicklung vollziehen soll. Diese lassen sich zu zwei Leitbildern zusammenfassen: 1.) Nachhaltigkeit Der Begriff der Nachhaltigkeit besitzt seinen Ursprung in der Forstwirtschaft und beschreibt dabei den Umstand, dass nicht mehr Holz eingeschlagen werden darf, als in einem bestimm- ten Zeitraum wieder nachwächst. Inzwischen hat der Begriff Eingang in die politische und strategische Diskussion bis hin zur Gesetzgebung (u.a. ROG, BauGB) gefunden. Entspre- chend existiert eine Vielzahl von Interpretationen dieses Begriffs, wobei es keine -

Dokumentation Leine-Lachs
DokumentationDokumentation LeineLeine --LachsLachs Ein Wiedereinbürgerungsprojekt des Vereins 2007 Grußwort Gemeinsames Grußwort des Nds. Ministerpräsidenten Christian Wulff und des Ministers für den ländlichen Raum, Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz Hans- Heinrich Ehlen für die „Dokumentation Leinelachs“ Leine-Lachs e.V. Der Atlantische Lachs gehört zu den autochthonen Fischarten in den niedersächsischen Gewässern, denn aus zahlreichen Quellen ist sein historisches Vorkommen in den Flusssystemen von Elbe, Weser und Ems belegt. Erst im letzten Jahrhundert führten Ausbaumaßnahmen an den Gewässern und zunehmende Abwasserbelastungen dazu, dass die traditionellen Laichplätze verschwanden oder der Zugang durch die Errichtung von Querbauwerken unterbrochen wurde. In der Folge verschwand der Lachs aus unseren Gewässersystemen. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen durch mannigfaltige Anstrengungen wieder grundlegend verbessert. Erfolge in der Reinhaltung der Gewässer und ein wachsendes Verständnis für ökologische Zusammenhänge und Erfordernisse haben inzwischen die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich die Lebensbedingungen für die heimische Fischfauna wieder deutlich verbessert haben. Diese Entwicklung haben die niedersächsischen Fischereivereine genutzt, um in eigener Initiative im Rahmen der Hege verschwundene Fischarten wieder anzusiedeln oder stark gefährdete Arten in ihrem Vorkommen zu unterstützen. Zu diesen geförderten Arten gehören auch die Großsalmoniden Lachs und Meerforelle. Ausgehend von -
(Von Scheeßel Bis Bad Gandersheim / Seesen) Unterlagen Nach § 8 NABEG
Bundesfachplanung SUEDLINK A100_ArgeSL_P8_V3_B_PWZ_1002 Der Inhalt gibt die Ansicht der Vorhabenträger wieder und nicht die Meinung der Europäischen Kommission Höchstspannungsleitung Brunsbüttel – Großgartach BBPIG Vorhaben Nr. 3 Abschnitt B (von Scheeßel bis Bad Gandersheim / Seesen) Unterlagen nach § 8 NABEG VI FACHBEITRAG ZUR PROGNOSE DER WASSERRECHTLICHEN ZULÄSSIGKEIT ANHANG 2: EMPFINDLICHKEITEN DER KRITERIEN IM UNTERSUCHUNGSRAUM 0 22.03.2019 Unterlagen nach § 8 NABEG KrüJ, WeiH HorG PehM Vers. Datum Ausgabe, Art der Änderung Erstellt Geprüft Freigegeben Entwurf zur Vollständigkeitsprüfung ARGE SuedLink Bundesfachplanung SUEDLINK © ArgeSL 2019 Bundesfachplanung SUEDLINK A100_ArgeSL_P8_V3_B_PWZ_1002 IV Fachbeitrag zur Prognose der wasserrechtlichen Zulässigkeit, Anhang 2 Vorhaben Nr. 3, Abschnitt B INHALTSVERZEICHNIS 1 EMPFINDLICHKEITEN DER KRITERIEN IM UNTERSUCHUNGSRAUM 2 1.1 Empfindlichkeiten der Schutzgebiete 2 1.2 Empfindlichkeiten der Gewässerrandstreifen* und Uferzonen 6 1.3 Empfindlichkeiten der Überschwemmungsgebiete und Hochwasserrisikogebiete 7 1.4 Empfindlichkeiten der Oberflächengewässer und Grundwasserkörper gemäß WRRL 10 TABELLENVERZEICHNIS Tabelle 1: Liste und Empfindlichkeiten der Wasserschutzgebiete im Untersuchungsraum 2 Tabelle 2: Liste und Empfindlichkeiten der Einzugsgebiete von Wassergewinnungsanlagen im Untersuchungsraum 4 Tabelle 3: Liste der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Wasserversorgung bzw. Trinkwasserschutz im Untersuchungsraum 5 Tabelle 4: Liste und Empfindlichkeiten der Uferzonen an Fließgewässern und -

E&G Quaternary Science Journal Vol. 66/1
issn 0424-7116 | DOi 10.3285/eg.66.1 Edited by the German Quaternary Association Editor-in-Chief: Margot Böse & EEiszeitalter und GegenwartG Quaternary Science Journal Vol. 66 LifE in DOggErLanD – paLynologiCaL invEstigatiOns Of thE EnvirOnMEnt No 1 Of prEhistOriC huntEr-gathErEr sOCiEtiEs in thE nOrth sEa Basin 2017 spring fED raisED pEat huMMOCks with tufa DEpOsits at thE farBEBErg hiLLs (nOrthwEst-gErMany) pLEistOzänE (ELstEr- unD saaLEzEitLiChE) gLaziLiMnisChE BECkEntOnE unD -sChLuffE in niEDErsaChsEn/nw-DEutsChLanD thE MOrphologiCaL units BEtwEEn thE EnD MOrainEs Of thE pOMEranian phasE anD thE EBErswaLDE iCE-MarginaL vaLLEy (urstrOMtaL), gErMany GEOZON & EEiszeitalter und GegenwartG Quaternary Science Journal Volume 66 / number 1 / 2017 / DOI: 10.3285/eg.66.1 / iSSn 0424-7116 / www.quaternary-science.net / Founded in 1951 Editor EXPrEss rEPORTS' Editor KArl-Ernst BEHrE, lower Saxonian institute of Historical Coastal research, Wilhelmshaven, DEUQUA inGMAr UnKEl, institut ökosystemforschung, Germany Deutsche Quartärvereinigung e.V. Christian-Albrechts-Universität Kiel, Germany Stilleweg 2 PHiliP GibbarD, Department of Geography, D-30655 Hannover, Germany thEsis ABSTRACTS' Editor University of Cambridge, Great Britain Tel: +49 (0) 511 / 643 36 13 BErnHArD SAlCHEr, AG Geologie, Quartär- Volli E. KAlM, institute of Ecology and Earth E-Mail: info (at) deuqua.de geologie, Universität Salzburg, Austria Sciences, University of Tartu, Estonia www.deuqua.org CESArE Ravazzi, institute for the Dynamics of AssociAtE Editors Editor-in-chiEf Environmental -

Holiday Magazin Hildesheim Region
HOLIDAY MAGAZIN HILDESHEIM REGION Holiday tips, accommodation and the best events of 2019 HOLIDAY MAGAZIN HILDESHEIM 2019 | Willkommen WORLD HERITAGE VISITOR CENTRE HILDESHEIM & TOURIST INFORMATION Service, advice and booking • UNESCO World Heritage exhibition • Accommodation and arrangements • Conference and congress services • Ascent of St Andrew‘s Church steeple • City and costumed guided tours • Special tours around the region • Segway tours of Hildesheim • E-bike rental • Souvenirs, travel guides, books and maps (also available online at www.hildesheim.de/online-shop) • Special museum exhibitions • Events and festivals • Cycling and hiking tours • Places of interest in and around Hildesheim Multimedia World Heritage exhibition Touchscreens, 3D models, panoramic views and interactive inter- faces provide visitors with entertaining information about UNES- CO World Heritage Sites in Hildesheim, in the Hildesheim region and around the world. The exhibition invites visitors to immerse themselves into multimedia worlds, to discover new facts and leads them on their journey. Visitors can watch, be amazed, go hands-on, while away the time or join in the fun. Entry is free. Short guided tours for groups on request. Hildesheim Marketing GmbH It‘s the ideal introduction to any visit to Hildesheim! World Heritage Visitor Centre Hildesheim & Tourist Information Rathausstr. 20 (Tempelhaus) · 31134 Hildesheim Opening hours: Monday to Friday 9.30 a.m. - 6 p.m. Telephone: +49 (0) 5121 1798-0 Fax: +49 (0) 5121 1798-88 Saturday 10 a.m. - 3 p.m., April to October and during Advent, E-mail: [email protected] including Sunday, 10 a.m. - 3 p.m. Internet: www.hildesheim.de/tourism 2 contents | HOLIDAY MAGAZIN HILDESHEIM 2019 CONTENTS Hildesheim Region UNESCO World Heritage Sites Museums, art and exhibitions Castles, palaces and pp. -

Geologischen Karte
ii? 340 WWW; Erläuterungen Geologischen Karte V011 Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 182. Blatt Lamsoringe. Gradabteilung 55, Nr. 5. Geologisch bearbeitet durch 0. Grupo, W. Haaok und F. Schuoht. Erläutert durch 0. Grupe und W. Haack (Buntsandstein, Muschelkalk). Mit einem bergbaulichen Teil von E. Seidl. Mit 2 Figuren. BERLII. Im Vertrieb bei der Königlichen Geologischen Landesanstalt Berlin N. 4, Invalidenstraße 44. 1915. Komgl. Un1vers1tats- Blbl1othek zu Gottmgen. Geschenk ä des Kgl Ministeriums der geistlichen aaamaaaaaaaaaaäUnterrichts-and-Med»—Angelegenheiten zu Berlin. gnaw 1,9!n Blatt Lamspringe. 5 Gradabteilung 55 (Breite 520 Läng‘ 270/280) Blatt No.5. 10’ Geologisch bearbeitet durch 0. Grupe, W. Haack und F. Schucht. Erläutert durch 0. Grape und W. Haack (Buntsaudstein, Muschelkalk). Mit einem bergbaulichen Teil von E. Soidl. Mit 2 Figuren. SUB8(Stämmen T“um“mmmum Oberflächengestaltung. Das Blatt Lamspringe erhält seinen morphologischen Charakter durch eine Reihe bewaldeter Bergketten, die in Südost-nordwest— licher Richtung verlaufen und durch mehr oder weniger ausge— prägte Längstäler von einander geschieden werden. Ihre durch— schnittliche Höhenlage beträgt 250——300 m, seltener über 300 m. Unter diesen Bergketten tritt im Süden besonders auffällig der Heber durch seine lange, gerade Erstreckung und die Ge— schlossenheit seiner Form hervor. Sie steht im Gegensatz sowohl zu der unruhigen Oberfläche des seinem südwestlichen Fuße vor— gelagerten Feldgeländes, das durch das ziemlich regellos verlaufende Talsystem der Gande in einzelne Plateaus und Kuppen aufgelöst erscheint, wie auch zu den nach Nordosten zu folgenden Berg- kämmen, die eine minder lange Erstreckung besitzen und von Tälchen und WVasserrissen in stärkerem Maße zerschnitten werden. -

Erläuterungen RROP 2001
RROP für den Landkreis Hildesheim, Erläuterung Seite 77 Erläuterungen zum Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Hildesheim 2001 Die Erläuterungen sind nicht Bestandteil der Satzung, sie liefern Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Themenbereichen und erklären bzw. begründen die aufgestellten Ziele und Grund- sätze. Es wurde darauf verzichtet, jede einzelne Ziel bzw. jeden einzelnen Grundsatz im Detail zu erläutern, vielmehr erfolgt eine Konzentration auf inhaltliche Schwerpunkte. Den Erläuterungen ist eine Analyse allgemeiner Strukturdaten vorangestellt. Seite 78 RROP für den Landkreis Hildesheim, Erläuterung 0. Allgemeine Strukturdaten des Landkreises Hildesheim Raumordnung und Landesplanung sollen die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine umwelt- gerechte und zukunftsgerichtete Entwicklung des Landes schaffen. Ein Ziel ist die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes. Dieses Ziel ist in einem Flächen- landkreis mit erheblichen topographischen, siedlungs- und wirtschaftsstrukturellen Unterschieden wie dem Landkreis Hildesheim von besonderer Bedeutung. Eine Analyse der Bevölke- rungsverteilung und -entwicklung sowie der Wirtschaftsstruktur ist daher erforderlich und wird den Erläuterungen vorangestellt. Im Landkreis Hildesheim leben auf einer Fläche von 1205,5 km2 292.466 Einwohner1). Die durch- schnittliche Bevölkerungsdichte liegt mit 243 Einwohner je km2 über dem Landesdurchschnitt von 164 Einwohner je km2. Der Anteil der 19 kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden