Goethe-Jahrbuch 2012 Band 129
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE POETIC MUSE: GOETHE, SCHUBERT and the ART of SONG Lorraine Byrne Bodley Anyone Who Ventures Into the Vast Regions of The
THE POETIC MUSE: GOETHE, SCHUBERT AND THE ART OF SONG Lorraine Byrne Bodley Anyone who ventures into the vast regions of the 19th-century Lied meets a powerful presence almost immediately. Time and again the text is by Goethe, whose lyric imagination left an indomitable imprint on European music history. Even a cursory glance at Friedlaender’s Das deutsche Lied bears testimony to multiple settings of Goethe’s poems and the range and variety of this abundant repertoire is immediately striking. Ernst Challier’s Grosser Lieder-Katalog gives further evidence of the musicality of Goethe’s language and its location of meaning at the cradle of the Lied. Schubert’s first masterpiece, ‘Gretchen am Spinnrade’, was a setting of a dramatic scene from Goethe’s Faust. The earliest songs of Reichardt, Spohr, Loewe, Brahms and Wagner were to texts by Goethe, which raises the question as to the reasons for the poet’s influence. Yes, Goethe was a supreme lyric poet. The binding force of form and meaning, or rhythm and sense, that characterizes Goethe’s lyric poetry offered composers a wealth of material with which to cut their compositional cloth. Yes, Goethe was an object of admiration, even veneration, throughout the 19th century and the sheer quantity and variety of music his poetry has inspired signals the huge fascination exerted by his writing and his personality. Yet the steadfastness of his occupancy of the Lied goes beyond these explanations. Deeper currents must explain why Goethe’s poetry goes hand in glove in our musical heritage. From the time he burst onto the literary scene with the publication of Die Leiden des jungen Werther in 1774 until long after his death in 1832, Goethe was a catalyst for many composers who wanted to challenge what song could be. -

Industrialism, Androids, and the Virtuoso Instrumentalist
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Performing the Mechanical: Industrialism, Androids, and the Virtuoso Instrumentalist A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Musical Arts by Leila Mintaha Nassar-Fredell 2013 © Copyright by Leila Mintaha Nassar-Fredell 2013 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Performing the Mechanical: Industrialism, Androids, and the Virtuoso Instrumentalist by Leila Nassar-Fredell Doctor of Musical Arts University of California, Los Angeles, 2013 Professor Robert S. Winter, Chair Transactions between musical androids and actual virtuosos occupied a prominent place in the music of the eighteenth and nineteenth centuries. Instrumentalists and composers of instrumental music appropriated the craze for clockwork soloists, placing music in a position of increased social power in a society undergoing rapid technological transformation. The history of musical automata stretches back to antiquity. Androids and automata, vested by audiences with spiritual and magical qualities, populated the churches of the broader populations and the Renaissance grottos of the aristocracy. As ii the Industrial Revolution began, automata increasingly resembled the machines changing the structure of labor; consequently, androids lost their enchanted status. Contemporary writers problematized these humanoid machines while at the same time popularizing their role as representatives of the uncanny at the boundaries of human identity. Both instrumental performers and androids explored the liminal area between human and machine. As androids lost their magic, musical virtuosos assumed the qualities of spectacle and spirituality long embodied by their machine counterparts. In this process virtuosi explored the liminal space of human machines: a human playing a musical instrument (a machine) weds the body to a machine, creating a half-human, half-fabricated voice. -
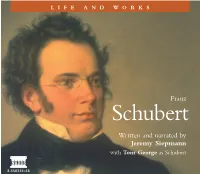
Franz Schubert Written and Narrated by Jeremy Siepmann with Tom George As Schubert
LIFE AND WORKS Franz Schubert Written and narrated by Jeremy Siepmann with Tom George as Schubert 8.558135–38 Life and Works: Franz Schubert Preface If music is ‘about’ anything, it’s about life. No other medium can so quickly or more comprehensively lay bare the very soul of those who make or compose it. Biographies confined to the limitations of text are therefore at a serious disadvantage when it comes to the lives of composers. Only by combining verbal language with the music itself can one hope to achieve a fully rounded portrait. In the present series, the words of composers and their contemporaries are brought to life by distinguished actors in a narrative liberally spiced with musical illustrations. Unlike the standard audio portrait, the music is not used here simply for purposes of illustration within a basically narrative context. Thus we often hear very substantial chunks, and in several cases whole movements, which may be felt by some to ‘interrupt’ the story; but as its title implies the series is not just about the lives of the great composers, it is also an exploration of their works. Dismemberment of these for ‘theatrical’ effect would thus be almost sacrilegious! Likewise, the booklet is more than a complementary appendage and may be read independently, with no loss of interest or connection. Jeremy Siepmann 8.558135–38 3 Life and Works: Franz Schubert © AKG Portrait of Franz Schubert, watercolour, by Wilhelm August Rieder 8.558135–38 Life and Works: Franz Schubert Franz Schubert(1797-1828) Contents Page Track Lists 6 Cast 11 1 Historical Background: The Nineteenth Century 16 2 Schubert in His Time 26 3 The Major Works and Their Significance 41 4 A Graded Listening Plan 68 5 Recommended Reading 76 6 Personalities 82 7 A Calendar of Schubert’s Life 98 8 Glossary 132 The full spoken text can be found on the CD-ROM part of the discs and at: www.naxos.com/lifeandworks/schubert/spokentext 8.558135–38 5 Life and Works: Franz Schubert 1 Piano Quintet in A major (‘Trout’), D. -

Goethe's Faust Essay Prize for Sixth-Formers Further Resources
A German Classic: Goethe’s Faust Essay Prize for Sixth-Formers Further Resources Urfaust and Faust, Part II Johann Wolfgang von Goethe: Urfaust (1775) Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Der Tragödie zweiter Teil (1832) Faust before Goethe Johann Spies: Historia von D. Johann Fausten (1587) Christopher Marlowe: Doctor Faustus (1592) Faust after Goethe Thomas Mann: Doktor Faustus (1947) Faust as film Faust, dir. by F.W. Murnau, with Gösta Ekman, Emil Jannings and Camilla Horn(silent film, 1926) Faust, dir. by Alexander Sokurov, with Johannes Zeiler, Anton Adasinsky and Isolda Dychauk (Russian film, 2011) Faust and music Franz Schubert: Gretchen am Spinnrade (Lied, 1814) Hear Kiri Te Kanawa sing Gretchen’s love song ‘Meine Ruh ist hin’ (‘My peace has gone’) (https://www.youtube.com/watch?v=MY0eeotSDi8). You may also wish to have a look at – and listen to – this course on Schubert’s settings of Goethe’s poems: http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/history-art/schuberts-lieder- settings-goethes-poems/content-section-0 Hector Berlioz, La damnation de Faust (opera, 1846) – see the production by Monty Python’s Terry Gilliam (http://www.bbc.co.uk/programmes/b010xwhh) Charles Gounod: Faust (opera, 1859) Ferruccio Busoni: Doktor Faust (opera, 1924) Faust to go In case you’re in need of some light inspiration, here is a summary of Faust I. Don’t worry if you can’t even begin to keep up with Michael Sommer’s German – he speaks extraordinarily fast and uses slang and rather specialised allusions. But you should be able to work out -

Schubert Lieder
CHRISTIAN ELSNER SCHUBERT LIEDER ORCHESTRATED BY MAX REGER & ANTON WEBERN Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin Marek Janowski FRANZ SCHUBERT (1797–1828) 6 Prometheus D 674 5. 09 Poem by Johann Wolfgang von Goethe Lieder Orchestrated by Max Reger Orchestrated by Max Reger and Anton Webern 7 Nacht und Träume (Heil’ge Nacht, du sinkest nieder) D 827 2. 38 1 An die Musik (Du holde Kunst) D 547 2. 07 Poem by Matthäus von Collin Poem by Franz von Schober Orchestrated by Max Reger Orchestrated by Max Reger Gesänge des Harfners D 478 2 Erlkönig D 328 3. 49 Lyrics from “Wilhelm Meisters Lehrjahre” by Johann Wolfgang Poem by Johann Wolfgang von Goethe von Goethe Orchestrated by Max Reger Orchestrated by Max Reger 8 No. 1: Wer sich der Einsamkeit ergibt 3. 52 3 Du bist die Ruh’ D 776 3. 09 9 No. 2: Wer nie sein Brot mit Tränen aß 4. 11 Poem by Friedrich Rückert 10 No. 3: An die Türen will ich schleichen 2. 06 Orchestrated by Anton Webern 11 Gruppe aus dem Tartarus D 583 3. 01 4 Greisengesang (Der Frost hat mir bereifet) D 778 6. 02 Poem by Friedrich Schiller Poem by Friedrich Rückert Orchestrated by Max Reger Orchestrated by Max Reger 12 Tränenregen (from “Die schöne Müllerin”) D 795 No. 10 5. 35 5 An den Mond D 296 3. 54 Poem by Wilhelm Müller Poem by Johann Wolfgang von Goethe Orchestrated by Anton Webern Orchestrated by Max Reger 13 Der Wegweiser (from “Die Winterreise”) D 911 No. 20 4. 06 Poem by Wilhelm Müller Orchestrated by Anton Webern 14 Memnon (Den Tag hindurch nur einmal mag ich sprechen) D 541 3. -

Faust, Part I Ebook Free Download
FAUST, PART I PDF, EPUB, EBOOK Goethe | 240 pages | 28 Aug 2015 | Penguin Books Ltd | 9780140449013 | English | London, United Kingdom Faust, Part I PDF Book But forever green is the tree of life. Get Faust. Reed puts it in his biography Goethe of Goethe and Schiller and is considered the culmination of German literature. Hopkins, G. The close of the 18th century in Germany was a time very much like the Renaissance. Refresh and try again. Homunculus, Mephistopheles, and Faust went to Greece, where Mephistopheles borrowed from the fantastic images of classical mythology one of their grotesque forms. External Websites. If there be spirits in the air That hold their sway between the earth and sky, Descend out of the golden vapors there And sweep me into iridescent life. After a painful struggle with himself, Faustus is carried off by the devil at the end of the play. In what ways does Goethe's depiction of Heaven seem unorthodox? Relevant discussion may be found on the talk page. He drew on an immense variety of cultural material—theological, mythological, philosophical, political, economic, scientific, aesthetic , musical, literary—for the more realistic Part I no less than for the more symbolic Part II. Previous Poem Summary. Mephistopheles brings Marthe the news that her long absent husband has died. The history of the legend's development and its expansion into broader moral and philosophical spheres is also an intellectual history of mankind. A remedy. Gretchen and Lieschen's discussion of an unmarried mother, in the scene at the Well, confirms the reader's suspicion of Gretchen's pregnancy. -

Functions of Metrical Dissonance in Schubert's Songs
Functions of Metrical Dissonance in Schubert’s Songs Harald Krebs ABSTRACT Schubert employs both grouping and displacement dis- sonance very effectively in his Lieder, with definite ends in view. Much of his metrical dissonance could be termed pictorial or onomatopoeic; metrical conflicts in his piano parts often conjure up particular sounds or actions that are mentioned in the text. Many of the metrical dissonances in Schubert’s songs represent not physical objects or activity, but internal, spiritual phenomena – particularly inner upheavals and tensions. Metrical dissonances in Schubert’s songs may also have purely structural instead of, or in addition to repre- sentational functions. In Winterreise, for instance, the disso- nances, beyond their various text-related connotations, also assume a motivic function: particular specific displacement dissonances recur frequently. In Schubert’s tonally deviating songs—songs that begin in one key and end in another— metrical dissonance may act as a highlighter of significant moments within the tonal drama. The analyses provided here reveal that Schubert is a pioneer of the powerful appli- cation of metrical dissonance in the Lied, and that his skill at subtly manipulating this device for text-expressive and struc- tural purposes was no less remarkable than that reflected in his manipulation of harmony and tonality. 1 2 Harald Krebs We can conceive of musical meter as a set of layers of regular pulses, those pulses being created by various types of accents, by repetitions of patterns, by changes of harmony, and other musical features. Each notated meter is defined by a particular set of lay- ers—six-eight time, for instance, by aligned six- and three-eighth- note layers. -

Goethe's Faust in Music
Music in Goethe’s Faust: INTERNATIONAL CONFERENCE Goethe’s Faust in Music CALL FOR PAPERS 20-22 April 2012 Music Department and School of Modern Languages, Literatures and Culture NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH Music in Goethe’s Faust: Goethe’s Faust in Music Keynote Speakers Professor Nicholas Boyle (Schroeder Professor of German, Magdalene College Cambridge) Professor Thomas Bauman (Professor of Musicology, Northwestern University, USA) Professor Osman Durrani (Professor of German, University of Kent) The name ‘Faust’ and the adjective ‘faustian’ are as emblematic of the supra-intellectual as they are of the tragic. Such concepts haunt German cultural life and have prompted countless discussions in philosophy, literature, the visual arts and music, especially in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries. Through this a broad trajectory can be traced from Zelter’s colourful record of the first setting of Goethe’s Faust - composed by prince and rehearsed by a royal cast in Berlin in 1816 - to Alfred Schnittke’s Faust opera of 1993. Between these two realizations, a floodtide of musical interpretations of Goethe’s Faust came into existence; these explore the theme of love, so central to opera, and the concomitant themes of redemption for both Gretchen and Faust. A theatrical work with the artistic virtuosity and moral gravity of Goethe’s Faust need not be musically inclusive, yet Goethe sought out many burgeoning musicians - Heinrich Schmieder, Carl Friedrich Zelter, Carl Eberwein and Prince Anton Heinrich Radziwill – as possible composers of Faust. While Goethe longed to have Faust set to music and considered only Mozart and perhaps Meyerbeer as being equal to the task, by the end of his life he had abandoned hope that he would live to witness a musical setting of his text. -

Dokumentationen Zum Sächsischen Bergbau
Dokumentationen zum Sächsischen Bergbau Reihe 2: Kohle Gewinnung und Verarbeitung in Sachsen Band 1: Geologie und Geschichte des Steinkohlen- bergbaus von Hainichen Recherchestand Dezember 2015 Autor: G. Mühlmann Herausgegeben vom Bergbauverein Hülfe des Herrn, Alte Silberfundgrube e. V. Merzdorf / Biensdorf Biensdorf, Dezember 2016 Unbekannter Bergbau Dokumentationen zum sächsischen Bergbau, Kohle – Band 1 Reihe 2: Zum Steinkohlenbergbau: Band 1: Zur Geologie und Geschichte des Steinkohlen- bergbaus von Hainichen Inhalt 1. Zum Geleit............................................................................................................... 2 2. Zur Geologie des nordöstlichsten Teils des Erzgebirge Beckens ............................ 4 2.1 Die Mulde von Chemnitz-Hainichen oder das Karbon von Hainichen-Ebersdorf und Borna bei Chemnitz ......................................................................................... 4 2.2 Die Hainichen-Schichten, die Hainichen-Subgruppe oder die Frühmolassen von Borna-Hainichen ..................................................................................................... 8 2.3 Die Steinkohlenlagerstätte von Hainichen- Berthelsdorf oder nach Geinitz: „Das Hainichener Kohlenbassin“ ................................................................................... 16 2.4 Die Steinkohlenlagerstätte von Chemnitz, Borna und Ebersdorf oder nach Geinitz: „Das Ebersdorfer Kohlenbassin“ ........................................................................... 22 2.5 Weitere Bodenschätze in der -

Interpreting Travel Writings of the Ticknors and Other Privileg
WHAT AMERICANS SAID ABOUT SAXONY, AND WHAT THIS SAYS ABOUT THEM: INTERPRETING TRAVEL WRITINGS OF THE TICKNORS AND OTHER PRIVILEGED AMERICANS 1800-1850 by ASHLEY SIDES Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS IN HISTORY THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON May 2008 Copyright © by Ashley Sides 2008 All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS To God I am thankful for the fascinating complexity of humanity, which makes the study of history so challenging and interesting, and for the opportunity and ability to pursue studies of this history. I am also deeply grateful for the support of my wife, Jamie, through this process. From the very beginning she has made my goals hers, has encouraged me, and has patiently sacrificed to help me get through this Master’s program. I dedicate this work to her. I have been blessed to study under excellent professors at the University of Texas at Arlington. Some, in particular, stand out. Professor Thomas Adam has been the most important influence in my graduate studies. He introduced me to the Ticknors and their journals in the first place, and has mentored me through a graduate research assistantship and this thesis. I am indebted to him for the topic of this thesis, which he suggested and I ultimately found quite fascinating. Professors Steven Reinhardt and Joyce Goldberg have helped me to improve my writing by their strict emphasis on good use of language. I also greatly enjoyed working for Professor Goldberg as a graduate teaching assistant, in the process learning a lot about the art of teaching college students. -

3"79 A/8/J Alo, ^O<A.0
3"79 A/8/J AlO, ^O<A.0 LUTHER, HERDER, AND RANKE: THE REFORMATION'S IMPACT ON GERMAN IDEALIST HISTORIOGRAPHY DISSERTATION Presented to the Graduate Council of the North Texas State University in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By Lowell Anthony Cook, M.A. Denton, Texas August, 1983 Cook, Lowell Anthony, Luther. Herder, and Ranke: The Reformation's Impact on German Idealist Historiography. Doctor of Philosophy (History), August, 1983, 191 pp., bibliography, 74 titles. The influence of Martin Luther on the Idealist philos- ophy and historical writing of Johann Gottfried Herder and Leopold Ranke Is part of a broader inquiry into the signif- icant impact of the Protestant Reformation on the modern Western world. Herder and Ranke, whose work In historical research and writing spanned a period from the later eigh- teenth century to the close of the nineteenth century, represented an Idealist generation which sought a new meaning in human history to replace the view of the Enlightenment. Coming from Lutheran backgrounds and Identifying closely with Luther, Herder and Ranke moved away from traditional theological dogma and toward the dynamic of human history. They adapted the major outlines of Luther's theology to his- tory. Luther's dualism of the temporal and spiritual king- doms became the real and ideal realms of history, which re- flect the hand of God In human affairs. Luther's view of the organic character of human circumstances became the dynamic of history which moves behind the appearance of historical events. Luther's view of faith provided a way of perceiving the spiritual reality of history which reason alone could not discover. -

Carl Von Clausewitz in French Captivity, 1806–1807
‘Do not despair at your fate’: Carl von Clausewitz in French Captivity, 1806–1807 Sibylle Scheipers Date of deposit 08 10 2018 Document version Author’s accepted manuscript Access rights Copyright © The Author(s) 2019. This work is made available online in accordance with the publisher’s policies. This is the author created, accepted version manuscript following peer review and may differ slightly from the final published version. Citation for Scheipers, S. (2019). 'Do not despair at your fate': Carl von published version Clausewitz in French captivity, 1806-1807. War in History, OnlineFirst. Link to published https://doi.org/10.1177/0968344518804840 version Full metadata for this item is available in St Andrews Research Repository at: https://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Introduction Carl von Clausewitz is widely regarded as an acute observer and contemporary witness of the French Revolutionary and Napoleonic Wars. Yet his own experience of French captivity in 1806-1807 – well documented in his letters to his fiancée Marie von Brühl – has not been studied in depth. It gives fascinating insights not only into Clausewitz’ own evaluation of his time in captivity, but also in the inner workings of the broader transformation of war during that period. Peter Paret states in his seminal intellectual biography of Clausewitz that his time in captivity had a great impact on his career and his life. Yet, he only devotes six print pages of his biography to that phase of Clausewitz’s life.1 What stands out for Paret is ‘the hurt to his [Clausewitz’s] patriotism’ induced by the experience of defeat and captivity and his ensuing identification with the Prussian state.2 In contrast to Paret, Donald Stoker in his Clausewitz biography recognises that the reference point of Clausewitz patriotism during his time in captivity was not necessarily the Prussian state, but the German nation.3 Yet Stoker devotes hardly any more pages than Paret to exploring the tension between these two reference points.