Florenwandel in Der Sächsischen Schweiz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
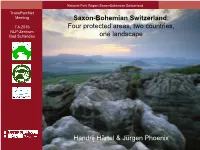
Saxon-Bohemian Switzerland Transparcnet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland
National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 Four protected areas, two countries, NLP-Zentrum Bad Schandau one landscape Handrij Härtel & Jürgen Phoenix National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: Discovery by Romantic painters Adrian Zingg (1734-1816) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland Caspar David Friedrich (1774 Greifswald - 1840 Dresden) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland Caspar David Friedrich (1774 Greifswald - 1840 Dresden) National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: One of the oldest European tourist destinations Protected areas in sandstone rock regions across the world National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 Singularity in European context: NLP-Zentrum Bad Schandau 3 sandstone rock national parks only National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland 7.6.2016 as part of larger geological unit NLP-Zentrum Bad Schandau Bohemian Cretaceous Basin PL D CZ Marine fossils from Cretaceous sandstones Inoceramus labiatus Natica bulbiformis Pecten Inoceramus lamarcky National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 NLP-Zentrum High diversity of morphologic forms at different Bad Schandau spatial scales Saxon-Bohemian Switzerland: Terciary volcanism Růžovský vrch Zlatý vrch National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland TransParcNet Meeting Saxon-Bohemian Switzerland: 7.6.2016 geodiversity-biodiversity relations NLP-Zentrum Bad Schandau Saxon-Bohemian Switzerland: role of microclimate Saxon-Bohemian Switzerland: vertebrates Grasshopper Troglophilus neglectus New for Central Europe (Chládek, Benda & Trýzna 2000) Charissa glaucinaria Extremely rare montane species, within CZ in Bohemian Switzerland only L – Phengaris nausithous R – Phengaris telejus Monitoring of the butterflies from the gen. -

Creation of Sustainable Public Transport in the National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland
National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Creation of sustainable public transport in the National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Jürgen Phoenix, NPA Saxon Switzerland National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Saxon-Bohemian Switzerland: Protected Landscape Area (D): 287 km² Protected Landscape Area (CZ): 245 km² National Park (D): 93 km² National Park (CZ): 80 km² National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Situation analysis - tourism is the most important economic sector in the region, - but the large number of visitors causes risks for the protected areas, - one problem area is the private vehicle traffic of visitors (although the region is very well connected by public transport). keeping the situation in balance takes a lot of communication and cooperation between the different stakeholders. National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Traffic calming - a never-ending story? Traffic calming is a long-term task, don´t let any failures discourage you, after defeat get back on your feet again. National Park Region Saxon-Bohemian Switzerland Experiences from 25 years involvement in traffic calming Traffic regulation and public transport don´t fall within the jurisdiction of the National Park administration. Its possibilities are limited: - to chair processes, - to provide ideas, - to support projects and plannings with (limited) finances. Changes in the main points 1990 – 2000 the stakeholders gave a lukewarm reaction to the topic, the activities focused on the private vehicle traffic of the visitors. since -

Where Steam Engines Meet Sandstone
TIMETABLE 2 01 9 Where steam engines meet sandstone. 1 Experience boat travel Established 1836! Dear Guests, Steamboat 90 years Leipzig With its nine historical paddle steamers, the Sächsische Dampfschif- Put into service: 11.05.1929 fahrt is the oldest and largest steamboat fleet in the world. In excep- tional manner and depth, this service combines riverside experience, Steamboat Dresden technical fascination and culinary delight. While you are amazed by Put into service: 02.07.1926 the incomparable Elbe landscape with the imposing rock formations in Saxon Switzerland, the impressive buildings of Dresden and Meissen, Steamboat Pillnitz and the delightful wine region between Radebeul and Diesbar-Seusslitz Put into service: 16.05.1886 you can also enjoy regional and seasonal food and beverages. Whether travelling with the lovingly restored paddle steamers or with the air- Steamboat Meissen conditioned salon ships, lean back and enjoy the breathtaking views. Put into service: 17.05.1885 We would like to impress you with our comprehensive offer of expe- riences and hope to continually surprise you. With this I would like to Steamboat 140 wish you an all-encompassing, relaxing trip on board. years Stadt Wehlen Put into service: 18.05.1879 Yours, Karin Hildebrand Steamboat Pirna Put into service: 22.05.1898 Steamboat Kurort Rathen contents Put into service: 02.05.1896 En route in Dresden city area 4 Steamboat Our special event trips 8 Krippen Put into service: 05.06.1892 Winter and Christmas Cruises 22 En route in and around Meissen 26 Steamboat En route in Saxon Switzerland 28 Diesbar Put into service: 15.05.1884 Our KombiTickets 32 Dresden’s “Terrassenufer” under steam 40 Motor ship 25 Anniversary ships 42 years August der Starke put into service: 19.05.1994 Historic Calendar 44 Souvenirs & Co. -

Cherry Picking in Saxony
134 << DREAM TRIP >> << DREAM TRIP >> 135 CHERRY PICKING IN SAXONY Wonderful hiking along the award-winning Malerweg trail and its other adventurous tracks – Germany can be so pretty. Text & Photos: Ralf Gantzhorn & Michael Neumann A setting like in a movie – close to the Schrammsteine. 136 << DREAM TRIP >> 137 Germany’s most famous stack of rocks and unparalleled tourist magnet: the Bastei above Rathen. of general education. We strolled through the Bastei forest towards Wehlgrund, which was followed by one of those changes of landscapes typical of Saxon Swit- zerland: first, a harmless stroll through fertile fields and autumnal beech groves, and suddenly, without any warning – wow! – the dizzy view “So, what about another Eibauer?” Miss Schubert, the from a rocky plateau way down into a deep gorge, framed by quaint »friendly landlord of the “Hocksteinschänke” smiles at me and I cannot spruces, birch trees and heather. My two companions hold hands, dare resist temptation. I mean, I definitely deserve another dark beer today. to move one step further and are visually impressed. “My goodness, After a hearty meal, we sit on the terrace of the restaurant, relaxing in how romantic!”, sighs Christiane. “Wait for it, we will soon be going the evening sun. We have completed the second stage of the Malerweg downhill into a horrible gorge!” I am joking, shortly afterwards we are trail – for logistic reasons, we turned it into a round trip. Slowly, the just about to descend into the Schwedenlöcher. You need to use all your first banks of fog begin to rise from the fields in front of the Lilienstein, imagination to believe that once, the locals from the surrounding vil- The route and the silhouette of the giant table mountain seems to float above the lages sought shelter in the area away from the soldiers of the Swedish through the Elbe landscape like a stony ship in the sea of clouds. -

Views to a Thriving Local Culture, There Are Many Reasons a Trip to Bohemian Switzerland Should Be Added to Your Bucket List
Top 10 Reasons to visit Bohemian Switzerland Panorama - foto @maxime_north Bohemian Switzerland’s fairytale landscape is sure to enchant anyone who visits. Combined with Saxon Switzerland, the cross-border park is home to some of the most captivating natural and cultural wonders of the world. Founded in 2000 with the mission to preserve its unique rock formations and pristine forests and rivers, visitors will be treated to over 700 square kilometers of wilderness to discover and explore. With the wide range of transportation options available, the magic of the parks’ top sights is accessible for everyone. From breathtaking views to a thriving local culture, there are many reasons a trip to Bohemian Switzerland should be added to your bucket list. Pravčická Gate Marvel at the Pravčická Gate Considered to be the jewel of Bohemia Switzerland, the Pravčická Gate is a spectacular rock bridge that spans an impressive twenty-seven meters. This sixteen-meter high formation is the window to the romance and wonder that make this corner of the world so special. One of the world’s most majestic natural structures, a visit would be incomplete without seeing it. Be surrounded by unique flora and fauna Not only is the landscape of Bohemia Switzerland exceptional, but so are the animals and plants that call it home. Species that have long disappeared from other parts of the country flourish here, including some that even date back as far as the Ice Age. It’s not uncommon to catch a glimpse lynxes, otters, kingfishers, peregrine falcons, and salmon during your visit. In recent years, efforts have been made to reintroduce species that had been driven out of the region and restore the natural splendor of the area’s flora and fauna. -

Germany - Elbe Sandstone Mountains Hiking Tour 2021 Individual Self-Guided 8 Days/7 Nights
Germany - Elbe Sandstone Mountains Hiking Tour 2021 Individual Self-Guided 8 days/7 nights The Elbe Sandstone Mountains, located in the southeast of Germany, a few kilometers from Dresden are also known as Saxon Switzerland. This nickname was given by two Swiss painters who were impressed by the similarity of the area with their own country. With its chalky sandstone cliffs, deeply carved valleys, Table Mountains and gorges, this fascinating landscape is the only one of its kind in central Europe. During your walking tour you will see famous natural and cultural sights such as the Königstein Fortress”, the rocks “Barbarine” and “Pfaffenstein” and the well-known Rock Arch “Pravcická Brána” in Bohemian Switzerland, which is the largest natural stone bridge on the European continent. OK Cycle & Adventure Tours Inc. - 666 Kirkwood Ave - Suite B102 – Ottawa, Ontario Canada K1Z 5X9 www.okcycletours.com Toll Free 1-888-621-6818 Local 613-702-5350 Itinerary Day 1: Individual arrival in Bad Schandau Bad Schandau is a well-known health resort in the heart of the Saxon Switzerland. Day 2: Bad Schandau – fortress Hohnstein - Rathen 17 km 6 hrs Through the Saxon Switzerland National Park you walk uphill to the fortress Hohnstein. You will then arrive at Rathen with its natural theatre and its lake called “Amselsee”. Day 3: Rathen – Wehlen - Königstein 14 km 5 – 6 hours Please start early in the morning to benefit from the emptiness on the famous Bastei bridge. Here you can enjoy a wonderful view over the Elbe river valley and the Table Mountains of the Saxon Switzerland. -

Impact of Landscape Change on Landscape Functions in the Saxon Switzerland
Impact of Landscape Change on Landscape Functions in the Saxon Switzerland Ulrich Walz, Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden, Ger- many, Sebastian Wolf, Institute of Plant Sciences, ETH Zurich, Switzerland, Marco Neubert, Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden, Germany Keywords: landscape analysis, landscape fragmentation, soil erosion, landscape struc- ture, nature-oriented recreation value Abstract In this contribution the effects on environmental protection assets and landscape func- tions are examined on the basis of the analysis of the past landuse structure changes (see preceding contribution). Exemplary investigations into abiotic (e.g. soil erosion) and biotic (e.g. flora) landscape functions were made. The effects on the potential use of landscape for the human being (e.g. suitability for recreation) were modelled. Fur- thermore, the protection asset “unfragmented open space” was examined. For these purposes new methods and models were developed and existing GIS tools extended by self made adjustments. In the result, clear effects of the changed landuse structure on the examined landscape functions can be shown. 1 Motivation Changes to landscapes, especially changes in the way in which land is used, result in alterations to the landscape structure – and hence also to the abiotic and biotic func- tions and potentials of a landscape. Central Europe is a region dominated by anthro- pogenic development for housing, trade, industry and intensive agriculture. Especially within the last 60 years the human exploitation of natural resources such as soil, water and flora, fauna and space itself due to urban expansion was on a far greater scale than ever before (BASTIAN and SCHREIBER, 1999). -

Saxony – a Pearl of Germany's Musical Landscape When Music
Saxony – a pearl of Germany’s musical landscape When music lovers in Saxony talk about the region’s musical infrastructure, they proudly speak about the densest theatre and orchestra structure in Germany. When music aficionados from all over the world rave about performances at Semper Opera, Leipzig Opera, Chemnitz Opera or the concerts of Dresden’s “Kreuzchor“ choir, St Thomas’s Boys Choir or Leipzig’s Gewandhaus Orchestra, they have been following the traces of composers such as Richard Wagner, Robert Schumann, Carl Maria von Weber and Johann Sebastian Bach. Impressive music Saxony’s musical landscape is unparalleled in Germany. No other federal state has so many concert halls, stages and museums, is so full of outstanding architecture and sophisticated arts and culture events. Internationally respected theatre and music productions, topnotch festivals and historical and contemporary exhibitions characterise Saxony’s cultural landscape. They take place in opera houses, palaces, castles, parks and historical structures, in quarries, churches and on squares. Each year, there are over 40 nationally and internationally renowned music festivals featuring world-famous artists, such as Dresden Music Festival, Bach Festival Leipzig, Moritzburg Festival, “Sandstein & Musik“ Festival or Görlitz Jazz Days. Impressive scenery Saxony’s scenery, too, can be experienced in a musical way: Famous composers were inspired by the monumental rocks of Saxon Switzerland, for example, or the enchanting river landscape along the Elbe and left works of art that are based on how they experienced Saxony’s unique natural beauty. Carl-Maria von Weber and Richard Wagner composed famous operas in Saxony such as “Der Freischütz“, “Tannhäuser“ and “Lohengrin“. -

Wild and Beautiful Freyunger Straße 2 Stubbenkammer 2 a Im Forst 5 94481 Grafenau 18546 Sassnitz 18375 Born Tel
NATIONAL PARKS IN GERMANY Wild and beautiful Freyunger Straße 2 Stubbenkammer 2 a Im Forst 5 94481 Grafenau 18546 Sassnitz 18375 Born Tel. 08552 9600-0, Fax -100 Tel. 038392 350-11, Fax -54 Tel. 038234 502-0, Fax -24 [email protected] [email protected] [email protected] www.nationalpark-bayerischer-wald.de www.nationalpark-jasmund.de www.nationalpark-vorpommersche- boddenlandschaft.de Doktorberg 6 Laustraße 8 83471 Berchtesgaden 34537 Bad Wildungen Schlossgarten 1 Tel. 08652 9686-0, Fax -40 Tel. 05621 75249-0, Fax -19 25832 Tönning [email protected] info@nationalpark- Tel. 04861 616-0, Fax -69 www.nationalpark-berchtesgaden.de kellerwald-edersee.de [email protected] www.nationalpark-kellerwald- www.nationalpark-wattenmeer.de edersee.de Urftseestraße 34 Schloßplatz 3 Stadthausbrücke 8 53937 Schleiden-Gemünd 17237 Hohenzieritz 20355 Hamburg Tel. 02444 9510-0, Fax -85 Tel. 039824 252-0, Fax -50 Tel. 040 42840-3392, Fax -3552 [email protected] [email protected] www.nationalpark-wattenmeer.de www.nationalpark-eifel.de www.mueritz-nationalpark.de Bei der Marktkirche 9 An der Elbe 4 99947 Bad Langensalza 01814 Bad Schandau Virchowstraße 1 Tel. 03603 3907-0, Fax -20 Tel. 035022 900-600, Fax -666 26382 Wilhelmshaven [email protected] poststelle.sbs-nationalparkverwaltung@ Tel. 04421 911-0, Fax -280 www.nationalpark-hainich.de smul.sachsen.de poststelle@nlpv-wattenmeer. www.nationalpark-saechsische- niedersachsen.de schweiz.de www.nationalpark-wattenmeer.de www.nationalpark-wattenmeer- erleben.de Lindenallee 35 Park 2 38855 Wernigerode 16303 Schwedt / Oder, OT Criewen Tel. -

Elbe Sandstone Mountains/ Malerweg
6 days | appr ox. 60 km ELBE SANDSTONE MOUNTAINS/ MALERWEG View of the Elbe Sandstone Mountains WALKING TOUR MALERWEG TRAIL PART 2 Tours that are as individual as you! View from the Fortress Koenigstein 2. Day: Neumannmuehle – Großer 4. Day: Gohrisch – Koenigstein/Weißig Winterberg – Schmilka/Reinhardtsdorf (approx. 9/16 km, 4/5.5 hrs) Today’s (approx. 14/19 km, 6/7.5 hrs) You start short hiking route on Malerweg trail the day taking the bus to Neumann- takes you along Pfaffenstein and cave muehle. Then you hike through the rear Diebeskeller until you reach the Fortress of Saxon Switzerland uphill to of Koenigstein. ‘Zeughaus’. Shortly after, you can experi- ence the stunning Goldstein view. In 5. Day: Koenigstein/Weißig – Pirna Schmilka you cross the Elbe river by ferry (approx. 20/13 km, 7.5/5 hrs) Your fourth (extra costs) and walk upstairs to Schöna hiking tour on Malerweg trail firstly leads 1. Day: Individual arrival in Krippen to reach Reinhardtsdorf. you to Thuermsdorf, where you can visit Krippen, a district of Bad Schandau, its castle and chocolate manufacture. suggests itself being the perfect starting 3. Day: Schmilka/Reinhardtsdorf – Latter allows gourmets to taste various Gohrisch (approx. 17/12 km, 6.5/5 hrs) destination for short hiking tours along chocolate creations. Enjoy today’s view on the Schrammstein Malerweg trail on the left side of the massif located on the other side of the 6. Day: Individual departure Elbe river. There you can enjoy the Elbe River. Before you reach the afternoon going for a walk or relaxing in Gohrisch, you climb up the mesa Pap- the local Toscana thermal bath. -

MALERWEG TRAIL PART 1 Tours That Are As Individual As You! 1
6 days | approx. 55 km ELBE SANDSTONE MOUNTAINS/ MALERWEG View of the Saxon Switzerland countryside TRAIL WALKING TOUR MALERWEG TRAIL PART 1 Tours that are as individual as you! 1. Day: Individual arrival in Pirna view fairly undisturbed. You descend hain Waterfall. Your short hiking tour You travel individually to Pirna, which is down into ‘Amselgrund’ valley and head already ends at Neumannmühle. You known as the ‘gate to Saxon Switzer- for the second highlight of your hiking take the public bus to Bad Schandau land’. We recommend you to take a walk tour – the Hockstein rock. From there, train station and change into the subur- through the medieval alleys of Pirna. you have the perfect view onto today’s ban railway to Pirna. Here you can marvel at various artistical- end of the tour – the city of Hohnstein. ly decorated town houses. 4. Day: Hohnstein – Altendorf/ 2. Day: Pirna-Liebethal – Wehlen Kirnitzschtal (approx. 15 km/ 6 hrs) The (approx. 12 km/ 4 hrs) In the morning, phenomenal panoramic view at ‘Brand’ you take the bus to your first hiking tour viewpoint – also known as right on Malerweg trail. Today, you will balcony of Saxon Switzerland - is the hike through three wild and romantic highlight of today’s hike on Malerweg grounds. Your tour ends in Wehlen – a trail. After taking a break and enjoying peaceful town right by the Elbe River. the view, you continue your way down into Kirnitzschtal valley walking down View to the Schrammstein massif 3. Day: Wehlen – Hohnstein 800 steps. Passing Waitzdorf and Alten- (approx. -

Elbe Sandstone Mountains/ Malerweg
6 days | appr ox. 60 km ELBE SANDSTONE MOUNTAINS/ MALERWEG View of the Elbe Sandstone Mountains WALKING TOUR MALERWEG TRAIL PART 2 Tours that are as individual as you! View from the Fortress Königstein 2. Day: Neumannmühle – Großer 4. Day: Gohrisch – Königstein/Weißig Winterberg – Schmilka/Reinhardtsdorf (approx. 9/16 km, 4/5.5 hrs) Today’s (approx. 14/19 km, 6/7.5 hrs) You start short hiking route on Malerweg trail the day taking the bus to Neumann- takes you along Pfaffenstein and cave mühle. Then you hike through the rear of Diebeskeller until you reach the Fortress Saxon Switzerland uphill to ‘Zeughaus’. of Königstein. Shortly after, you can experience the stunning Goldstein view. In Schmilka you 5. Day: Königstein/Weißig – Pirna cross the Elbe river by ferry (extra costs) (approx. 20/13 km, 7.5/5 hrs) Your fourth and walk upstairs to Schöna to reach hiking tour on Malerweg trail firstly leads 1. Day: Individual arrival in Krippen Reinhardtsdorf. you to Thürmsdorf, where you can visit Krippen, a district of Bad Schandau, its castle and chocolate manufacture. suggests itself being the perfect starting 3. Day: Schmilka/Reinhardtsdorf – Latter allows gourmets to taste various Gohrisch (approx. 17/12 km, 6.5/5 hrs) destination for short hiking tours along chocolate creations. Enjoy today’s view on the Schrammstein Malerweg trail on the left side of the massif located on the other side of the 6. Day: Individual departure Elbe river. There you can enjoy the Elbe River. Before you reach the afternoon going for a walk or relaxing in Gohrisch, you climb up the mesa Pap- the local Toscana thermal bath.