Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

USA -V- Julian Assange Judgment
JUDICIARY OF ENGLAND AND WALES District Judge (Magistrates’ Court) Vanessa Baraitser In the Westminster Magistrates’ Court Between: THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA Requesting State -v- JULIAN PAUL ASSANGE Requested Person INDEX Page A. Introduction 2 a. The Request 2 b. Procedural History (US) 3 c. Procedural History (UK) 4 B. The Conduct 5 a. Second Superseding Indictment 5 b. Alleged Conduct 9 c. The Evidence 15 C. Issues Raised 15 D. The US-UK Treaty 16 E. Initial Stages of the Extradition Hearing 25 a. Section 78(2) 25 b. Section 78(4) 26 I. Section 78(4)(a) 26 II. Section 78(4)(b) 26 i. Section 137(3)(a): The Conduct 27 ii. Section 137(3)(b): Dual Criminality 27 1 The first strand (count 2) 33 The second strand (counts 3-14,1,18) and Article 10 34 The third strand (counts 15-17, 1) and Article 10 43 The right to truth/ Necessity 50 iii. Section 137(3)(c): maximum sentence requirement 53 F. Bars to Extradition 53 a. Section 81 (Extraneous Considerations) 53 I. Section 81(a) 55 II. Section 81(b) 69 b. Section 82 (Passage of Time) 71 G. Human Rights 76 a. Article 6 84 b. Article 7 82 c. Article 10 88 H. Health – Section 91 92 a. Prison Conditions 93 I. Pre-Trial 93 II. Post-Trial 98 b. Psychiatric Evidence 101 I. The defence medical evidence 101 II. The US medical evidence 105 III. Findings on the medical evidence 108 c. The Turner Criteria 111 I. -

Protestformen Im Cyberspace Möglichkeiten Und Grenzen Aus Zivilgesellschaftlicher Sicht
SOCIOLOGY IN SWITZERLAND Towards Cybersociety and Vireal Social Relations Protestformen im Cyberspace Möglichkeiten und Grenzen aus zivilgesellschaftlicher Sicht Hernani Marques [email protected] Zürich, September 2012 Bibliographische Zitation: Marques, Hernani: Protestformen im Cyberspace. Möglichkeiten und Grenzen aus zivilgesellschaftlicher Sicht. In: Sociology in Switzerland: Towards Cybersociety and Vireal Social Relations. Online Publications. Zürich 2012. http://socio.ch/intcom/t_hmarques.pdf Hernani Marques: Protestformen im Cyberspace http://socio.ch/intcom/t_hmarques.pdf Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .................................................................................................................................. 3 1.1 Gegenstand .................................................................................................................................................. 3 1.2 Fokus und Aufbau ......................................................................................................................................... 4 2 Theorie ...................................................................................................................................... 5 2.1 Gegenstand .................................................................................................................................................. 5 2.1.1 Meinungsäusserung ............................................................................................................................................... 5 -

1 TRANSCRIPT Executive Session on Wikileaks Sponsored by the Joan
1 TRANSCRIPT Executive Session on WikiLeaks Sponsored by the Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy Harvard Kennedy School Thursday, February 3, 2011, 9:00 AM – 2:00 PM Longfellow Room, Charles Hotel Pavilion Participants Graham Allison, Douglas Dillon Professor of Government, HKS; Director, Belfer Center for Science and International Affairs; former Assistant Secretary of Defense Matthew Baum, Marvin Kalb Professor of Global Communications and Professor of Public Policy, HKS Nicholas Burns, Sultan of Oman Professor of the Practice of International Relations, HKS; former U.S. Ambassador to Greece and former U.S. Ambassador to NATO Robert Calo, Shorenstein Fellow; Senior Lecturer, UC Berkeley Graduate School of Journalism James Carroll, columnist, Boston Globe; author of many books including An American Requiem Susan Crawford, Professor, Cardozo Law School; former Special Assistant to President Obama for Science, Technology and Innovation Policy Tom Fiedler, Dean, College of Communications, Boston University; former editor, Miami Herald Seth Flaxman, HKS student Megan Garber, Nieman Journalism Lab Alexis Gelber, Shorenstein Fellow; formerly, Newsweek magazine Edith Holway, Fellows and Programs Administrator, Shorenstein Center Alex Jones, Director, Shorenstein Center Eric Joyce, Project Minerva, Belfer Center Alex Keyssar, Matthew W. Stirling Jr. Professor of History and Social Policy, HKS Neil Lewis, Shorenstein Fellow; formerly, The New York Times Matt Mabe, HKS student Tim Maurer, HKS student Nicco Mele, Adjunct -

Hanscres Loaded 788 Tweets
hanscres loaded 788 tweets Hide Replies Hide Retweets Change User • How can the President of Ecuador have any sway at home when he can't even control the activities in one of his Emba… https://t.co/L7NIKo6cjP Nov 23, 2017 • RT @LouiseMensch: @handsome_hand_ @abh1984 @MarlaMHughes @DrDenaGrayson @dianeault5 @frogcycle @Alfree7619 @HillaryClinton @DeripaskaOleg @… Nov 22, 2017 • RT @KateHarding: After two women accused you of sexual assault, you went into hiding and set about destroying democracy. https://t.co/zdKOT… Nov 22, 2017 • We get asked all the time, why does Julian #assange of #wikileaks detest Hillary Clinton so much? One fateful after… https://t.co/vxVwWMTAZM Nov 22, 2017 • RT @supportJAdotcom: @JerriBarney @BarrettBrown_ @greekemmy judging by the fallout regarding recent revelations of #Assange and #Trump / #R… Nov 21, 2017 • The Ecuadorian Govt have invited Julian #assange to ride up on the Presidential Landrover at their next National Da… https://t.co/r9TQLcZahO Nov 21, 2017 • RT @JerriBarney: @supportJAdotcom @BarrettBrown_ @greekemmy That list becomes more of a joke everyday. She is feverishly trying to make it… Nov 21, 2017 • Puts a tear in your eye reading that doesn't it LOL. Emmy is just your average garden variety stalking nut-job Ste… https://t.co/olzRAP5j0J Nov 21, 2017 • They should have checked Google's T&C's instead of blinding following what their Messiah #assange of #wikileaks. T… https://t.co/CdqquKNq8N Nov 21, 2017 • After what has been leaked in the last few weeks about you Julian #assange, how on earth can you even mention the w… https://t.co/a9L2wqDaWR Nov 21, 2017 • RT @Brett_A_Taylor: I am CRYING. -

The Fifth Estate
THE FIFTH ESTATE ** * OVER BLACK: A WHISPER OF VOICES, barely audible at first. Confessional, personal, people sharing SECRETS. WE FADE IN: EXT. GUARDIAN - LONDON, ENGLAND - NEAR MIDNIGHT A looming modern structure, steel and glass, home of... July 2010 The Guardian - London, England The whisper builds, pushing us into -- INT. GUARDIAN, BULLPEN - LONDON, ENGLAND - NEAR MIDNIGHT A low buzz, a hustle of activity, journalists swirling. REPORTER NICK DAVIES, 50s, handsome, hustles along with RUMPLED EDITOR ALAN RUSBRIDGER, 50s. Alan's on a blackberry. NICK DAVIES If we hold the shooting in Kabul we can keep it all to 14 pages. They pass ONE SHEETS tacked to the wall, we note the FRONT PAGE -- MASSIVE LEAK OF SECRET FILES EXPOSES TRUE AFGHAN WAR. ALAN RUSBRIDGER (off his blackberry) The Times wants to go. Alan glances over at Nick. Nick frowns. NICK DAVIES Let me talk to Rosenbach. INT. ANKE'S APARTMENT - BERLIN, GERMANY - NIGHT (SAME TIME) A quiet room. CLOSE ON a laptop screen, The Guardian website, no mention of the Afghan War Logs. The cursor moves, hits the REFRESH BUTTON. The screen refreshes. Nothing's changed. The cursor HITS the button again. The screen refreshes, again it's the same. As the cursor hits the button AGAIN -- EXT. POTSDAMER PLATZ - BERLIN, GERMANY - NIGHT (SAME TIME) A SMALL BUILDING overshadowed by an array of GRAND MODERNITY. Der Spiegel - Berlin, Germany A rumble of German voices take us into -- INT. DER SPIEGEL, STARK'S OFFICE - BERLIN - NIGHT (SAME TIME) A small office, ICONIC SPIEGEL COVERS on the walls. A BUTTONED UP EDITOR, STARK, 40s, stands over a PROGRAMMER working on the front page of SPIEGEL ONLINE. -

Militia Groups and National Security in Kenya: a Case Study of Eastland’S, Nairobi
UNIVERSITY OF NAIROBI INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES Militia Groups and National Security in Kenya: A Case Study of Eastland’s, Nairobi SAMUEL. M. WACHENJE SUPERVISOR: DR MARTIN. O. OUMA A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE AWARD OF MASTERS OF ARTS DEGREE IN INTERNATIONAL STUDIES AT THE INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES (IDIS), UNIVERSITY OF NAIROBI March, 2015 Declaration I hereby declare that this research project is my original work and has not been submitted for a degree award in any other university. Samuel. M. Wachenje Signed…………………………… Date…………............................... This project has been submitted for examination with my approval as University Supervisor Dr Martin. O. Ouma Signed..............…………………… Date…...........…………….. i Dedication I dedicate this work to all those who gallantly put their lives on the line as they strive to protect/save lives, alleviate human suffering and promote peace in an environment rife with conflict and violence as well as to those who have longed for security, stability and peace which has often proven elusive. May their yearnings materialize and live to cherish good tidings in secure, stable and peaceful environment. ii Acknowledgement The writing of this dissertation has been very challenging and without the support, patience and guidance of the following people, this study could not have been completed. To them I owe my deepest gratitude. To my supervisor Dr. Martin Ouma who found time to guide me despite many other academic and professional commitments. His wisdom, knowledge, commitment to the highest standards inspired and motivated me. Also, great appreciation goes to my colleagues at NDC and my family who in various ways inspired and encourage me throughout the process. -
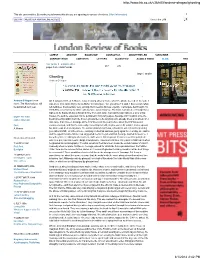
Andrew O'hagan · Ghosting: Julian Assange
http://www.lrb.co.uk/v36/n05/andrew-ohagan/ghosting This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. (More Information) × LOG IN REGISTER FOR ONLINE ACCESS Search the LRB LATEST ARCHIVE BOOKSHOP CONTACT US ABOUT THE LRB SUBSCRIBE CURRENT ISSUE CONTENTS LETTERS CLASSIFIED AUDIO & VIDEO BLOG RSS Vol. 36 No. 5 · 6 March 2014 facebook617 twitter 276 pages 5-26 | 26467 words larger | smaller Ghosting Andrew O’Hagan Andrew O’Hagan’s new On 5 January 2011, at 8.30 p.m., I was messing about at home when the phone buzzed on the sofa. It novel, The Illuminations, will was a text from Jamie Byng, the publisher of Canongate. ‘Are you about?’ it said. ‘I have a somewhat be published next year. left-field idea. It’s potentially very exciting. But I need to discuss urgently.’ Canongate had bought, for £600,000, a memoir by the WikiLeaks founder, Julian Assange. The book had also been bought for a high sum by Sonny Mehta at Knopf in New York and Jamie had sold foreign rights to a slew of big MORE BY THIS houses. He said he expected it to be published in forty languages. Assange didn’t want to write the CONTRIBUTOR book himself but didn’t want the book’s ghostwriter to be anybody who already knew a lot about him. I told Jamie that I’d seen Assange at the Frontline Club the year before, when the first WikiLeaks Guilt stories emerged, and that he was really interesting but odd, maybe even a bit autistic. -
Protestformen Im Cyberspace Möglichkeiten Und Grenzen Aus Zivilgesellschaftlicher Sicht
Das Internet als Faktor des sozialen und kulturellen Wandels - Seminararbeit bei Prof. Dr. Hans Geser; FS 2012, Soziologisches Institut, Universität Zürich Protestformen im Cyberspace Möglichkeiten und Grenzen aus zivilgesellschaftlicher Sicht Hernani Marques Abgabedatum: 30.6.2012 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 1.1 Gegenstand . 4 1.2 Fokus und Aufbau . 5 2 Theorie 7 2.1 Gegenstand . 7 2.1.1 Meinungsäusserung . 8 2.1.2 Petition . 8 2.1.3 Graffiti . 9 2.1.4 Demonstration . 10 2.1.5 Streik / Boykott . 11 2.1.6 Sitzblockade . 12 2.1.7 Selbstermächtigung . 13 2.1.8 “Terrorismus” . 15 2.2 Die verschiedenen Protestkulturen und deren -struktur . 16 3 Empirie 18 3.1 Gegenstand . 18 3.2 Fall WANK: Eine virulente politische Äusserung . 18 3.3 Fall Opendata.ch: Die Initiative zu einer maschinenlesbaren Regie- rung . 21 3.4 Fall Avaaz.org: Der Protest mit digitalen Petitionen . 22 3.5 Fall CCC / AK Vorrat: Der gesetzliche Kampf um informationelle Selbstbestimmung . 24 3.6 Fall Torservers.net: Die technologische Selbstermächtigung zur infor- mationellen Selbstbestimmung . 26 3.7 Fall WikiLeaks: Informationsfreiheit durch Selbstermächtigung . 28 3.8 Fall Anonymous / LulzSec: Informationsfreiheit durch Selbstermäch- tigung, digitalen Sitzblockaden und Defacements . 31 3.9 Fall Estland: Die bedeutende Störung der ICT-Infrastruktur eines Landes durch digitale Sitzblockladen und Defacements? . 37 1 4 Diskussion 38 4.1 Gegenstand . 38 4.2 Die Frage der Selbstermächtigung: Legitimität vs. Legalität . 38 4.3 Die Anonymitätsfrage: Mangelnde Anerkennung vs. Gefahr der Re- pression . 39 4.4 Die Organisationsfrage: Mangelnde Fassbarkeit vs. mangelnde Inklu- sion . 40 4.5 Die Frage der Wirksamkeit: Kurzfristiger vs. -

“Transparency” from Pentagon Papers to Wikileaks: a Linguistic Revolution Università Degli Studi Di Verona
“Transparency” from Pentagon Papers to Wikileaks: A Linguistic Revolution Università degli Studi di Verona Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo Curriculum: Giornalismo e Relazioni Pubbliche Tesi di laurea “Transparency” from Pentagon Papers to Wikileaks: a linguistic revolution Relatore: Prof. Roberta Facchinetti Laureando: Jessica Mariani vr358475 Anno accademico 2012/2013 2 3 Introduction In 2006 an Australian hacker activist known as Julian Assange threw down a challenge to the world of politics and diplomacy and leaked 400,000 secret files on his website “Wikileaks.org”. One of the first contributors to Wikileaks was a twenty-four year old American soldier, Bradley Manning, who has leaked secret information about the Iraqi War and has been accused of leaking the “Collateral Murder” video and State Department cables. Consequently, WikiLeaks has turned into the most challenging journalistic phenomenon to have emerged in the digital era, which has collaborated with five most important newspapers in the world: The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde and El Paìs. It has provoked anger and enthusiasm in equal measure, from across the political and journalistic spectrum. WikiLeaks has posed a series of questions to the status quo in politics, journalism and to the ways we understand political communication. Above all, it actively launched a new campaign to support transparency as a leading principle to fight against corruption and the world of secrecy. Thirty-five years backwards, in 1971, a similar event threatened U.S Government's stability; Daniel Ellsberg, a former strategic analyst at the RAND Corporation, who worked on the top secret McNamara study of U.S. -

Supportjadotcom Loaded 3193 Tweets
supportJAdotcom loaded 3193 tweets Hide Replies Hide Retweets Change User • RT @PRESlDENTBANNON: Day 306 Walls: 0 Golf trips: 74 Biggest problem: LaVar Head of Charts: Hannity Laundry operations: Panama Advisors: g… Nov 23, 2017 • RT @KateHarding: After two women accused you of sexual assault, you went into hiding and set about destroying democracy. https://t.co/zdKOT… Nov 23, 2017 • RT @QuestionWiki: He’s a Member of Congress. The Kremlin Likes Him So Much It Gave Him a Code Name | #QuestionWikileaks https://t.co/36Ttr… Nov 23, 2017 • RT @subverzo: Julian Assange should recuse himself. His extensive contacts colluding with Donny Junior & the Trump Campaign has caused him… Nov 23, 2017 • RT @EdKrassen: The only one in the Winter White House not under investigation by Robert Mueller today, is the Turkey. Happy Thanksgiving #N… Nov 23, 2017 • RT @NakamaruSatoshi: Remember #Assange is still a rape suspect. His victims never sought out lawyers and PR spokespersons. Julian has been… Nov 23, 2017 • RT @perlmutations: Yer fuckin kiddin me, right? https://t.co/u2ZPOmOTM2 Nov 23, 2017 • RT @th3j35t3r: https://t.co/lpbZFFbmoR is only 3 folks away from tipping over 6K users since the soft-launch 5 day ago. Context: After a… Nov 23, 2017 • RT @HansCres: How can the President of Ecuador have any sway at home when he can't even control the activities in one of his Embassies. #as… Nov 23, 2017 • RT @QuestionWiki: Ecuador warns WikiLeaks founder Julian Assange over support for Catalonian independence | #QuestionWikileaks https://t.c… Nov 23, 2017 • RT @TheOralBuffet: @BluZar @ToniSmithRosari @Flygirlfly625 @christinawilkie https://t.co/yzELb58XlG Nov 23, 2017 • RT @will_c_fischer: .@realDonaldTrump, know what’s a bigger deal that shoplifting? Conspiracy against the US. -

Criminal Prohibitions on Leaks and Other Disclosures of Classified Defense Information
Criminal Prohibitions on Leaks and Other Disclosures of Classified Defense Information Stephen P. Mulligan Legislative Attorney Jennifer K. Elsea Legislative Attorney March 7, 2017 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R41404 Criminal Prohibitions on Leaks and Other Disclosures of Classified Defense Information Summary Recent unauthorized disclosures of information concerning activities in the White House, and the publication of large quantities of classified information by WikiLeaks and other organizations and news outlets, have prompted congressional interest in criminal prohibitions on disclosure of classified information. While some have described recent leaks of classified information as “illegal” and “criminal,” there is no single statute that criminalizes any unauthorized disclosure of classified information. Instead, the legal framework is based on a complex and often overlapping set of statutes with provisions that differ depending on, among other factors, what information was disclosed, to whom it was given, and the intentions of the discloser. This report identifies statutory prohibitions that may be implicated by the unauthorized release of classified information, and it examines the elements necessary to secure a conviction under the Espionage Act and applicable statutes. Historically, the Espionage Act and other relevant statutes have been used almost exclusively to prosecute (1) individuals with access to classified information (and a corresponding obligation to protect it) who make it available to foreign agents, and (2) foreign agents who obtain classified information unlawfully while present in the United States. While prosecutions appear to be on the rise, disclosures of classified information to the press have been punished as crimes less frequently, and the government has never prosecuted a traditional news organization for publishing classified information that it received as a result of a leak. -

Terrorizing Wikileaks: Why the Embargo Against Wikileaks Will Fail
TERRORIZING WIKILEAKS: WHY THE EMBARGO AGAINST WIKILEAKS WILL FAIL SAMUEL C. CANNON* INTRODUCTION ..................................................................................... 306 I. ATTACKS ON TERRORIST WEBSITES .......................................... 307 A. Palestinian Islamic Jihad (PIJ) .......................................... 308 B. Al Qaeda ............................................................................. 309 II. WIKILEAKS ................................................................................ 311 A. WikiLeaks’ Publications ..................................................... 311 B. Backlash Against WikiLeaks ............................................... 314 III. THE IMPENDING FAILURE OF THE CAMPAIGN AGAINST WIKILEAKS ................................................................................ 316 A. Criminalization of WikiLeaks will Fail ............................... 316 1. Espionage Act ............................................................... 317 2. Problems with Espionage Act Prosecution ................... 318 3. Conspiracy to Violate Computer Fraud and Abuse Act 319 4. Lack of a “Material Support” Prohibition ..................... 320 B. Lack of Support from Private Actors .................................. 321 CONCLUSION ......................................................................................... 323 [W]hat steps were taken to stop Wikileaks director Julian Assange from distributing this highly sensitive classified material especially after he had already published