Louise Farrenc (1804-1875)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The String Quartets of George Onslow First Edition
The String Quartets of George Onslow First Edition All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Published in the United States by Edition Silvertrust a division of Silvertrust and Company Edition Silvertrust 601 Timber Trail Riverwoods, Illinois 60015 USA Website: www.editionsilvertrust.com For Loren, Skyler and Joyce—Onslow Fans All © 2005 R.H.R. Silvertrust 1 Table of Contents Introduction & Acknowledgements ...................................................................................................................3 The Early Years 1784-1805 ...............................................................................................................................5 String Quartet Nos.1-3 .......................................................................................................................................6 The Years between 1806-1813 ..........................................................................................................................10 String Quartet Nos.4-6 .......................................................................................................................................12 String Quartet Nos. 7-9 ......................................................................................................................................15 String Quartet Nos.10-12 ...................................................................................................................................19 The Years from 1813-1822 ...............................................................................................................................22 -

Introduction
INTRODUCTION The present volume contains Carl Philipp Emanuel revision of the body of work that had accrued up to that Bach’s first two published sets of keyboard sonatas: the time.2 For the publication of his two keyboard cycles, Bach six “Prussian” (Wq 48) and six “Württemberg” (Wq 49) chose engravers and printers from Nuremberg: Balthasar Sonatas. The exact date of publication for each collection Schmid for Wq 48, and Johann Wilhelm Windter/Johann is not entirely clear. NV 1790 gives 1743 for the first set Ulrich Haffner for Wq 49. The connection with Nurem- and 1745 for the second, while the Autobiography gives 1742 berg, for which Bach’s father likely served as the catalyst, and 1744, respectively. Advertisements in the Nuremberg lasted well into the 1760s.3 newspaper Friedens- und Kriegs-Currier might have pro- The source situation of the “Prussian” and “Württem- vided some clarification, but no mention has been found berg” Sonatas may be described as quite favorable: both of the Wq 48 print in any of the 1742 issues, and no issues exist in authorized prints. After their publication Bach from 1743 or 1744 appear to be extant. An advertisement most likely destroyed or gave away the original autographs, for the Wq 49 set does show up in 1745, but this is proba- as he would do with later prints. Some autograph sketch bly not for the first printing. A composition date for each material exists for Wq 49/3 (see appendix), and some em- of the twelve sonatas is given in NV 1790; for Wq 48 the bellishments and varied reprises exist for Wq 49/6 (see dates range from 1740 to 1742, and for Wq 49 from 1742 source A), but no other source has survived that can be to 1744. -

The Pedagogical Legacy of Johann Nepomuk Hummel
ABSTRACT Title of Document: THE PEDAGOGICAL LEGACY OF JOHANN NEPOMUK HUMMEL. Jarl Olaf Hulbert, Doctor of Philosophy, 2006 Directed By: Professor Shelley G. Davis School of Music, Division of Musicology & Ethnomusicology Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), a student of Mozart and Haydn, and colleague of Beethoven, made a spectacular ascent from child-prodigy to pianist- superstar. A composer with considerable output, he garnered enormous recognition as piano virtuoso and teacher. Acclaimed for his dazzling, beautifully clean, and elegant legato playing, his superb pedagogical skills made him a much sought after and highly paid teacher. This dissertation examines Hummel’s eminent role as piano pedagogue reassessing his legacy. Furthering previous research (e.g. Karl Benyovszky, Marion Barnum, Joel Sachs) with newly consulted archival material, this study focuses on the impact of Hummel on his students. Part One deals with Hummel’s biography and his seminal piano treatise, Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano- Forte-Spiel, vom ersten Elementar-Unterrichte an, bis zur vollkommensten Ausbildung, 1828 (published in German, English, French, and Italian). Part Two discusses Hummel, the pedagogue; the impact on his star-students, notably Adolph Henselt, Ferdinand Hiller, and Sigismond Thalberg; his influence on musicians such as Chopin and Mendelssohn; and the spreading of his method throughout Europe and the US. Part Three deals with the precipitous decline of Hummel’s reputation, particularly after severe attacks by Robert Schumann. His recent resurgence as a musician of note is exemplified in a case study of the changes in the appreciation of the Septet in D Minor, one of Hummel’s most celebrated compositions. -

Louise F Arrenc
LOUISE FARRENC Ganzleinen/Clothbound 154,– Kartoniert/Paperback je/each 54,– RITISCHE DITION RITICAL DITION K E · C E Band/Volume 6: Konzertante Variationen für Violine und Klavier op. 20 Concertante variations for violin and piano op. 20 Louise Farrenc Partitur und Stimmen/Score and Parts · ISMN M-2019-7404-0 Teil/Part I: Orchesterwerke · Orchestral Music Ganzleinen/Clothbound 154,– Kartoniert/Paperback 108,– 1804–1875 Band/Volume 1: Symphonie · Symphony op. 32 Partitur/Score · ISMN M-2019-7401-9 · 154,– Band/Volume 7: Violoncellosonate · Sonata for cello and piano op. 46 Partitur und Stimmen/Score and Parts · ISMN M-2019-7415-6 Band/Volume 2: Symphonie · Symphony op. 35 Ganzleinen/Clothbound 68,– Kritische Ausgabe Critical Edition Partitur/Score · ISMN M-2019-7402-6 · 154,– Kartoniert/Paperback 48,– Band/Volume 3: Symphonie · Symphony op. 36 Orchester- und Kammermusik Orchestral, Chamber Music Partitur/Score · ISMN M-2019-7403-3 · 154,– Teil/Part III: Ausgewählte Klavierwerke · Selected Pianoworks sowie ausgewählte Klavierwerke and selected Pianoworks Band/Volume 4: Ouvertüren · Ouvertures op. 23 & op. 24 Partitur/Score · ISMN M-2019-7427-9 · 154,– Band/Volume 1: Etüden · Etudes op. 26 & 50 ISMN M-2019-7470-5 Ganzleinen/Clothbound 128,– Teil/Part II: Kammermusik · Chambermusic Kartoniert/Paperback 88,– Band/Volume 1: Nonett · Nonet op. 38 Band/Volume 2: Rondeau op. 9; Variationen (Onslow) op. 10; Partitur und Stimmen/Score and Parts · ISMN M-2019-7414-9 Variationen (Donizetti) op. 15; Air russe varié op. 17; Nocturne op. 49; Ganzleinen/Clothbound 180,– Valse brillante op. 51; Mélodie o. O. Kartoniert/Paperback 128,– Selected Pieces for Piano Band/Volume 2: Sextett · Sextet op. -

574094 Itunes Farrenc
Louise FARRENC (1804–1875) Symphony No. 1 Overtures Grand Variations on a Theme by Count Gallenberg Jean Muller, Piano Solistes Européens, Luxembourg Christoph König Louise Farrenc (1804–1875) rhythmic ‘stutter’ at the very beginning already brings the dedicatee of the ‘Moonlight’ Sonata of 1802. As is so Symphony No. 1 • Overtures, Opp. 23 & 24 • Grand Variations on a Theme by Count Gallenberg hints of dark and momentous tragedy; its sudden often the case with sets of variations, there is nothing movement away from E flat to D major in the central particularly remarkable about Gallenberg’s original theme, Louise Farrenc (originally named Jeanne-Louise Dumont) Farrenc wrote her Symphony No. 1 in 1841, and two development section is as unexpected as it is effective. but it is what Farrenc does with it that is interesting. was born in Paris on 31 May 1804 into a highly artistic further symphonies in 1845 and 1847, and they can all be No less a figure than Berlioz was one of those who took Indeed, she wrote a large number of sets of variations, family. Both her father, Jacques-Edme Dumont, and her considered significant contributions to the symphonic note of her talent as an orchestrator in this work. including works on themes by Rossini, Bellini, Weber, brother, Auguste Dumont, were highly successful literature of this period. In fact, the third was a huge The Grand Variations on a Theme by Count Donizetti and Onslow. She used the form as a vehicle for sculptors, as their predecessors had also been. She success, its first performance at the Conservatoire in Gallenberg , written immediately after the Overture in E flat all the elegance and technical display of which she was became renowned throughout France and beyond as a 1849 being talked about for years afterwards. -

Louise Farrenc's Trio for Flute, Cello and Piano: a Critical Edition and Analysis Andreas P
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2005 Louise Farrenc's Trio for Flute, Cello and Piano: A Critical Edition and Analysis Andreas P. Tischhauser Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC LOUISE FARRENC’S TRIO FOR FLUTE, CELLO AND PIANO: A CRITICAL EDITION AND ANALYSIS By ANDREAS P. TISCHHAUSER A Treatise submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music Degree Awarded: Fall Semester, 2005 Copyright © 2005 Andreas P. Tischhauser All Rights Reserved The members of the Committee approve the treatise of Andreas Tischhauser defended on 31 October 2005. Jeff Keesecker Professor Directing Treatise André Thomas Outside Committee Member Patrick Meighan Committee Member Evan Jones Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to offer special thanks to the following individuals who have made this project possible: Sylvia Glickman, President of Hildegard Publishing Company, whose idea of republication led to this project; Charles DeLaney for his patience, inspiration, and expert instruction; my wife Katherine for her support and expertise in analysis and string chamber music; and finally my dissertation chair, Jeff Keesecker for his time meticulously overseeing the composition of this document and all his hard work on the committee and the mundane administrative work I could not perform from my remote location in Colorado. iii TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES ..............................................................................................v ABSTRACT .........................................................................................................vii I. -

77Th Season Of
77TH SEASON OF CONCERTSnational gallery of art | september 16, 2018 PROGRAM Living Art Collective Ensemble ( LACE ) With Elisa Monte Dance Carla Dirlikov Canales, mezzo-soprano Michele Cober, soprano Danielle DeSwert Hahn, piano Rosalind Leavell, cello Jacqueline Saed Wolborsky, violin Tiffany Rea-Fisher, choreography Ashley LaRosa, JoVonna Parks, Daniela Funicello, and Thomas Varvaro, dancers InterLACEd: Music in Corot’s World Presented in celebration of Corot: Women September 16, 2018 | 3:30 West Building, West Garden Court Maria Malibran (1808 – 1836) Rataplan Christoph Willibald Gluck (1714 – 1787) Arr. Hector Berlioz (1803 – 1869) “J’ai perdu mon Eurydice,” from Orphée et Eurydice Gluck Arr. Fritz Kreisler (1875 – 1962) Mélodie Louise Farrenc (1804 – 1875) Piano Trio no. 1, op. 33 Allegro Adagio sostenuto Minuetto; Allegro Finale; Vivace 2 Frédéric Chopin (1810 – 1849) Arr. Pauline Viardot (1821 – 1910) From Douze Mazurkas “Seize ans” (Mazurka no. 31, op. 50, no. 2) “L’oiselet” (Mazurka no. 47, op. 68, no. 2) “La fête” (Mazurka no. 4, op. 6, no. 4) Intermission Clara Schumann (1819 – 1896) Three Romances for Violin and Piano, op. 22 Andante molto Allegretto Leidenschaftlich schnell Viardot “Havanaise” Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) Piano Trio no. 1 in F Major, op. 18 Allegro vivace Andante Scherzo: Presto Allegro 3 THE MUSICIANS The Living Art Collective Ensemble ( LACE ) is a versatile group of musicians, com- mitted to contextualizing the human journey through vivid and engaging performances of classical music. Curated by Jacqueline Saed Wolborsky and Danielle DeSwert Hahn, each performance incorporates multiple facets of the arts and culture, including poetry, politics, fashion, and food, and tells the stories of individuals who broke through gender, social, and cultural barriers that continue to challenge us today. -

Program Notes Ronen Chamber Ensemble “Her Voice” October 2, 2007
Program Notes Ronen Chamber Ensemble “Her Voice” October 2, 2007 Rapid Fire Jennifer Hidgon Jennifer Higdon is a prominent and frequently performed composer. The Washington Post hailed her as "Savvy, sensitive, with a keen ear and innate sense of form and generous dash of pure esprit." Her orchestral work "The Blue Cathedral" was performed by 100 orchestras, among them the Indianapolis Symphony. Many of her compositions are available on recordings. She teaches composition at the Curtis institute in Philadelphia. "Rapid Fire" was written to portray inner city violence and its innocent victims. It is an expression of pain, disbelief, fear and terror. Commissioned by flutist Peter Brown, it is dedicated to his memory. “Rapid Fire” will be performed by flutist Cheryl Riggle. Cheryl Riggle is finishing her Bachelors Degree at the University of Indianapolis. She has been a member of the Indianapolis Philharmonic Orchestra for the past 11 years and appeared as soloist with the Phoenix Symphony. Her compositions were performed on WICR and at the Region V 2005 Society Composers Conference at Butler University. Duetto for Clarinet, String Bass and Piano Giovanni Bottesini Nicknamed "Paganini of the double bass," Bottesini initially studied violin and composition. He came to the bass by chance as it allowed him to receive a scholarship to study at the Milan Conservatory. Bottesini played Bass in several Italian orchestras. He composed operas and was a traveling virtuoso of the double bass. To create a repertoire for his own performances, he wrote numerous compositions for the bass. Bottesini was also a respected conductor and was asked by Verdi to conduct the premiere of Aida in Egypt. -
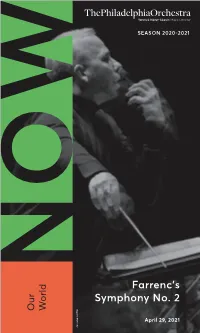
Farrenc's Symphony No. 2 Digital Program
SEASON 2020-2021 Farrenc’s Symphony No. 2 April 29, 2021 Jessica GriffinJessica SEASON 2020-2021 The Philadelphia Orchestra Thursday, April 29, at 8:00 On the Digital Stage Yannick Nézet-Séguin Conductor Paul Jacobs Organ Foumai Concerto grosso, for chamber orchestra First Philadelphia Orchestra performance Poulenc Concerto in G minor for Organ, Strings, and Timpani Andante—Allegro giocoso—Subito andante moderato— Tempo allegro—Molto adagio—Très calme—Lent— Tempo de l’allegro initial—Tempo introduction—Largo Farrenc Symphony No. 2 in D major, Op. 35 I. Andante—Allegro II. Andante III. Scherzo: Vivace IV. Andante—Allegro This program runs approximately 1 hour, 10 minutes, and will be performed without an intermission. This concert is part of the Fred J. Cooper Memorial Organ Experience, supported through a generous grant from the Wyncote Foundation. Philadelphia Orchestra concerts are broadcast on WRTI 90.1 FM on Sunday afternoons at 1 PM, and are repeated on Monday evenings at 7 PM on WRTI HD 2. Visit www.wrti.org to listen live or for more details. Our World Lead support for the Digital Stage is provided by: Claudia and Richard Balderston Elaine W. Camarda and A. Morris Williams, Jr. The CHG Charitable Trust Innisfree Foundation Gretchen and M. Roy Jackson Neal W. Krouse John H. McFadden and Lisa D. Kabnick The Andrew W. Mellon Foundation Leslie A. Miller and Richard B. Worley Ralph W. Muller and Beth B. Johnston Neubauer Family Foundation William Penn Foundation Peter and Mari Shaw Dr. and Mrs. Joseph B. Townsend Waterman Trust Constance and Sankey Williams Wyncote Foundation SEASON 2020-2021 The Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Music Director Walter and Leonore Annenberg Chair Nathalie Stutzmann Principal Guest Conductor Designate Gabriela Lena Frank Composer-in-Residence Erina Yashima Assistant Conductor Lina Gonzalez-Granados Conducting Fellow Frederick R. -
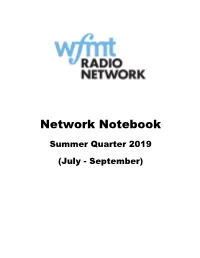
Network Notebook
Network Notebook Summer Quarter 2019 (July - September) A World of Services for Our Affiliates We make great radio as affordable as possible: • Our production costs are primarily covered by our arts partners and outside funding, not from our affiliates, marketing or sales. • Affiliation fees only apply when a station takes three or more programs. The actual affiliation fee is based on a station’s market share. Affiliates are not charged fees for the selection of WFMT Radio Network programs on the Public Radio Exchange (PRX). • The cost of our Beethoven and Jazz Network overnight services is based on a sliding scale, depending on the number of hours you use (the more hours you use, the lower the hourly rate). We also offer reduced Beethoven and Jazz Network rates for HD broadcast. Through PRX, you can schedule any hour of the Beethoven or Jazz Network throughout the day and the files are delivered a week in advance for maximum flexibility. We provide highly skilled technical support: • Programs are available through the Public Radio Exchange (PRX). PRX delivers files to you days in advance so you can schedule them for broadcast at your convenience. We provide technical support in conjunction with PRX to answer all your distribution questions. In cases of emergency or for use as an alternate distribution platform, we also offer an FTP (File Transfer Protocol), which is kept up to date with all of our series and specials. We keep you informed about our shows and help you promote them to your listeners: • Affiliates receive our quarterly Network Notebook with all our program offerings, and our regular online WFMT Radio Network Newsletter, with news updates, previews of upcoming shows and more. -

Louise Farrenc: 1804-1875 Ryan Jacobsen Research Lecture March
! Louise Farrenc: 1804-1875 Ryan Jacobsen Research Lecture March 23, 2020 This thesis entitled: Louise Farrenc: 1804-1875 written by Ryan Jacobsen has been approved for the masters ● doctoral degree program in: Violin Performance Charles Wetherbee Committee Chair Name Carlo Caballero Committee Member Name The final copy of this thesis has been examined by the signatories, and we find that both the content and the form meet acceptable presentation standards of scholarly work in the above mentioned discipline. tdent nmer 105767649 protocol # protocol ! Introduction and Biographical Context Louise Farrenc (1804-1875) was an influential nineteenth-century French pianist, composer, and pedagogue. Though famous in her day, her compositional and scholarly contributions to the music world have since fallen into obscurity. With the increased interest in the subject of women composers in the last fifty years, musicologists have begun to rediscover, publish, and perform the works of women composers. This holds true for Farrenc; however, the slight notoriety she claims in the twenty-first century pales in comparison to her nineteenth- century popularity. The existing published research on Farrenc’s life and music remains woefully insufficient. After an overview of Farrenc’s life and accomplishments, it is necessary to put her chamber music, specifically her third piano quintet, into historical context. This will include a discussion of the development of the piano quintet and the state of chamber music in France during the first part of the nineteenth century, as well as a note about how perceptions of early nineteenth-century French chamber music have suffered in the last century. Next, it is important to discuss her quintet, incorporating both a brief historical background and an analysis of the first movement. -

Louise Farrenc Is Notable for Her Versatility, on the One Hand, and Also for a High Degree of Independence
Farrenc, Louise are able to tread, then we admire all the more the strict studies, objective principles and choice sagacity that ha- ve been able to lead her there." (Thérèse Wartel in: Revue et Gazette musicale de Paris, 31.3.1850, p. 108 (Reviews of the world premiere of the Nonet, Op. 38) (author's translation). Profile Louise Farrenc is notable for her versatility, on the one hand, and also for a high degree of independence. In al- most all of her various areas of activity, especially as a composer and researcher, she followed paths that were independent from the general current of Parisian musi- cal life in the context of which she worked. Cities an countries Louise Farrenc lived and worked in Paris, France. In 1832, she embarked on a concert tour to England; se- veral of her works were also published in England and Germany. Beyond these, no activities outside of Paris are known. Louise Farrenc. Portrait von Luigi Rubio (1835) Biography Louise Farrenc Jeanne-Louise Dumont was born on 31 May 1804 in Pa- Birth name: Jeanne-Louise Dumont ris. She received her first instruction in piano and solfège beginning in 1810; from 1819 she took lessons in harm- * 31 May 1804 in Paris, Frankreich ony from Anton Reicha, most likely privately. In 1821 she † 15 September 1875 in Paris, Frankreich married the flutist and music publisher Aristide Farrenc; after an interruption, Louise Farrenc resumed her stu- Composer, pianist, piano teacher, piano professor, dies with Reicha and extended her subjects to include researcher. harmony, counterpoint and fugue as well as orchestrati- on.