First Status Seminar `Druckflamm`. Development of a Coal-Fuelled
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Interim Report January–September 2020
Interim report January–September 2020 Business highlights, July–September 2020 Financial highlights, January–September 2020 • Unusually high hydrological balance puts pressure on Nordic • Net sales decreased by 4% (-5% excluding currency effects) electricity prices to SEK 114,815 million (120,181) • Inauguration of Princess Ariane wind farm in the Netherlands • Underlying operating profit1 of SEK 17,802 million (16,889) • Participation in auction for closure of Moorburg power plant in • Operating profit1 of SEK 10,030 million (19,715) Hamburg • Profit for the period of SEK 1,989 million (14,373) • Tendering process for the electricity grid in Berlin rejected by Financial highlights, July–September 2020 the Higher Regional Court. After the end of the quarter, • Net sales decreased by 2% (0% excluding currency effects) Vattenfall offered to sell the company Stromnetz Berlin to the to SEK 35,375 million (35,938) State of Berlin • Underlying operating profit1 of SEK 4,818 million (3,594) • Inauguration of pilot plant for HYBRIT, a partnership project • Operating profit1 of SEK 4,743 million (8,677) for fossil-free steel production • Profit for the period of SEK 3,583 million (6,700) • Anna Borg named as new President and CEO, effective 1 November KEY DATA Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jul-Sep Full year Last 12 Amounts in SEK million unless indicated otherwise 2020 2019 2020 2019 2019 months Net sales 114 815 120 181 35 375 35 938 166 360 160 994 Operating profit before depreciation, amortisation and 1 impairment losses (EBITDA) 34 387 33 601 9 -

The European Court of Justice and the Development of EU Environmental Policy
Greening the EU: The European Court of Justice and the Development of EU Environmental Policy Renée Gagné Greening the EU: The European Court of Justice and the Development of EU Environmental Policy Since the European Union was founded, it has expanded its involvement to environmental policy. The European Court of Justice faces an increasing number of environmental cases in response to uncertainty regarding the appropriate role of the EU in this policy area. Specifically, the ECJ faces questions involving the appropriate balance between European economic and environmental interests, and the rights of EU institutions versus the rights of Member States to implement environmental policy. The ECJ uses tools such as the preliminary reference procedure, the infringement procedure, and the proportionality principle to address these challenges. Based on analysis of key European Court of Justice environmental cases, I find that the ECJ has played an inconsistent, but overall positive role in the development of European environmental policy. 2 Greening the EU: Table of Contents 1. Introduction 2. Review and evaluation of the scholarly literature 3. What is the European Court of Justice? a. Governing treaties b. Comparison with the US Supreme Court c. European constitutional court structure 4. Theories of legal integration a. Neo-functionalism b. Neo-realism c. Neither 5. Tools of legal integration and the horizontal-vertical shift in the EU legal structure a. Preliminary reference procedure b. Direct action/abstract judicial review c. Member state court and ECJ relationship 6. EU environmental policy a. Treaty history b. Issues involved 7. Major ECJ environmental cases a. Landmark case analysis b. -

E.ON Kraftwerke Gmbh
1 E.ON Kraftwerke GmbH 2014 Annual Report This is a translation of the German original of the annual financial statements of E.ON Kraftwerke GmbH. Only the German version of the annual financial statements shall be legally binding and final. 2 Content Management report Financial statements Balance sheet Income Statement Notes 3 E.ON Kraftwerke GmbH, Hanover 2014 Management Report 1. Business and framework conditions 1.1 Business activities E.ON Kraftwerke GmbH (EKW) operates 128 coal, natural gas, fuel as well as water power plants that are owned or managed by it, representing almost the entire national conventional power plant portfolio and the water power plants within E.ON Group with a capacity of about 9,000 megawatts. In addition, it provides services primarily in the area of operation management. All shares in EKW are held by E.ON Beteiligungen GmbH, Düsseldorf. Pursuant to section 6b (7) sentence 4 EnWG, which applies to EKW as a vertically integrated power supply company as defined in section 3 no. 38 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz – German Energy Industry Act), all activities pursuant to section 6b (3) sentence 1 EnWG are also to be addressed. As a power generation company, EKW exclusively conducts other activities as defined in section 6b (3) sentence 3 EnWG within the electricity industry. 1.2 Strategy The dramatic changes in the global energy markets, technical innovations and increasing and more individual customer expectations call for a bold new start. The current broad business model of E.ON SE, Düsseldorf (E.ON), is no longer suitable to meet the new challenges. -
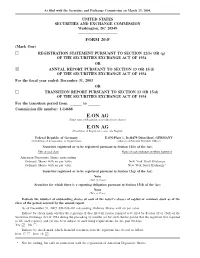
Form 20-F 2003
As filed with the Securities and Exchange Commission on March 25, 2004. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 20-F (Mark One) n REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ≤ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended: December 31, 2003 OR n TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 1-14688 E.ON AG (Exact name of Registrant as specified in its charter) E.ON AG (Translation of Registrant’s name into English) Federal Republic of Germany E.ON-Platz 1, D-40479 D¨usseldorf, GERMANY (Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Address of Principal Executive Offices) Securities registered or to be registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Name of each exchange on which registered American Depositary Shares representing Ordinary Shares with no par value New York Stock Exchange Ordinary Shares with no par value New York Stock Exchange* Securities registered or to be registered pursuant to Section 12(g) of the Act: None (Title of Class) Securities for which there is a reporting obligation pursuant to Section 15(d) of the Act: None (Title of Class) Indicate the number of outstanding shares of each of the issuer’s classes of capital or common stock as of the close of the period covered by the annual report. As of December 31, 2003, 656,026,401 outstanding Ordinary Shares with no par value. -

Annual Report 2016 Financial Results
Annual Report 2016 Financial Results 3 Only the German version of this Annual Report is legally binding. This Annual Report, and especially the Forecast Report section, contains certain forward-looking statements that are based on current assumptions and forecasts made by Uniper SE management and on other information currently available to Uniper SE management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause the actual results, financial condition, development or performance of the Company to differ materially from that anticipated in the estimates given here. Risks of this nature include, but are not limited to, the risks specifically described in the Risk Report. Uniper SE does not intend, and specifically disclaims any obligation, to update such forward-looking statements or to revise them in line with future events or developments. Contents Letter to Shareholders 2 Report of the Supervisory Board 4 Uniper Stock 10 Strategy and Objectives 13 Combined Management Report 16 Corporate Profile 19 Business Report 20 Macroeconomic and Industry Environment 20 Business Performance 29 Earnings 36 Financial Condition 42 Assets 46 Earnings, Financial Condition and Net Assets of Uniper SE 47 Non-financial Performance Indicators 49 Sustainability 49 Human Resources 51 Risk Report 56 Opportunity Report 63 Forecast Report 64 Internal Control System for the Accounting Process 68 Closing Statement by the Management Board in Accordance with Section 312(3) AktG 69 Additional Disclosures Regarding Takeovers 70 Corporate Governance -

Annual Report 2017 of the Board of Directors and of the Statutory Auditor to Be Presented at the Annual General Meeting on 26Th April 2018
2 Annual Report 2017 of the Board of Directors and of the Statutory Auditor to be presented at the Annual General Meeting on 26th April 2018 Insurance company authorised by decision of the Management Committee NBB (formerly CBFA) on the 6th November 2003. to underwrite “Liability” (branch 13) (Moniteur Belge 04.12.2003 - Code 2275) Registered Office: Av. Jules Bordet, 166 - B 3 B 1140 Brussels Belgium Tel. +32 (0)2 702 90 10 Fax. +32 (0)2 726 19 63 3 Financial Highlights In euro Statement of Earnings 2017 2016 2015 2014 2013 Net premium earned 6.476.981 6.132.484 4.995.260 4.921.570 3.144.445 Claims 82.562 0 16.871 -195.549 2 Expenses -1.732.726 -1.817.647 -1.741.989 -1.452.231 -1.167.688 Other income 268.093 310.013 152.405 197.802 150.174 Net investment result -110.001 3.195.613 9.461 961.173 1.535 Earnings before distribution to reserve for equalisation and catastrophes 4.984.909 7.820.463 3.432.008 4.432.764 2.128.468 Variation in the reserve for equalisation and catastrophes, net of reinsurance -5.169.436 -5.642.010 -3.457.960 -3.776.172 -2.169.630 Taxes -18 -343 -348 -21 -284 Earnings after distribution to reserve for equalisation and catastrophes -184.546 2.178.110 -26.300 656.570 -41.446 Balance Sheet Assets 102.277.362 93.374.321 78.016.247 76.363.388 71.742.994 Liabilities -1.121.362 -1.739.075 -1.475.830 -3.265.344 -2.983.181 Guarantee fund 101.155.999 91.635.246 76.540.417 73.098.044 68.759.813 (including reserve for equalisation and catastrophes) 4 C o n t e n t 6 Members 7. -

Annual Financial Statements of E.ON SE As of December 31, 2020
E.ON SE Financial Statements pursuant to German GAAP and Combined Group Management Report for the 2020 Financial Year E.ON SE’s Financial Statements, the Combined Group Management Report and the Separate Combined Non-Financial Report for the 2020 fiscal year will be published in the German Federal Gazette (“Bundesanzeiger”). E.ON SE’s management report is combined with that of the Group. Contents 4 Combined Group Management Report 4 Corporate Profile 4 Business Model 8 Management System 9 Innovation 12 Business Report 12 Macroeconomic and Industry Environment 15 Business Performance 16 Earnings Situation 21 Financial Situation 25 Asset Situation 26 Business Segments 32 E.ON SE’s Earnings, Financial, and Asset Situation 33 Other Financial and Non-financial Performance Indicators 33 – ROCE and Value Added 34 – Employees 38 Forecast Report 41 Risk and Chances Report 49 Internal Control System for the Accounting Process 51 Disclosures Regarding Takeovers 54 Corporate Governance Declaration 64 Compensation Report 84 Separate Combined Non-Financial Report 102 Financial Statements of E.ON SE 102 Balance Sheet 103 Income Statement 104 Notes 135 Declaration of the Board of Management 136 Auditors’ Report Page references in the Combined Group Management Report refer to the 2020 E.ON Annual Report. Combined Group Management Report Corporate Profile 4 Corporate Profile Renewables Substantially all of the operations in this segment were classified Business Model as discontinued operations effective June 30, 2018, and decon- solidated effective September 18, 2019. Certain business oper- E.ON is an investor-owned energy company with approximately ations were not transferred to RWE and were reassigned to other 78,000 employees led by Corporate Functions in Essen. -

2015 Annual Report
2015 Annual Report E.ON Group Financial Highlights1 € in millions 2015 2014 +/- % Attributable generating capacity (MW) 45,335 58,871 -23 – thereof renewables (MW) 8,428 10,474 -20 Fully consolidated generating capacity (MW) 46,479 60,151 -23 – thereof renewables (MW) 7,889 9,703 -19 Owned generation (billion kWh) 188.5 215.2 -12 – thereof renewables (billion kWh) 26.1 27.2 -4 Carbon emissions from power and heat production (million metric tons) 76.8 95.7 -20 Specific carbon emissions (million metric tons/MWh) 0.40 0.43 -7 Electricity sales (billion kWh) 780.9 780.2 – Gas sales (billion kWh) 1,721.8 1,171.0 +47 Sales 116,218 113,095 +3 EBITDA2 7,557 8,376 -10 EBIT2 4,369 4,695 -7 Net income/Net loss -6,377 -3,130 -104 Net income/Net loss attributable to shareholders of E.ON SE -6,999 -3,160 -121 Underlying net income2 1,648 1,646 – Investments 4,174 4,637 -10 Research and development costs 34 30 +13 Cash provided by operating activities of continuing operations 6,133 6,354 -3 Economic net debt (at year-end) 27,714 33,394 -17 Debt factor4 3.7 4.0 -0.33 Equity 19,077 26,713 -29 Total assets 113,693 125,690 -10 ROACE (%) 9.4 8.6 +0.85 Pretax cost of capital (%) 6.7 7.4 -0.75 After-tax cost of capital (%) 4.9 5.4 -0.55 Value added 1,251 640 +95 Employees (at year-end) 56,490 58,811 -4 – Percentage of female employees 29.9 28.9 +1.05 – Percentage of female executives and senior managers 16.7 15.8 +0.95 – Average turnover rate (%) 3.7 3.3 +0.45 – Average age 42 43 -13 – TRIF (E.ON employees) 2.0 2.0 – Earnings per share6, 7 (€) -3.60 -1.64 -120 Equity per share6, 7 (€) 8.42 12.72 -34 Dividend per share8 (€) 0.50 0.50 – Dividend payout 976 966 +1 Market capitalization7 (€ in billions) 17.4 27.4 -36 1Adjusted for discontinued operations. -
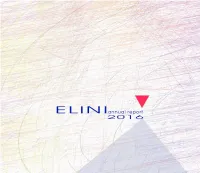
Statutory Auditor's Report to the Shareholders' Meeting Of
2 Annual Report 2016 of the Board of Directors and of the Statutory Auditor to be presented at the Annual General Meeting on 27th April 2017 Insurance company authorised by decision of the Management Committee NBB (formerly CBFA) on the 6th November 2003. to underwrite “Liability” (branch 13) (Moniteur Belge 04.12.2003 - Code 2275) Registered Office: Av. Jules Bordet, 166 - B 3 B 1140 Brussels Belgium Tel. +32 (0)2 702 90 10 Fax. +32 (0)2 726 19 63 3 Financial Highlights In euro Statement of Earnings 2016 2015 2014 2013 2012 Net premium earned 6.132.484 4.995.260 4.921.570 3.144.445 2.783.412 Claims 0 16.871 -195.549 2 -38.637 Expenses -1.817.647 -1.741.989 -1.452.231 -1.167.688 -1.066.659 Other income 310.013 152.405 197.802 150.174 155.166 Net investment result 3.195.613 9.461 961.173 1.535 2.224.312 Earnings before distribution to reserve for equalisation and catastrophes 7.820.463 3.432.008 4.432.764 2.128.468 4.057.594 Variation in the reserve for equalisation and catastrophes, net of reinsurance -5.642.010 -3.457.960 -3.776.172 -2.169.630 -2.286.598 Taxes -343 -348 -21 -284 0 Earnings after distribution to reserve for equalisation and catastrophes 2.178.110 -26.300 656.570 -41.446 1.770.996 Balance Sheet Assets 93.374.321 78.016.247 76.363.388 71.742.994 50.835.317 Liabilities -1.739.075 -1.475.830 -3.265.344 -2.983.181 -1.110.006 Guarantee fund 91.635.246 76.540.417 73.098.044 68.759.813 49.725.311 (including reserve for equalisation and catastrophes) 4 C o n t e n t 6 Members 7 Member Representatives & Status 10 Board of Directors 11 Advisory Committees 13 Management 14 Letter from the Chairman 15 Description of Activities 18 Report of the Board of Directors 22 Corporate Governance Report 24 Statutory Auditor’s Report 26 Balance Sheet and Income Statement 30 Notes to the Financial Statements 5 Members AB SVAFO MVM PAKS Nuclear Power Plant Ltd. -

Beschluss BK6-14-130
• 1Bundesnetzagentur - Beschlusskammer 6 Beschluss Az.: BK6-14-130 In dem Besonderen Missbrauchsverfahren der Baltic Cable AB, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö, Schweden, vertreten durch den Vorstand, - Antragstellerin - Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Clifford Chance LLP, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf zur Überprüfung des Verhaltens der TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth, vertreten durch die Geschäftsführung, - Antragsgegnerin - Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Im Zollhafen 24, 50678 Köln hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikati on, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch ihren Prä sidenten Jochen Homann, durch den Vorsitzenden Christian Mielke, den Beisitzer Dr. Jochen Patt und den Beisitzer Jens Lück aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15.6.2015 am 30.5.2016 beschlossen: Bundesnetzagentur für Telefax Bonn E-Mail Kontoverbindung Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post (02 28) 14-88 72 [email protected] Bundeskasse Trier und Eisenbahnen Internet BBk Saarbrücken http://www.bundesnetzagentur.de BIC: MARKDEF1590 Behördensitz:Bonn IBAN: DE 81 590 000 00 00 590 010 20 Tulpenfeld 4 53113 Bonn 1il' (02 28) 14-0 2 1. Der Antrag wird abgelehnt. 2. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. Gründe A. Die Antragstellerin und die Antragsgegnerin (gemeinsam die Parteien) streiten über die Be schränkung der Kapazität am Netzverknüpfungspunkt zu der Verbindungsleitung der Antragstel lerin in Lübeck-Herrenwyk. 1. Die Antragstellerin ist Betreiberin des Baltic Gable. Das Baltic Gable ist eine Gleichstrom Verbindungsleitung über 250 km mit einer Nennspannung von 450 kV zwischen Deutschland und Schweden. Es verbindet die Orte Lübeck in Deutschland und Trelleborg in Schweden. Auf deutscher Seite ist das Baltic Gable am Netzanschlusspunkt Lübeck-Herrenwyk mit dem Über tragungsnetz der Antragsgegnerin verbunden. -

Annual Report 2017
Annual Report 2017 WorldReginfo - 9441dee4-73d1-431f-b4ae-8b2817782330 E.ON Group Financial Highlights1 € in millions 2017 2016 +/- % Sales 37,965 38,173 -1 Adjusted EBITDA2 4,955 4,939 – – Regulated business 2,742 2,541 +8 – Quasi-regulated and long-term contracted business 828 842 -2 – Merchant business 1,385 1,556 -11 Adjusted EBIT2 3,074 3,112 -1 – Regulated business 1,677 1,482 +13 – Quasi-regulated and long-term contracted business 486 488 – – Merchant business 911 1,142 -20 Net income/loss 4,180 -16,007 – Net income/loss attributable to shareholders of E.ON SE 3,925 -8,450 – Adjusted net income2 1,427 904 +58 Investments 3,308 3,169 +4 Cash provided by operating activities of continuing operations -2,952 2,961 – Cash provided by operating activities of continuing operations before interest and taxes -2,235 3,974 – Economic net debt (at year-end) 19,248 26,320 -27 Debt factor3 3.9 5.3 -1.44 Equity 6,708 1,287 +421 Total assets 55,950 63,699 -12 ROCE (%) 10.6 10.4 +0,25 Pretax cost of capital (%) 6.4 5.8 +0,65 After-tax cost of capital (%) 4.7 4.0 +0,75 Value added 1,211 1,370 -12 Employees (at year-end) 42,699 43,138 -1 – Percentage of female employees 32 32 – – Percentage of female executives and senior managers 19.6 19.6 – – Average turnover rate (%) 4.6 5.3 -0.75 – Average age 42 42 – – TRIF6 (E.ON employees) 2.3 2.5 -8 Earnings per share7, 8 (€) 1.84 -4.33 – Equity per share7, 9 (€) 1.85 -0.54 – Dividend per share10 (€) 0.30 0.21 +43 Dividend payout 650 410 +59 Market capitalization9 (€ in billions) 19.6 13.1 +50 1The Uniper Group was deconsolidated effective December 31, 2016; it is shown in 2016 income statement as discontinued operation. -
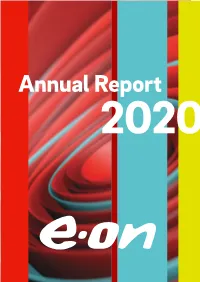
E.ON Annual Report 2020
Annual Report 2020 E.ON Group at a Glance € in millions 2020 2019 +/- % Sales1 60,944 41,284 +48 Adjusted EBITDA1, 2 6,905 5,564 +24 – Regulated business (%) 73 65 +83 – Quasi-regulated and long-term contracted business (%) 4 13 -93 – Merchant business (%) 23 22 +13 Adjusted EBIT1, 2 3,776 3,220 +17 – Regulated business (%) 79 70 +93 – Quasi-regulated and long-term contracted business (%) 3 11 -83 – Merchant business (%) 18 19 -13 Net income/loss 1,270 1,792 -29 Net income/loss attributable to shareholders of E.ON SE 1,017 1,550 -34 Adjusted net income1, 2 1,638 1,526 +7 Investments1 4,171 5,492 -24 Cash provided by operating activities1 5,313 2,965 +79 Cash provided by operating activities before interest and taxes1 5,948 4,407 +35 Economic net debt (at year-end)1 40,736 38,895 +5 Equity 9,055 13,248 -32 Total assets 95,385 98,080 -3 ROCE (%)1 6.2 8.3 -2.13 Employees (at year-end)1 78,126 78,948 -1 – Percentage of female employees 32 33 -13 – Average age 42 42 – Earnings per share4, 5 (€) 0.39 0.68 -43 Adjusted net income per share1, 4, 5 (€) 0.63 0.67 -6 Dividend per share6 (€) 0.47 0.46 +2 Dividend payout 1,225 1,199 +2 1Includes until September 18, 2019, the discontinued operations in the Renewables segment (see Note 5 to the Consolidated Financial Statements). 2Adjusted for non-operating effects. 3Change in percentage points. 4Attributable to shareholders of E.ON SE.