Notizen2105 Rez Asa Ga Kuru
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Festa Del Cinema Di Roma
Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in una foto FESTA che celebra, oltre al glamour del grande cinema, il senso di comunione e amore interrazziale. Lo scatto, in occasione delle riprese di Paris Blues di Martin Ritt (1961), film candidato all’Oscar® per la miglior colonna sonora firmata da Duke DEL CINEMA Ellington, rappresenta un omaggio a due icone della storia del cinema. Il senso di complicità, la gioia di stare insieme, la condivisione delle esperienze, il valore della collaborazione umana e artistica sono il beat DI ROMA della Festa del Cinema 2020. Sidney Poitier and Paul Newman are the protagonists of the official poster of the 15th Rome Film Fest. This is an image that celebrates the glamour of great cinema but also a sense of communion and interracial love.The photo, taken during the shooting of Paris Blues by Martin Ritt (1961), the film est ® F nominated for the Oscar for Best Soundtrack, composed by Duke Ellington, is a tribute to two icons in the history of film. That sense of complicity, the joy of being together, the sharing of experiences, the value of human and artistic collaboration are the beat of Rome Film Fest 2020. ome Film R oma | R 15 25 10 2020 esta del Cinema di F 20 Edizione 0 2 Edition © Everett Collection Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in una foto FESTA che celebra, oltre al glamour del grande cinema, il senso di comunione e amore interrazziale. -
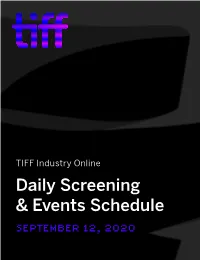
Daily Screening & Events Schedule
TIFF Industry Online Daily Screening & Events Schedule SEPTEMBER 12, 2020 A new world of color and contrast RealLaser advances RGB pure laser illumination. Approaching Rec. 2020 with color realism, RealLaser delivers rich, deep and intense color that doesn’t require fi ltering or correction. Bring new worlds of color and contrast to your theatre. Christie CP4315-RGB / CP4320-RGB (Other 2K and 4K models available in range) christiedigital.com/cinema ® Toronto International Film Festival Inc. used under license. ® Christie Digital Systems USA, Inc. I Industry user access P Press user access Press & Industry B Buyer user access * Availability per country on the schedule at TIFF.NET/INDUSTRY Daily Schedule Access TIFF Digital Cinema Pro September 12, 2020 at DIGITALPRO.TIFF.NET NEW TODAY Films are available for 48 hours from start time. 10 AM THE BIG HIT KILL IT AND LEAVE THIS TOWN THE PEOPLE UPSTAIRS SILVER SKATES: EDT 106 min. | TIFF Digital Cinema Pro 88 min. | TIFF Digital Cinema Pro 81 min. | TIFF Digital Cinema Pro MAKING OF & FOOTAGE Private Screening TIFF Industry Selects Private Screening 0 min. | TIFF Digital Cinema Pro I P B P B I B Private Screening B CURVEBALL - A TRUE STORY. THE MACALUSO SISTERS THE REASON UNFORTUNATELY. 94 min. | TIFF Digital Cinema Pro 82 min. | TIFF Digital Cinema Pro THE SPACEWALKER 108 min. | TIFF Digital Cinema Pro Private Screening Private Screening 100 min. | TIFF Digital Cinema Pro Private Screening I B I P B Private Screening B I B MAGIC MOUNTAINS ROCKFIELD: THE STUDIO IN BETWEEN DYING 82 min. | TIFF Digital Cinema Pro ON THE FARM THE UNFAMILIAR 89 min. -

Descarcă Catalogul Festivalului
PERGOLA GRĂDINII VERONA OUTDOOR FABRICA GRIVIŢA OUTDOOR CINEMA DRIVE-IN SNAGOV PARK DRIVE-IN Orange TV Go ONLINE LES FILMS DE CANNES À BUCAREST PREZENTAT DE: INSPIRAT DE CU SPRIJINUL PROIECT CULTURAL PARTENAIRE FINANŢAT DE PRIVILÉGIÉ , PARTENERI PARTENERI MEDIA PRINCIPALI PARTENERI MEDIA Caiet de brand Negru Galben cinefilia.ro CMYK 0, 0, 0, 100 CMYK 0, 21, 100, 0 Font: Candara / Bold ALL ABOUT ROMANIAN CINEMA AaRC LES FILMS DE CANNES À BUCAREST Desigur, cel mai important în perioada aceasta este să fim sănătoşi şi să facem ca lucrurile să continue să meargă cât de cât într-o normalitate, de la şcoală şi familiile noastre şi până la joburi – care sunt în pericol, în special cele ale freelancerilor din domeniul cultural şi al organizării de evenimente. Altfel însă, e important şi să încercăm să ne păstrăm pe cât se poate obiceiurile din viaţa noastră de dinainte – inclusiv cele care nu sunt necesare supravieţuirii imediate, cum sunt cele culturale în general şi un festival de film în particular. Căci da, nu se oprea lumea în loc dacă nu organizam noi ediţia a 11-a a Les Films de Cannes à Bucarest – însă ne-am încăpăţânat tocmai pentru fărâma de normalitate pe care continuarea acestei tradiţii o aduce în viaţa noastră. – Cristian Mungiu, iniţiatorul festivalului CUPRINS ANOTHER ROUND / Druk | 9 LE DISCOURS / The Speech | 9 ÉTÉ 85 / Summer of 85 | 10 MALMKROG | 10 MANDIBULES / Mandibles | 11 STILL THE WATER / Futatsume no mado | 11 SWEAT | 12 SWEET BEAN / An | 12 TRUE MOTHERS / Asa Ga Kuru | 13 LA VÉRITÉ / The Truth | 13 BORDER / Gräns | -

A Film by Naomi Kawase Kino Films Presents
True Mothers A film by Naomi Kawase Kino films presents True Mothers [ASA GA KURU] A film by Naomi Kawase WITH HIROMI NAGASAKU, ARATA IURA, AJU MAKITA, MIYOKO ASADA Japan | 139 min. INTERNATIONAL SALES www.playtime.group ©2020 “Asa ga Kuru” FILM PARTNERS/ KINOSHITA GROUP, KUMIE GROUP, KINOSHITA ©2020 “Asa ga Kuru” FILM PARTNERS/ SYNOPSIS “I want my son back,” But one day, a phone call threatens Satoko’s hap- One day when Asato is at school, Satoko receives a piness and the careful balance she has found. The call visit from Hikari. The slender young woman at her door that was what the woman was from a woman named Hikari: “I want my son back, bears no resemblance to the teenager who gave birth and if that’s not possible, I want my money.” to their adopted son. But more importantly, Satoko on the phone said…” feels instinctively that this woman is not Hikari. And if Hikari was Asato’s birth mother. Satoko and Kiyokazu she is not Hikari, then who is she? What will Satoko do After suffering through a long and unsuccessful series had met her once, when they adopted Asato. At the when Hikari’s shocking past is revealed? of fertility treatments, Satoko and her husband Kiyo- time, Hikari was 14 years old. The couple has not heard kazu make the decision to adopt a child. Six years after from Hikari, who is now 20, in over six years. Satoko adopting a boy they named Asato, Satoko has quit her had just assumed that the birth mother was living a job to concentrate fully on her husband and son. -

Naomi Kawase
PERSMAP TRUE MOTHERS EEN FILM VAN NAOMI KAWASE Drama - 2020 - Japan - 140 minuten Releasedatum: 21 januari online beschikbaar Meer over de film:www.cineart.nl/films/true-mothers Persmaterialen: www.cineart.nl/pers/true-mothers Distributie: Contact: Cinéart Nederland Julia van Berlo Herengracht 328-III T: +31 20 5308840 1016 CE Amsterdam M: +31 6 83785238 T: +31 20 530 88 48 [email protected] SYNOPSIS Na AN en RADIANCE keert de gerenommeerde Japanse regisseur Naomi Kawase terug met een ontroerend verhaal over familie en moederschap. Warm, menselijk, genuanceerd en met een perfect gevoel voor dat wat ons leven waarde geeft. Satoko en haar man hebben het goed, maar het lukt niet om zwanger te worden. Ze besluiten voor adoptie in aanmerking te willen komen. Zo worden ze de ouders van Asato, een jongentje geboren uit een onstuimige puberliefde. Jaren later komt hun gezinsgeluk onder spanning te staan als een onbekende jonge vrouw zich aandient en beweert Asato’s echte moeder te zijn. Satoko gaat de confrontatie met deze Hikari aan. Wie is ze en wat is er dedstijds gebeurd? Gebaseerd op een roman van Mizuki Tsujimora en met de herkenbare visuele kracht van Kawase, die de film een unieke intensiteit geeft. TRUE MOTHERS maakte deel uit van de officiële selectie van Cannes 2020. NAOMI KAWASE Director Born in Nara, Japan, Naomi Kawase graduated from Osaka University of the Arts in 1989. Her documentaries EMBRACING (1992) and ESCARGOT (1994) received international recognition and were awarded at the 1995 Yamagata Documentary Film Festival. In 1997, she became the youngest winner of the Camera d’or for her first feature SUZAKU, presented at the Directors’ Fortnight. -
Dp-Kawase-17Mai2.Pdf
CONTACTS PRESSE Rendez-vous Viviana Andriani / [email protected] Aurélie Dard / [email protected] Tél. : 01 42 66 36 35 PROGRAMMATION Martin Bidou et Maxime Bracquemart Tél. : 01 55 31 27 63/24 [email protected] [email protected] AU CINÉMA LE 21 JUILLET 2020 – Japon – VOST– 2h19 – 2.35 – 5.1 MARKETING Marion Tharaud et Pierre Landais Tél. : 01 55 31 27 32/52 [email protected] [email protected] DISTRIBUTION Haut et Court Laurence Petit Tél. : 01 55 31 27 27 [email protected] www.hautetcourt.com Matériel téléchargeable sur www.hautetcourt.com SYNOPSIS Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre contact avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre… ENTRETIEN AVEC NAOMI KAWASE En revanche, c’est la première fois que l’on vous voit filmer la ville moderne, notamment à travers de hauts buildings. Qu’y avez-vous découvert ? True Mothers traite de la maternité, un thème que vous avez déjà abordé dans vos films précédents. La représentation de la ville moderne est un Pour quelles raisons y revenir ? contraste avec la vision de la campagne dans mon film. Ça montre bien le Japon aujourd’hui. J’ai choisi de filmer True Mothers est l’adaptation d’un roman un quartier qui se situe le long de la baie de Tokyo, et à succès au Japon, qui s’intitule Le Matin arrive de qui est extrêmement moderne, avec des immeubles en Mizuki Tsujimira. -

Daily Screening & Events Schedule
TIFF Industry Online Daily Screening & Events Schedule SEPTEMBER 16–18, 2020 Mosteiro da Batalha I Industry user access P Press user access Press & Industry B Buyer user access * Availability per country on the schedule at TIFF.NET/INDUSTRY Daily Schedule Access TIFF Digital Cinema Pro September 16, 2020 at DIGITALPRO.TIFF.NET NEW TODAY Films are available for 48 hours from start time. 11 AM SHADOW IN THE CLOUD EDT 83 min. | TIFF Digital Cinema Pro Official Selection I P B STILL AVAILABLE SEP 15 FAUNA I AM GRETA UNDERPLAYED 11 AM 70 min. | TIFF Digital Cinema Pro 97 min. | TIFF Digital Cinema Pro 88 min. | TIFF Digital Cinema Pro EDT Official Selection Special Event Special Event I P B I P B I P B FIREBALL: VISITORS FROM THE TRUFFLE HUNTERS THE WATER MAN DARKER WORLDS 84 min. | TIFF Digital Cinema Pro 92 min. | TIFF Digital Cinema Pro 97 min. | TIFF Digital Cinema Pro Special Event Special Event Official Selection P I P B I P B I Industry user access P Press user access Press & Industry B Buyer user access * Availability information on the schedule at TIFF.NET/INDUSTRY Daily Schedule Access TIFF Digital Cinema Pro September 17, 2020 at DIGITALPRO.TIFF.NET NEW TODAY Films are available for 48 hours from start time. 11 AM ANOTHER ROUND* MEMORY HOUSE EDT 116 min. | TIFF Digital Cinema Pro 93 min. | TIFF Digital Cinema Pro Official Selection Official Selection P BEGINNING* 125 min. | TIFF Digital Cinema Pro SPRING BLOSSOM* Official Selection 73 min. | TIFF Digital Cinema Pro Official Selection TALKS 6 PM EDT In Conversation With.. -

Download, of Streaming – En Dan Telden We Af Voor Een Gelijk- Tijdige Start
AANGEBODEN DOOR UW FILMTHEATER, FDN & NVBF KITTY GREEN OVER THE ASSISTANT DE MONOTONIE VAN MISBRUIK BERO BEYER OVER HOE HET GAAT EN HOE NU VERDER EFFACER L’HISTORIQUE HACKEN MET HUMOR GIANFRANCO ROSI OP IDFA WERELD VAN EINDELOOS CONFLICT ESCAPISME EN TOTAL RECALL OP VAKANTIE MET VERHOEVEN 2020 #434 NOVEMBER JUST 6.5 TEHERAN ONDER SPANNING KeyFilm presenteert naar de bestseller van Arthur Japin geïnspireerd op het leven van Karin Bloemen Georgina Verbaan Abbey Hoes Eelco Smits FREEK DE JONGE een fi lm van Jelle Nesna /BuitenIsHetFeest iedereen heeft geheimen, maar niet alles kan geheim blijven. EEN FILM VAN THREES ANNA KEYFILM PRESENTEERT IN COPRODUCTIE MET AVROTROS FREEK DE JONGE “DE VOGELWACHTER” SOPHIE VAN WINDEN QUIAH SHILUE NICK GOLTERMAN PRODUCTION DESIGN VINCENT DE PATER MAKE-UP & HAAR TRUDY BUREN KOSTUUMONTWERP MARION BOOT SOUND DESIGN HERMAN PIEËTE CAS COMPONIST REYER ZWART MONTAGE WOUTER JANSEN NCE DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY JAN MOESKOPS NSC UITVOEREND PRODUCENT BEN BOUWMEESTER COPRODUCENT MYLÈNE VERDURMEN PRODUCENTEN HANNEKE NIENS & HANS DE WOLF SCENARIO & REGIE THREES ANNA 4ga NU IN DE BIOSCOOP 5 NOVEMBER IN DE BIOSCOOP 1 www.septemberfi lm.nl /septemberfi lmnl BuitenIsHetFeest_VogelwachterDe_Filmkrant_260x320.indd 1 06-10-20 14:43 DE FILMKRANT #434 NOVEMBER 2020 3 REDACTIONEEL Na zes maanden thuis proefpersoon te zijn geweest in onze eigen streaminglaboratoria en na als bioscoopbezoekers het aanbod van de laatste maanden op het grote scherm bekeken te hebben, komen velen van ons tot dezelfde conclusie: meer is niet per se beter. Sterker nog: meer is minder. Want al wordt een handjevol blockbusters wél uitgesteld, het is onmisken- baar dat zowel streamingdiensten als een deel van de distributeurs vooral met volume bezig zijn en hun kanalen of bioscoopslots vullen met afgeprijsde titels van de internationale markt.