1 Einführung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mobile Commerce Business Models and Technologies Towards Success
Rochester Institute of Technology RIT Scholar Works Theses 2003 Mobile commerce business models and technologies towards success Pinar Acar Follow this and additional works at: https://scholarworks.rit.edu/theses Recommended Citation Acar, Pinar, "Mobile commerce business models and technologies towards success" (2003). Thesis. Rochester Institute of Technology. Accessed from This Thesis is brought to you for free and open access by RIT Scholar Works. It has been accepted for inclusion in Theses by an authorized administrator of RIT Scholar Works. For more information, please contact [email protected]. MS in Information Technology Capstone Thesis Pinar Nilgul1 Acar 5/15/2003 Mobile Commerce Business Models and Technologies Towards Success By Pinar Nilgun Acar Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree ofMaster of Science in Information Technology Rochester Institute of Technology B. Thomas Golisano College of Computing and Information Sciences 5/15/2003 1 Rochester Institute of Technology B. Thomas Golisano College of Computing and Information Sciences Master of Science in Information Technology Thesis Approval Form Student Name: Pinar Nilgun Acar Project Title: Mobile Commerce Business Models and Technologies Towards Success Thesis Committee Name Signature Date Michael Floeser Chair Ed Holden Committee Member Jack Cook Committee Member Thesis Reproduction Permission Form Rochester Institute of Technology B. Thomas Golisano College of Computing and Information Sciences I Master of Science in Information Technology Title I, Pinar Acar. hereby grant permission to the Wallace Library of the Rochester Institute of Technology to reproduce my thesis in whole or in part. Any reproduction must not be for commercial use Dr profit. -
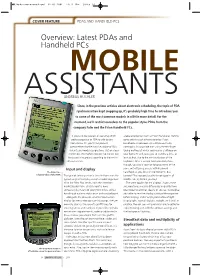
Overview: Latest Pdas and Handheld Pcs MOBILE
034pda-overviewed.qxd 02.03.2001 14:11 Uhr Seite 34 COVER FEATURE PDAS AND HANDHELD PCS Overview: Latest PDAs and Handheld PCs MOBILE ASSISTANTSANDREAS HUCHLER Since, in the previous articles about electronic scheduling, the topic of PDA synchronisation kept cropping up, it’s probably high time to introduce you to some of the most common models in a little more detail. For the moment, we’ll restrict ourselves to the popular stylus PDAs from the company Palm and the Psion Handheld PCs. If you’re in the process of deciding which usable alternatives such as Psion Handhelds start to pocket organiser or PDA to add to your come within reach in terms of price. Psion home Linux PC, you’ll find yourself Handhelds sit between stylus PDAs and (sub) overwhelmed by the massive choice of PDA notebooks. It is possible that using the ten-finger variants and model designations. But on closer typing method at which you may be a virtuoso on inspection, the models now on the market can your home PC will cause you to stumble a little, at be classed into groups according to their main least at first, due to the miniaturisation of the characteristics. keyboard. After a certain familiarisation phase, though, you could soon be forging ahead at the Input and display same sort of typing speeds with keyboard The Palm Vx – handhelds as you do with the home PC. But a luxury-class stylus PDA The type of data input has a direct influence on the beware! The keyboard quality is not equal in all typical range of everyday use of a mobile organiser. -

Handheld Technology Review, Technical Report 2001-008-C-06
QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/26874 Kajewski, Stephen L. and Tilley, Paul A. and Crawford, John and Remmers, Todd R. and Chen, Swee-Eng and Lenard, Dennis and Brewer, Graham and Gameson, Rod and Martins, Rui and Sher, Willy and Kolomy, Richard and Weippert, Achim and Caldwell, Geoff and Haug, Mark (2001) Handheld technology review. The Participants of the CRC for Construction Innovation have delegated authority to the CEO of the CRC to give Participants permission to publish material created by the CRC for Construction Innovation. This delegation is contained in Clause 30 of the Agreement for the Establishment and Operation of the Cooperative Research Centre for Construction Innovation. The CEO of the CRC for Construction Innovation gives permission to the Queensland University of Technology to publish the papers/publications provided in the collection in QUT ePrints provided that the publications are published in full. Icon.Net Pty Ltd retains copyright to the publications. Any other usage is prohibited without the express permission of the CEO of the CRC. The CRC warrants that Icon.Net Pty Ltd holds copyright to all papers/reports/publications produced by the CRC for Construction Innovation. Handheld Technology Review Rep ort 2 0 0 1 -0 0 8 -C-0 6 The research described in this report was carried out by: P roject L eader D r S tephen K ajewsk i (QU T) Team Mem bers P aul Tilley, Mr J ohn C rawford (C S IR O ), Todd R em m ers (C S IR O ) P rofessor S wee-E ng C hen, P rofessor D ennis L enard, G raham B rewer, R -
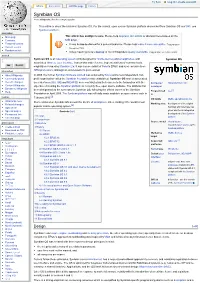
Symbian OS from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Try Beta Log in / create account article discussion edit this page history Symbian OS From Wikipedia, the free encyclopedia This article is about the historical Symbian OS. For the current, open source Symbian platform descended from Symbian OS and S60, see Symbian platform. navigation Main page This article has multiple issues. Please help improve the article or discuss these issues on the Contents talk page. Featured content It may be too technical for a general audience. Please help make it more accessible. Tagged since Current events December 2009. Random article It may require general cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Tagged since December 2009. search Symbian OS is an operating system (OS) designed for mobile devices and smartphones, with Symbian OS associated libraries, user interface, frameworks and reference implementations of common tools, Go Search originally developed by Symbian Ltd. It was a descendant of Psion's EPOC and runs exclusively on interaction ARM processors, although an unreleased x86 port existed. About Wikipedia In 2008, the former Symbian Software Limited was acquired by Nokia and a new independent non- Community portal profit organisation called the Symbian Foundation was established. Symbian OS and its associated Recent changes user interfaces S60, UIQ and MOAP(S) were contributed by their owners to the foundation with the Company / Nokia/(Symbian Ltd.) Contact Wikipedia objective of creating the Symbian platform as a royalty-free, open source software. The platform has developer Donate to Wikipedia been designated as the successor to Symbian OS, following the official launch of the Symbian [1] Help Programmed C++ Foundation in April 2009. -
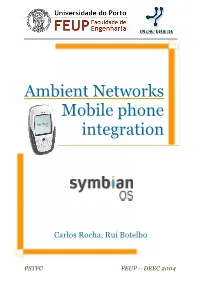
Ambient Networks Mobile Phone Integration
Ambient Networks Mobile phone integration Carlos Rocha, Rui Botelho PSTFC FEUP – DEEC 2004 Ambient network - Mobile phone integration Supervisor professor: Prof. Manuel Alberto Pereira Ricardo Project supervisor: Prof. Mário Jorge Moreira Leitão Department: Department of Electrical and Computer Engineering Institutions: Faculty of Engineering at University of Oporto Institute of Engineering and Computer Systems of Oporto i About the authors Carlos Rocha Carlos is a student at FEUP since 1999. Carlos first experience on Symbian came with the acknowledgment of the project in the end of 2003. The work on this subject continues at the time of this writing. Student number: 990503145 E-mail: [email protected] Telephone: 961818010 Rui Botelho Rui is also student at FEUP since 1999. As with Carlos, Rui Botelho heard about Symbian in late 2003 as it was a project proposal of Prof. Manuel Ricardo. Since then, this area has been one of his main interests. Student number: 990503146 E-mail: [email protected] Telephone: 963379295 ii We would like to thank Professor Manuel Pereira Ricardo for believing in this work and helping us to overcome the problems that we met along the semester. We also would like to thank our colleagues, Filipe Abrantes, Ricardo Duarte and António Madureira for all the work done in the integration of our projects. A special thank you note goes to Filipe Sousa from INESC for all the help and support given. iii Contents 1. Introduction 1.1 Overview....................................................................................................1 -

SYMBIAN OS Embedded Operating System
Adamson University 900 San Marcelino st., Ermita, Manila 1000 SYMBIAN OS Embedded Operating System Operating Systems Prof. Antonette Daligdig Atienza, Lemuel Jay Bacarra, Dan Paolo Dulatre, Michael Angelo Jimenez, John Edward Llorca, Bryalle November 2009 Table of Contents I Introduction II Origin/History III Characteristics III.a. Processing III.b. Memory Management III.c. I/O : Input/Output IV Features V Strengths VI Weakness VII Example of Applications where the OS is being used VIII Screenshots I Introduction More than 90% of the CPUs in the world are not in desktops and notebooks. They are in embedded systems like cell phones, PDAs, digital cameras, camcorders, game machines, iPods, MP3 players, CD players, DVD recorders, wireless routers, TV sets, GPS receivers, laser printers, cars, and many more consumer products. Most of these use modern 32-bit and 64-bit chips, and nearly all of them run a full-blown operating system. Taking a close look at one operating system popular in the embedded systems world: Symbian OS, Symbian OS is an operating system that runs on mobile ‘‘smartphone’’ platforms from several different manufacturers. Smartphones are so named because they run fully-featured operating systems and utilize the features of desktop computers. Symbian OS is designed so that it can be the basis of a wide variety of smartphones from several different manufacturers. It was carefully designed specifically to run on smartphone platforms: general-purpose computers with limited CPU, memory and storage capacity, focused on communication. Our discussion of Symbian OS will start with its history. We will then provide an overview of the system to give an idea of how it is designed and what uses the designers intended for it. -

Handheld Technology Review
Handheld Technology Review Rep ort 2 0 0 1 -0 0 8 -C-0 6 The research described in this report was carried out by: P roject L eader D r S tephen K ajewsk i (QU T) Team Mem bers P aul Tilley, Mr J ohn C rawford (C S IR O ), Todd R em m ers (C S IR O ) P rofessor S wee-E ng C hen, P rofessor D ennis L enard, G raham B rewer, R od G am eson, R ichard K olom y, R ui Martins, W illy S her (U N ) R esearcher Mr A chim W eippert (QU T) P roject A ffiliates Mr G eoff C aldwell (QD MR ) and Mr Mark H aug (QD P W ) Res earch P rogram C: D elivery and M anagem ent of B u ilt A s s ets P roject 2 0 0 1 -0 0 8 -C: P roject Team Integration: Com m u nication, Coordination and D ecis ion S u p p ort CONTENTS CONTENTS _______________________________________________________________ 1 LIST OF TABLES__________________________________________________________ 3 LIST OF FIGURES ________________________________________________________ 3 PREFACE ________________________________________________________________ 5 EXECUTIVE SUMMARY ___________________________________________________ 6 1 INTRODUCTION ______________________________________________________ 9 2 CURRENT STATE OF HANDHELD TECHNOLOGY _______________________ 10 2.1 Hardware Overview: What’s Available in General ____________________________ 10 2.2 Add-ons and Expansions __________________________________________________ 15 2.3 Integrated Phone & PDA: The Current trend ________________________________ 16 2.4 Software: What’s Available in General ______________________________________ 19 2.4.1 Palm OS_______________________________________________________________________ -
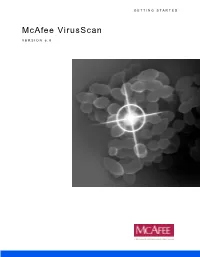
Mcafee Virusscan
GETTING STARTED McAfee VirusScan VERSION 6.0 COPYRIGHT © 2001 Networks Associates Technology, Inc and its Affiliated Companies. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means without the written permission of Network Associates, Inc. TRADEMARK ATTRIBUTIONS Active Security, Activehelp, Activeshield, Antivirus Anyware And Design, Bomb Shelter, Building A World Of Trust, Certified Network Expert, Clean-up, Cleanup Wizard, Cloaking, Cnx, Cnx Certification Certified Network Expert And Design, Cybercop, Cybermedia, Cybermedia Uninstaller, Data Security Letter And Design, Design (Logo), Design (Rabbit With Hat), Design (Stylized N), Disk Minder, Distributed Sniffer System, Distributed Sniffer System (In Katakana), Dr Solomon's, Dr Solomon's Label, Enterprise Securecast, Ez Setup, First Aid, Forcefield, Gauntlet, Gmt, Groupshield, Guard Dog, Helpdesk, Homeguard, Hunter, I C Expert, Isdn Tel/scope, Lan Administrature Architecture And Design, Langura, Languru (In Katakana), Lanwords, Leading Help Desk Technology, Lm1, M And Design, Magic Solutions, Magic University, Magicspy, Magictree, Magicword, Mc Afee Associates, Mcafee, Mcafee (In Katakana), Mcafee And Design, Netstalker, Mcafee Associates, Moneymagic, More Power To You, Multimedia Cloaking, Mycio.com, Mycio.com Design (Cio Design), Mycio.com Your Chief Internet Officer & Design, Nai And Design, Net Tools, Net Tools (And In Katakana), Netcrypto, Netoctopus, -

Quickstart Guide COPYRIGHT Copyright (C) 1999-2000 Networks Associates Technology, Inc
VirusScan Wireless Version 1.0 QuickStart Guide COPYRIGHT Copyright (c) 1999-2000 Networks Associates Technology, Inc. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means without the written permission of Networks Associates Technology, Inc., or its suppliers or affiliate companies. TRADEMARK ATTRIBUTIONS * ActiveHelp, Bomb Shelter, Building a World of Trust, CipherLink, Clean-Up, Cloaking, CNX, * ActiveHelp, Bomb Shelter, Building a World of Trust, CipherLink, Clean-Up, Cloaking, CNX, Compass 7, CyberCop, CyberMedia, Data Security Letter, Discover, Distributed Sniffer System, Dr Solomon's, Enterprise Secure Cast, First Aid, ForceField, Gauntlet, GMT, GroupShield, HelpDesk, Hunter, ISDN Tel/Scope, LM 1, LANGuru, LeadingHelp Desk Technology, Magic Solutions, MagicSpy, MagicTree, Magic University, MagicWin, MagicWord, McAfee, McAfee Associates, MoneyMagic, More Power To You, Multimedia Cloaking, NetCrypto, NetOctopus, NetRoom, NetScan, Net Shield, NetShield, NetStalker, Net Tools, Network Associates, Network General, Network Uptime!, NetXRay, Nuts & Bolts, PC Medic, PCNotary, PGP, PGP (Pretty Good Privacy), PocketScope, Pop-Up, PowerTelnet, Pretty Good Privacy, PrimeSupport, RecoverKey, RecoverKey-International, ReportMagic, RingFence, Router PM, Safe & Sound, SalesMagic, SecureCast, Service Level Manager, ServiceMagic, Site Meter, Sniffer, SniffMaster, SniffNet, Stalker, Statistical Information Retrieval (SIR), SupportMagic, Switch PM, TeleSniffer, TIS, TMach, TMeg, Total Network Security, Total Network Visibility, Total Service Desk, Total Virus Defense, T-POD, Trusted Mach,Trusted Mail, Uninstaller, Virex, Virex-PC, Virus Forum, ViruScan, VirusScan, VShield, WebScan, WebShield, WebSniffer, WebStalker, WebWall, and ZAC 2000 are registered trademarks of Network Associates and/or its affiliates in the US and/or other countries. -
![Psion: the Last Computer [Printer-Friendly] • Channel Register Page 1 of 33](https://docslib.b-cdn.net/cover/2812/psion-the-last-computer-printer-friendly-channel-register-page-1-of-33-9482812.webp)
Psion: the Last Computer [Printer-Friendly] • Channel Register Page 1 of 33
Psion: the last computer [printer-friendly] • Channel Register Page 1 of 33 Original URL: http://www.channelregister.co.uk/2007/06/26/psion_special/ Psion: the last computer Secrets of the Sony we never had By Andrew Orlowski ([email protected]) Posted in PC Builder, 26th June 2007 09:58 GMT Free whitepaper – Straight Talk with Dell: Sending out an SaaS Special Feature The Series 5 pocket computer from Psion was launched 10 years ago this week. It was a remarkable achievement: entirely new silicon, a new operating system, middleware stack and applications were developed from scratch in just over two years. This was the last time anyone undertook such a daunting task: it may be the last time anyone ever tries, either. Companies or projects that are formed to achieve simply one of these four goals typically end in failure: to achieve all four successfully, and put them in a product that was successful, too, was a triumph of creativity and management. We now live in a world where our general-purpose computers are created from generic, off-the-shelf components. New technology systems take the form of mass market appliances, such as the TomTom navigation system, or the iPod music player. The “Protea” project, as it was called, now seems destined to be remembered as the last time anyone will create, from the ground-up, a new general- purpose computer. As we discovered, however, this story is about much more than the life of a product. It’s about the fate of a once-inventive and fearless computer company. -

Psion Keeps at It
PSION KEEPS AT IT SERIES 7 ROUNDS OUT A GREAT LINEUP ■ by Mark Esposito In all my years working with Psion Software developed their 32bit Op- One Type I\II Compact Flash, and one hardware, going back to 1985, first as erating System called EPOC. Psion Type I\II PC Card. a user, and then as a programmer, it rolled this company off by forming a was always my dream to see a ma- new company called Symbian, joint- Expansion: ture handheld OS and lots of hard- ly-owned by Psion PLC, Nokia, Eric- 2 Internal bus slots for RAM\ROM, ware devices to choose from. While sson, Motorola, and Matsushita both accessible by user. not everything has moved as quick- (Panasonic). It is clear to see that ly as I would have liked, there is fi- EPOC is now being fitted to be the OS Display: nally some light at the end of the tun- for many future smart-phones. So Full VGA 640x480 pixels. 7.7” STN nel. there you have it. Psion Computers color back lit LCD touch screen display. Well, at least we’re in the tunnel. still develops handhelds based on With technology, there is no end of EPOC, but they have to pay licensing Keyboard: the tunnel. It just goes on forever, fees to Symbian for the EPOC Oper- Pitch 17mm. Travel 3mm. Unique transforming as it goes. It’s all great ating System. pantograph mechanism. news for the consumers that have very patiently waited for handheld I may have to eat my words..