Hydrologie Und Geomorphologie Des Nationalparks Kalkalpen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
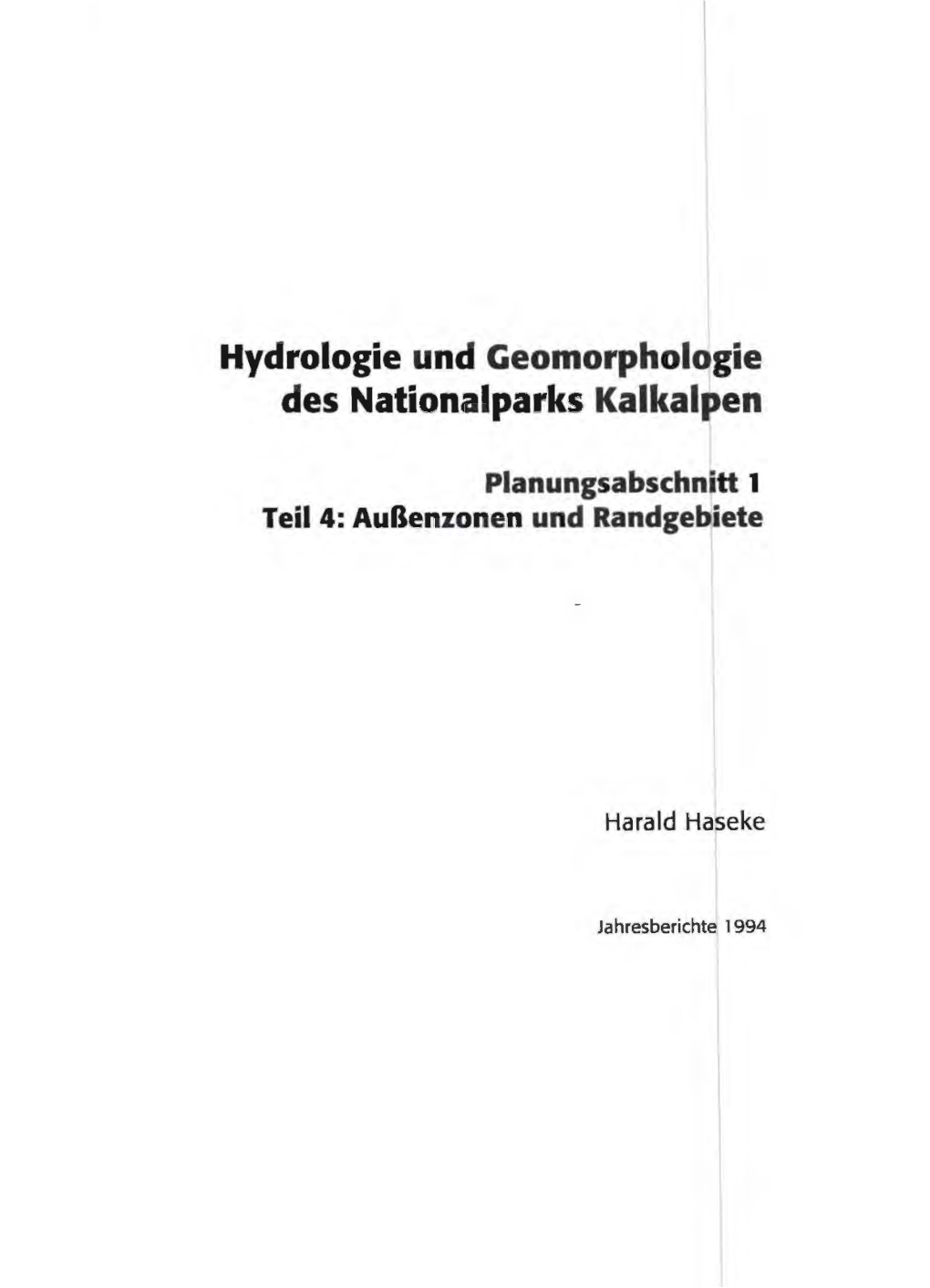
Load more
Recommended publications
-

Die Österreichische Eisenstraße
Die Österreichische Eisenstraße als UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe? Die Österreichische Eisenstraße als UNESCO-Weltkultur-Die Österreichische Eisenstraße und Naturerbe? Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie erstellt von Michael S. Falser Ausschnitt aus der Scheda‘schen Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates, um 1850 ISBN 978-3-9501577-5-8 Nationalpark Kalkalpen, Michael S. Falser Schriftenreihe des Nationalpark Kalkalpen Band 9 Impressum © Nationalpark O.ö. Kalkalpen Ges.m.b.H., 2009 Titelfoto Verein O.ö. EIsenstraße, Einklinker v.o.: Archiv Ennskraft, Verein O.ö. Eisenstraße, Michael S. Falser (2x), Erich Mayrhofer Autor Michael S. Falser Redaktion Erich Mayrhofer, Michael Falser, Franz Sieghartsleitner Lektorat Regina Buchriegler, Michael Falser, Franz Sieghartsleitner, Angelika Stückler Fotos Archiv Ennskraft, Michael Falser, Erich Mayrhofer, Nationalpark Kalkalpen, Franz Siegharts- leitner, Verein O.ö. Eisenstraße, Alfred Zisser Quellennachweis Michael S. Falser: Die Österreichische Eisenstraße als UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe, Wien 2009 Herausgeber Nationalpark O.ö. Kalkalpen Ges.m.b.H., Nationalpark Allee 1, 4591 Molln Grafik Andreas Mayr Druck Friedrich VDV, Linz; 1. Auflage 3/2009 ISBN 978-3-9501577-5-8 INHALTSVERZEICHNIS Danksagung des Autors ........................................................................................................................... 5 Landeshauptmann Niederösterreich ....................................................................................................... 6 Landeshauptmann -

ALPBIONET2030 Integrative Alpine Wildlife and Habitat Management for the Next Generation
ALPBIONET2030 Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation Super Strategic Connectivity Areas in and around the Alps Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation The ´Super-SACA´ approach – very important areas for [ecological] connectivity in the Alps 1) Strategic Alpine Connectivity Areas - a basis for the Super SACA identification The ALPBIONET2030 project tried to bring together, analyse and combine a series of different indicators influencing ecological connectivity at different levels in order to illustrate the current situation of connectivity in the alpine and EUSALP territory and to elaborate, through a collection of the maps, a concrete foundation for planning a sustainable strategy of land use in the Alpine Space. The project integrated essential factors of such a strategy by defining Strategic Alpine Connectivity Areas (SACA) with an especially dedicated tool (JECAMI 2.0), evaluating wildlife management and human-nature conflict management aspects and generating recommendations. The extent of the project encompassed, for the first time in this thematic field, the whole area of the European Strategy of the Alpine Region (EUSALP). Map1: Strategic Alpine Connectivity Areas in the Alps and EUSALP 2 Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation Map N°1 displays all three of the different types of Strategic Alpine Connectivity Areas at once. The map clearly illustrates that the Ecological Intervention Areas (EIA) constitute the largest percentage of the Strategic Alpine Connectivity Areas. The EIA act as linkages between Ecological Conservation Areas (ECA) as well as buffer zones. Looking at the Alpine and EUSALP picture, it appears that the ECA, mostly located in the higher Alpine areas, are, to a large extent, already benefiting from an existing protection measure (some category of protected area) and therefore need commitment to long term preservation of this status without any degradation of ecological functioning. -

ABSTRACT of the Nationalpark Karst Research Program 1994 - 1997
Nationalpark O.ö. Kalkalpen Ges.m.b.H. Nationalpark Allee 1 A-4591 Molln, 07584/3951, Fax 3654-291 ABSTRACT of the Nationalpark Karst Research Program 1994 - 1997 Karst Program Part.Proj. 13/96 Harald Haseke and partners Annual report 1996/97 Haseke96_Koordination96.doc Forschungsberichte 1996 Seite 1 Nationalpark O.ö. Kalkalpen Ges.m.b.H. Nationalpark Allee 1 A-4591 Molln, 07584/3951, Fax 3654-291 NATIONALPARK KALKALPEN (UPPER AUSTRIA) KARST RESEARCH PROGRAM The Nationalpark Karst Program 1994-1997 Introduction Karst landscapes represent an important facet of the Earth’s geodiversity, and one of major management significance. The term karst denotes a distinctive type of terrain characterised by individual landform types and landform assemblages that are largely the product of rock ma- terial having been dissolved by natural waters to a greater degree than in most other land- scapes. Two essential characteristics of karst must be taken into account in developing protective policies: • its integrity is intimately dependent upon maintenance of the natural hydrological system; • karst is vulnerable to a distinctive set of environmental sensitivities. From the system-analytical point of view, the conception “karst“ means a range of themes whose investigation requires a multidisciplinary cooperation between several branches of bio- und geosciences. Karst research includes all aspects of landscape description and genesis, including knowledge on the kinds of dynamic processes from the past to the future. As in many aspects of protected area management, the establishment of protected areas is not enough in itself. The management of karst demands specific interdisciplinary expertise and this is in the early stages of development in most countries. -

Forschung Im Nationalpark 2007/2008
Forschung im Nationalpark 2007/2008 Scientific research in national parks 2007/2008 IMPRESSUM Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Stubenbastei 5, 1010 Wien www.lebensministerium.at Gesamtkoordination: Ingrid Adelpoller, DI Monika Paar, Abt. II/4 Übersetzung: Carola Vardjan, Mirjam Freund Fotos: Nationalparks Hohe Tauern, Kalkalpen, Thayatal, Donau-Auen, Neusiedler See – Seewinkel, Gesäuse Titel – großes Bild: Scheuchzer Wollgras (Nationalpark Hohe Tauern) Titel – kleine Bilder von links nach rechts: Libelle (Nationalpark Donau-Auen/Kracher) Nachtfalter (Nationalpark Donau-Auen/Kracher) Thayatal im Morgengrauen (Nationalpark Thayatal/Dieter Manhart) Fischotter (Nationalpark Gesäuse) Bisher erschienen: Forschungsbericht 2000, Forschungsbericht 2002 und Forschungsbericht 2004 Copyright: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Alle Rechte vorbehalten Gestaltung: Skibar Grafikdesign Vorwort/Foreword 0 100km Nationalparks 5 Staatsgrenze Niederösterreich Linz Landesgrenze Wien 4 Oberösterreich St. Pölten d n Eisenstadt a Salzburg 2 l 3 6 n e Steiermark Bregenz g r Vorarl- Innsbruck Salzburg u berg Tirol 1 B Graz Kärnten Klagenfurt 1 Hohe Tauern 2 Kalkalpen 3 Neusiedler See – Seewinkel 4 Donau-Auen 5 Thayatal 6 Gesäuse Schutz der Biodiversität und Bildung der Protection of biodiversity and visitors education Besucher Die Forschung ist ein Schwerpunkt der österreichischen Research is one of the priorities of Austria’s National Nationalparks. Das Lebensministerium und die National- Parks. Over the past two years the Ministry of Life and the parkverwaltungen haben in den vergangenen zwei Jahren National Park Administration Offices have worked to pre- an einer Strategie für die Zukunft der österreichischen Na- pare a strategy for the future of the Austrian National tionalparks gearbeitet, denn die Nationalparks sollen noch Parks, which are to intensify their already close coopera- enger zusammenarbeiten, um Synergien zu nutzen.