6.1 Aachen – Das Tor Zur Deutschen Industrialisierung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download (7MB)
British Technologies and Polish Economic Development 1815-1863 Simon Niziol Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy London School of Economics and Political Science University of London December 1995 UMI Number: U084454 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U084454 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 "Theses . F 9555 . 12586 2-5 Abstract After the restoration of peace in 1815, several European countries sought to transform their economies by the direct borrowing of British technologies. One of these was the semi- autonomous Kingdom of Poland. The Kingdom's technology transfer initiatives have been largely ignored by foreign researchers, while Polish historians have failed to place developments in the Kingdom within a wider context of European followership. The varying fortunes of Polish transfer initiatives offer valuable insights into the mechanisms and constraints of the transfer process. A close study of attempts to introduce British technologies in mechanical engineering, metallurgy, railway construction, textile production and agriculture contradicts most Polish scholarship by establishing that most of the transfer initiatives were either misplaced or at least premature. -

Volume 20 # 76 September 1998 BELGIAN LACES ISSN 1046-0462
Belgian Laces http://www.carnavaldebinche.org/ Volume 20 # 76 September 1998 BELGIAN LACES ISSN 1046-0462 Official Quarterly Bulletin of THE BELGIAN RESEARCHERS Belgian American Heritage Association Founded in 1976 Our principal objective is: Keep the Belgian Heritage alive in our hearts and in the hearts of our posterity President Pierre Inghels Vice-President Micheline Gaudette Assistant VP Leen Inghels Treasurer Marlena Bellavia Secretary Patricia Robinson All subscriptions are for the calendar year. New subscribers receive the four issues of the current year, regardless when paid. Opinions expressed in Belgian Laces are not necessarily those of The Belgian Researchers or of the staff. TABLE OF CONTENTS BAHS - West Virginia, Vickie ZABEAU-BOWDEN 2 A Summer-trip Discovery, Jack LECHIEN 2 Northwest Corner, Leen INGHELS 2 Verviers, Micheline GAUDETTE 3 Emgrants from Verviers to America, Florence VANDERHAEGEN 4 Wisconsin Corner, Mary Ann Defnet, 5 Belgians on board the Titanic, Kassandra PICAVET 6 Susan DEOM-STILES Reminiscences, Susan STILES 7 Gleanings 7 The Priest with the "Midas Touch", subm by Dolores DE YOUNG-FALLON 9 Muskrats threaten Dikes, subm by Jean DUWEZ 10 Carnival and Ommegang, Leen INGHELS 11 In Memoriam 13 The Saga of Isadore De MAN, Alice DE MAN-HAWKINS 14 In Search of Constant FORTEMPS, subm by Regine BRINDLE 15 Important Websites for Genealogical Research 19 Allegheny Co Naturalizations, Charlotte ROGERS 20 List of Emigrants from Verviers, Florence VANDERHAEGEN 21 Belgian Laces Vol 20 #76 49 August 1998 Dear members, Where has the summer gone??? After a wet, ccool, yes even rather cold spring, that didn’t know when to quit, the summer came on late and strong! Temperatures in the 100 degrees is not really what we, nor our flowers like. -
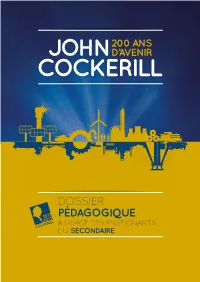
Dossier Pédagogique À Usage Des Enseignants Du Secondaire
DOSSIER PÉDAGOGIQUE À USAGE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE 1 EXPOSITION PRÉSENTÉE À LA BOVERIE DU 2 JUIN 2017 AU 17 SEPTEMBRE 2017 Une initiative de la Fondation John Cockerill Conception et rédaction : Marie Lekane, responsable du service éducatif de la Maison de la métallurgie et de l’industrie de Liège DOSSIER PÉDAGOGIQUE À USAGE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE TABLE DES MATIÈRES 1 INTRODUCTION : PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION ET DE CE DOSSIER PÉDAGOGIQUE . 7 2 LA PRÉ-INDUSTRIE DANS LE PAYS DE LIÈGE . 9 La pré-industrie sidérurgique . 9 L’industrie textile dans la région . 10 3 LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE : UNE RÉVOLUTION D’ORIGINE ANGLAISE . 11 Le four à puddler . .13 Le coke : une innovation indispensable pour la sidérurgie . 14 La Révolution industrielle : des mutations profondes . 15 4 LES COCKERILL : DES ANGLAIS VECTEURS DE L’INDUSTRIALISATION . 16 5 JOHN COCKERILL : UN CAPITAINE D’INDUSTRIE HORS DU COMMUN . 17 John Cockerill : un Européen avant l’heure ! . 18 Chantier naval d’Anvers . 19 Le chemin de fer . 19 Grandeur et vicissitudes : le coup de poker russe de John Cockerill . .20 6 SERAING : DE LA CAMPAGNE À LA CITÉ DU FER . 21 7 S.A. COCKERILL : CONTINUITÉ, MUTATION ET RENAISSANCE FINANCIÈRE D’UNE ENTREPRISE (1840-1886). L’EXPANSIONNISME DE PASTOR ET SADOINE . 26 Conrad Gustave Pastor . 26 8 LA DEUXIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE : L’ÈRE DE L’ACIER, DE LA CHIMIE ET DU MOTEUR À EXPLOSION . 32 L’acier . 32 4 Comment fabrique-t-on de l’acier ? . .32 Production de l’acier . .32 9 LES GREINER : DE L’APOGÉE INDUSTRIELLE AUX DESTRUCTIONS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE . -

Introduction to the Special Issue
Continuity and Change (2019), 34,1–13 doi:10.1017/S0268416019000092 SPECIAL ISSUE ON BRITISH LABOUR AND MIGRATION TO EUROPE DURING THE INDUSTRIAL REVOLUTION Introduction to the Special Issue Fabrice Bensimon* Sorbonne Université *Corresponding author. Email: [email protected] Abstract In the period 1815–1870, several thousand British workers and engineers went to the con- tinent for work purposes, playing a decisive part in European industrialisation. Workers emigrated because they could market their skills at good value; or because their British employers sought to make the most of their technical lead by setting businesses up abroad, and by producing on the continent, they could avoid protective tariffs. Which social and cultural factors enabled British capital to flow to continental and indeed global enterprise, British skills to shape labour processes overseas, and British male and female labourers to seek and find overseas employment? This introduction to the Special Issue raises a series of questions on these flows. It asks what numbers went to the continent, in comparison with the large flows to the US and the British World. It addresses the legislative and economic aspects of these labour migrations and tries to relate these to the discussion on the supposed ‘high-wage economy’ of the British indus- trial revolution. It also focuses on the practicalities of migration. Last, it is also interested in the cultural, religious and associational life of the British migrants, as well as in the rela- tions with the local populations. 1. Introduction In the period 1815–1870, several thousand British workers and engineers went to the continent for work purposes, playing a decisive part in European industrialisa- tion. -

The Rate and Direction of Invention in the British Industrial Revolution: Incentives and Institutions
NBER WORKING PAPER SERIES THE RATE AND DIRECTION OF INVENTION IN THE BRITISH INDUSTRIAL REVOLUTION: INCENTIVES AND INSTITUTIONS Ralf Meisenzahl Joel Mokyr Working Paper 16993 http://www.nber.org/papers/w16993 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 April 2011 Prepared for the 50th anniversary conference in honor of The Rate and Direction of Inventive Activity, ed. Scott Stern and Joshua Lerner. The authors acknowledge financial support from the Kauffman Foundation and the superb research assistance of Alexandru Rus. The opinions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect views of the Board of Governors of the Federal Reserve System or those of the National Bureau of Economic Research. NBER working papers are circulated for discussion and comment purposes. They have not been peer- reviewed or been subject to the review by the NBER Board of Directors that accompanies official NBER publications. © 2011 by Ralf Meisenzahl and Joel Mokyr. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source. The Rate and Direction of Invention in the British Industrial Revolution: Incentives and Institutions Ralf Meisenzahl and Joel Mokyr NBER Working Paper No. 16993 April 2011 JEL No. N13,N73,O31,O34,O43 ABSTRACT During the Industrial Revolution technological progress and innovation became the main drivers of economic growth. But why was Britain the technological leader? We argue that one hitherto little recognized British advantage was the supply of highly skilled, mechanically able craftsmen who were able to adapt, implement, improve, and tweak new technologies and who provided the micro inventions necessary to make macro inventions highly productive and remunerative. -

World Civ Chapter 25.Pdf
584 On July 14, 1789, an angry French mob attacked the Bastille, a state prison in Paris, because they were looking for arms and gunpowder. The capture of this prison is considered the beginning of the French Revolution. Political Revolutions In Unit 5, you will learn that new ideas about human rights and government led to political revolutions in many countries during the late 1700s and the 1800s. At the end of the unit, you will have a chance to compare and contrast those revolutions. (See pages 706—711.) 585 The Industrial Revolution, 1700–1900 Previewing Main Ideas SCIENCE AND TECHNOLOGY From the spinning jenny to the locomotive train, there was an explosion of inventions and technological advances. These improvements paved the way for the Industrial Revolution. Geography What other European countries besides England had coal, iron, and textile industries in the 1800s? EMPIRE BUILDING The global power balance shifted after the Industrial Revolution. This shift occurred because industrialized nations dominated the rest of the world. Geography Study the map. Which country appears to be the most industrialized? ECONOMICS The Industrial Revolution transformed economic systems. In part, this was because nations dramatically changed the way they produced and distributed goods. Geography What geographic factors might have encouraged the development of industry in certain places? INTERNET RESOURCES • Interactive Maps Go to classzone.com for: • Interactive Visuals • Research Links • Maps • Interactive Primary Sources • Internet Activities • Test Practice VIDEO Patterns of Interaction: • Primary Sources • Current Events The Industrial and Electronic • Chapter Quiz Revolutions 714 715 What are fair working conditions? You are a 15-year-old living in England where the Industrial Revolution has spurred the growth of thousands of factories. -

Jarmo Peltola the British Contribution to the Birth of the Finnish Cotton
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE This is the accepted manuscript of the article, which has been published in Continuityprovided by Trepo - Institutional Repository of Tampere University and Change, 2019, 34(1), 63-89. https://doi.org/10.1017/S0268416019000080 Jarmo Peltola The British contribution to the birth of the Finnish Cotton Industry, 1820–1870 Introduction In the early years of the nineteenth century cotton was the most important product in the world. The growth of the cotton industry would fuel the development of capitalism across Europe and, indeed, the rest of the world as the century advanced. 1 Kristine Bruland2 has argued, with particular reference to Norway between 1840 and 1870, that the spread of the industry across Europe was greatly influenced by the technological advances and organizational practices developed, and exported, from Great Britain. As well as Norway, Belgium, Germany, the Russia Empire, and Sweden all benefitted from British expertise. The cotton industry in Finland developed rather later than in many other European countries, not helped by the country’s location on the North Eastern shores of the Baltic which froze for large parts of the year, cutting off supply routes and making international travel very challenging. As in other North European countries, in its early days the Finnish industry drew many of its industrialists and skilled workers from Britain. Later on, these were followed by a new social group that had emerged in Britain between the skilled workers and the mill owners: the cotton masters, technical specialists. 3 In Britain, this stratification was common in such industrial areas as Lancashire. -

Mechanical Missionary
16 PENNINE IDENTITY 4:5 Great, Empress of Russia, had been encouraging workmen from Britain to visit Russia and impart their expertise to her own subjects. William Cockerill, in the company of others of like mind, travelled to St Petersburg, then capital of Russia. Catherine died in Novem- ber 1796, and with her the policies of developing an industrially-trained workforce. Her successor, the Tsar Paul, who was known as a lunatic, caused William Cockerill to work on a Commission for some public works. When it wasn't completed within his time limit, Paul determined to impri- son Cockerill in the famous Fortress of St Peter and Paul. Fortunately, William was forewarned and managed to escape from. Russia. Where exactly he went to next is uncertain. He may have returned to England, or made his escape from Russia by sailing to Sweden. By 1797 he was definitely working in Sweden making machinery for a woollen mill 1 on the outskirts of StockhOlm. In the 9- same year his two eldest sons, William and Charles James, left England to join ll 175 i r him there. About a year later he left ke Sweden after failing to make a success Coc of machinery making, or the timber m trade, and travelled to Hamburg. It llia was there that he met a Belgian named Wi Mali from a woollen firm in Verviers, Belgium. In 1799 he moved to Verviers and began to make machines for the firm of Simons and Biolley. In 1800 he echanical delivered twelve machines to the firm which proved so successful that more and more were ordered. -

The Beginnings of Industrialization in Britain
wh10te-062501-0717-0722 9/5/03 2:06 PM Page 717 LESSON PLAN 1 Steam train on the Nancha Power plant in West Virginia, OBJECTIVES Bank, China United States • Explain the beginnings of industrialization in Britain. The Beginnings of Industrialization • Describe key inventions that furthered the Industrial Revolution. MAIN IDEA WHY IT MATTERS NOW TERMS & NAMES • Identify transportation improvements. • Trace the impact of railroads on SCIENCE AND TECHNOLOGY The changes that began in • Industrial • factors of The Industrial Revolution started Britain paved the way for Revolution production British industry. in England and soon spread to modern industrial societies. • enclosure • factory other countries. • crop rotation • entrepreneur • industrialization FOCUS & MOTIVATE Note that the Industrial Revolution SETTING THE STAGE In the United States, France, and Latin America, politi- cal revolutions brought in new governments. A different type of revolution now included key changes in the way people transformed the way people worked. The Industrial Revolution refers to the and goods could travel from one place to greatly increased output of machine-made goods that began in England in the another. What are some ways that people middle 1700s. Before the Industrial Revolution, people wove textiles by hand. and goods travel today? (car, airplane, Then, machines began to do this and other jobs. Soon the Industrial Revolution train, truck, ship) spread from England to Continental Europe and North America. INSTRUCT Industrial Revolution Begins in Britain TAKING NOTES Following Chronological In 1700, small farms covered England’s landscape. Wealthy landowners, how- Order On a time line, Industrial Revolution Begins ever, began buying up much of the land that village farmers had once worked. -

WILLIAM COCKERILL Und Seine Familie
FAMILIE COCKERILL Teil II . WILLIAM COCKERILL und seine Familie 1 Abb. 1 William Cockerill (1757 - 1832) 2 Abb. 2 Elizabeth (Betty) Cockerill, geb. Charles (1760-1823) 3 William (Guillaume) COCKERILL und Elisabeth (Betty) geb. CHARLES William (Guillaume) COCKERILL Schreiner/Mechaniker aus Haslingden, England, Begründer der Cockerill - Werke in Belgien. * Haslingden, 1757 + Schloß Berensberg bei Aachen, 23.01.1832 = Spa, Belgien, .. oo Bury, Lancashire/England, Parish Church, 25.12.1779 mit: Elisabeth (Betty) CHARLES Tochter von William CHARLES , Lehrer in Padiham, und Katherine SPENCER (?) .. * Burnley, 02.03.1760 + Spa, Belgien, 07.06.1823, um Mitternacht, ca. 62 Jahre alt; = Spa, Belgien, 4 WILLIAM COCKERILL und seine Familie Als Sohn des Steinmetz bzw. Maurers in Cribdenside bei Haslingden, WILLIAM COCKERILL und seiner Ehefrau, ALICE geb. WILSON, wurde WILLIAM COCKERILL vermutlich im Jahre 1757 im Kirchspiel Haslingden geboren. Verschiedentlich wird auch 1759 als Geburtsjahr genannt. Eine Geburts- oder Taufeintragung in den Kirchenbüchern ist bisher noch nicht gefunden worden. In seinem Reisepaß von 1808 wird er jedoch als 51 Jahre alt bezeichnet. Über die Jugend von WILLIAM COCKERILL ist nur sehr wenig bekannt. Es wird berichtet, daß er Cribdenside verließ und in einem Haus in Haslingden (Higher-lane) lebte, zusam- men mit seiner Mutter, der dieses Haus gehörte. In diesem Haus soll er auch mit der Her- stellung der ersten in Haslingden gefertigten Webmaschine begonnen haben. Es zeigte sich jedoch, daß dieses Unternehmen ein Fehlschlag war. Die Webmaschinen waren für Wolle bestimmt und das war im Haslingden jener Zeit eine stark zurückgehende Industrie. Er ging deshalb nach Radcliffe, in der Nähe von Bury, wo er eine Arbeit als Schmied an- nahm. -

Module 1 Lkr.Indd
Lessenpakket: MODULE 1 Leerkra chten MODULE 1 De 19e eeuw Overzicht inhoud : A. De sociaal-economische situatie 1. Industriële revolutie in Groot-Britt annië Groepswerk 2. Industrialisering in ons land Zoekoefening in groepen 3. Gevolgen voor de gewone burger Zoekoefening in groepen B. De politieke situatie 1. Periode 1815 – 1830 Zoekoefeningen individueel of in groep 2. Periode 1830 Zoekoefeningen individueel of in groep C. Geleidelijke veranderingen Groepswerk 1 Lessenpakket: MODULE 1 Leerkra chten De 19e eeuw Doelstelling: het Daensisme plaatsen tegen de sociaal-economische en politieke achtergrond van de 19e eeuw A. Sociaal-economische situatie 1. De 1e industriële revolutie – Groot-Brittannië de 1e industriële revolutie verandert het aanzien van de samenleving drastisch. Vanuit de bakermat – Groot-Brittannië – waait ze over naar onze contreien: Gent is de 1 e stad op het Europese vasteland dat het voorbeeld van Groot-Britt annië volgt (vandaar de bijnaam: “Het Manchester van het continent.”) Werkmethode voor de leerlingen: Ideaal zou zijn dat men vakoverschrijdend ( geschiedenis-Engels ) kan werken. - Leerlingen leren samenvatten. - Leerlingen oefenen mondelinge vaardigheden door hun bevindingen klassikaal te bespreken. - Je kan de leerlingen ook vragen een schriftelijke samenvatting (in schemavorm) te maken; in dit opzicht is het belangrijk dat ze samenhang tra chten te vinden tussen de verschillende uitvindingen. Het vereenvoudigt eveneens de mondelinge rapportering. Groep Engels: de tekst kan verdeeld worden over groepjes van 2 leerlingen. Zo zijn de tekstgedeelten beperkt. Elk groepje leest een onderdeelt van The Industrial Revolution (uit “An illustrated history of England- John Burke uitg.Collins p.212 – 226) en legt nadien aan de klas uit wat de industriële revolutie betekent voor Groot-Brittannië. -

The First Industrial Revolution: Creation of a New Global Human Era
Munich Personal RePEc Archive The First Industrial Revolution: Creation of a New Global Human Era Mohajan, Haradhan Assistant Professor, Department of Mathematics, Premier University, Cgittagong, Bangladesh. 30 May 2019 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/96644/ MPRA Paper No. 96644, posted 24 Oct 2019 08:56 UTC Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5, No. 4, 2019, pp. 377-387 The First Industrial Revolution: Creation of a New Global Human Era Haradhan Kumar Mohajan Department of Mathematics, Premier University, Chittagong, Bangladesh Cell: +8801716397232, Email: [email protected] Abstract The First Industrial Revolution began in England in about 1750–1760 that lasted to sometime between 1820 and 1840. It is one of the most distinguished turning points in human history. During this period human and animal labour technology transformed into machinery, such as the steam engine, the spinning jenny, coke smelting, puddling and rolling processes for making iron, etc. Industrial Revolution is renewed for global economic growth, increase in production and consumption of common people. The system of transportation communication through canals, road and rails had improved. Also banking and other financial systems improved to run the industries and business firms smoothly. Child and infant mortality rate decreased and fertility rate increased. As a result, population growth had dramatically changed. On the other hand, women and child labour has increased in dangerous and unhygienic condition. Factory workers have to work sixteen hours in a day merely to save the family from starvation. Industrial Revolution created a wide gap between the rich and the poor. An attempt has taken here to describe the various effects of Industrial Revolution.