Mitteilungen Der Münchner Entomologischen Gesellschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
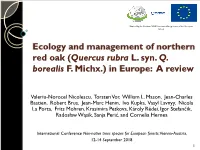
(Quercus Rubra L. Syn. Q. Borealis F. Michx.) in Europe: a Review
Funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union Ecology and management of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe: A review Valeriu-Norocel Nicolescu, Torsten Vor, William L. Mason, Jean-Charles Bastien, Robert Brus, Jean-Marc Henin, Ivo Kupka, Vasyl Lavnyy, Nicola La Porta, Frits Mohren, Krasimira Petkova, Károly Rédei, Igor Stefančik, Radosław Wąsik, Sanja Perić, and Cornelia Hernea International Conference Non-native trees species for European forests, Vienna-Austria, 12-14 September 2018 1 Overview Introduction Major species characteristics Ecology of northern red oak Management of northern red oak Conclusions 2 Introduction Northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) (NRO): Broadleaved tree species originating from the eastern half of the U.S.A. (32 to 47o N latitude, 62 to 96 o W longitude). Natural distribution map for Q. rubra (adapted from Little, 1971) 3 Introduction Natural range The northernmost American oak species (= 'baptised' borealis) In pure or mixed stands, along with both hardwoods (Quercus sp., Fraxinus sp., Acer sp., Populus sp., Carya sp., Juglans sp., Magnolia sp., Celtis sp., etc.) and softwoods (Pinus sp., Thuja sp.). 4 Introduction Europe Introduced in 1691: NRO seeds/seedlings were brought in to France and planted in Le Petit Trianon (vicinity of Versailles Palace). Especially in the 19th century: used in parks, gardens, arboreta, trials, as well as forest plantations, all over Europe, with the exception of the cold zone of Scandinavia. 5 Introduction Currently: NRO covers over 350,000 ha in Europe, with the most important forest areas in: - Ukraine:192,868 ha - France: 52,000 ha - Germany: 44,550 ha - Poland:15,261 ha - Hungary:13,174 ha - Slovenia:11,978 ha - Bulgaria: 9,941 ha - Netherlands: 8,696 ha On a smaller scale: found in Czech Republic (5,586 ha), Romania (ca. -

The Walnut Plantations (Juglans Spp.) in Italy and Spain: Main Factors Affecting Growth
ANN ALS OF SILVIC U LTURAL RESEARCH 44 (1), 2020: 14-23 https://journals-crea.4science.it/index.php/asr Research paper Special Issue: HORIZON 2020 GA 728086 WOODnat “Second generation of planted hardwood forests in the EU” The walnut plantations (Juglans spp.) in Italy and Spain: main factors affecting growth Francesco Pelleri1, Gaetano Castro1, Maurizio Marchi1,2*, Jesus Fernandez-Moya 3, Pier Mario Chiarabaglio1, Achille Giorcelli1, Massimo Gennaro1, Sara Bergante1, Maria Chiara Manetti1, Manuela Plutino1, Claudio Bidini1, Dalila Sansone1, Ignacio Urbán-Martínez3 Received 11/06/2019 - Accepted 20/12/2019 - Published online 07/02/2020 Abstract - Walnut tree species (Juglans spp.) are commonly used for high-quality wood production in plantation forestry. In this paper, the most relevant walnut plantations in Italy and Spain have been reviewed and analysed under a geographic and techni- cian management point of view. Between 2016 and 2019 a total of 96 plantations (15 - 25 years old) were visited distributed in the North-western part of the Mediterranean basin. A statistical analysis (linear model no interaction and PCA) was then performed to evaluate the relative importance of some environmental and management variables for walnut trees in analysed plantations. Results highlighted a variable situation with many different adopted planting schemes across the regions as well as a not standardised spatial layout and management type (thinning). Lower densities and smaller trees were adopted in Italy with about 200 trees ha-1 versus 330 trees ha-1 in Spain. In addition to the age of the plantation as one of the most influencing parameters also the plantation density and the average crown diameter were highly statistically significant. -

Folk Taxonomy, Nomenclature, Medicinal and Other Uses, Folklore, and Nature Conservation Viktor Ulicsni1* , Ingvar Svanberg2 and Zsolt Molnár3
Ulicsni et al. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2016) 12:47 DOI 10.1186/s13002-016-0118-7 RESEARCH Open Access Folk knowledge of invertebrates in Central Europe - folk taxonomy, nomenclature, medicinal and other uses, folklore, and nature conservation Viktor Ulicsni1* , Ingvar Svanberg2 and Zsolt Molnár3 Abstract Background: There is scarce information about European folk knowledge of wild invertebrate fauna. We have documented such folk knowledge in three regions, in Romania, Slovakia and Croatia. We provide a list of folk taxa, and discuss folk biological classification and nomenclature, salient features, uses, related proverbs and sayings, and conservation. Methods: We collected data among Hungarian-speaking people practising small-scale, traditional agriculture. We studied “all” invertebrate species (species groups) potentially occurring in the vicinity of the settlements. We used photos, held semi-structured interviews, and conducted picture sorting. Results: We documented 208 invertebrate folk taxa. Many species were known which have, to our knowledge, no economic significance. 36 % of the species were known to at least half of the informants. Knowledge reliability was high, although informants were sometimes prone to exaggeration. 93 % of folk taxa had their own individual names, and 90 % of the taxa were embedded in the folk taxonomy. Twenty four species were of direct use to humans (4 medicinal, 5 consumed, 11 as bait, 2 as playthings). Completely new was the discovery that the honey stomachs of black-coloured carpenter bees (Xylocopa violacea, X. valga)were consumed. 30 taxa were associated with a proverb or used for weather forecasting, or predicting harvests. Conscious ideas about conserving invertebrates only occurred with a few taxa, but informants would generally refrain from harming firebugs (Pyrrhocoris apterus), field crickets (Gryllus campestris) and most butterflies. -

Goat Moth (Cossus Cossus)
Goat Moth (Cossus cossus ) Areas and status: Throughout England, south and west Wales and Highlands of Scotland; also occurs locally in Ireland. Substantial decline throughout its range. Woodland type: Upland Broadleaved Woodland, Lowland Broadleaved Woodland, PAWS, Wet Woodland, Wood-pasture and Parkland Preferred habitat niches: High forest, veteran trees, wood-pasture, parkland, glades, rides, edges, clear fell, coppice, wet woodland. Breeds on a wide range of deciduous trees and age classes. Favours damaged or stressed trees growing in damp soils and/or in sunny situations including: Willows, Poplars, Ash, Alder, Crab Apple, Apples, plus a range of other domestic fruit trees, and Oak Elm and Birch. ©Les Hill Potential habitat management issues associated with decline: Overzealous management resulting in removal of sickly looking and dying trees/branches Potential habitat management solutions: Prescription Comment Minimal intervention Retain large, veteran, sickly looking and dying trees/branches; especially if located in wet woodlands and/or sunny situations. Also retain trees with damage to their branches, trunks and/or bark. Thinning, Selective felling Carefully manage whole woodland to ensure the presence of a wide range of age classes. Especially favour those trees which have the potential to become the mature and veteran trees of the future. Manage standards Lightly thin trees (e.g. 1 tree/ha/yr) growing in areas of closed canopy; during felling, allow falling tree to damage nearby trees. Drainage Retain wet areas and if necessary, block culverts and drainage ditches. PAWS Retain all deciduous trees, including dying specimens; carefully fell and extract nearby conifers. Woodland creation (native species, If few young trees are present, create new woodland on areas of low ecological interest. -

Diversity of the Moth Fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a Wetland Forest: a Case Study from Motovun Forest, Istria, Croatia
PERIODICUM BIOLOGORUM UDC 57:61 VOL. 117, No 3, 399–414, 2015 CODEN PDBIAD DOI: 10.18054/pb.2015.117.3.2945 ISSN 0031-5362 original research article Diversity of the moth fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a wetland forest: A case study from Motovun forest, Istria, Croatia Abstract TONI KOREN1 KAJA VUKOTIĆ2 Background and Purpose: The Motovun forest located in the Mirna MITJA ČRNE3 river valley, central Istria, Croatia is one of the last lowland floodplain 1 Croatian Herpetological Society – Hyla, forests remaining in the Mediterranean area. Lipovac I. n. 7, 10000 Zagreb Materials and Methods: Between 2011 and 2014 lepidopterological 2 Biodiva – Conservation Biologist Society, research was carried out on 14 sampling sites in the area of Motovun forest. Kettejeva 1, 6000 Koper, Slovenia The moth fauna was surveyed using standard light traps tents. 3 Biodiva – Conservation Biologist Society, Results and Conclusions: Altogether 403 moth species were recorded Kettejeva 1, 6000 Koper, Slovenia in the area, of which 65 can be considered at least partially hygrophilous. These results list the Motovun forest as one of the best surveyed regions in Correspondence: Toni Koren Croatia in respect of the moth fauna. The current study is the first of its kind [email protected] for the area and an important contribution to the knowledge of moth fauna of the Istria region, and also for Croatia in general. Key words: floodplain forest, wetland moth species INTRODUCTION uring the past 150 years, over 300 papers concerning the moths Dand butterflies of Croatia have been published (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). -

Populus Alba
Populus alba Populus alba in Europe: distribution, habitat, usage and threats G. Caudullo, D. de Rigo are established for wood industries, where other poplars do not perform well, for example where the water table is inaccessible or The white poplar (Populus alba L.) is a medium-sized tree commonly occurring in coastal and riparian forests of central and the soil is poor or saline. In such cases, the wood can be used for southern Europe. Its wide range covers from the Mediterranean region to Central Asia. It is a fast-growing pioneer tree, biomass energy, as pulpwood for paper, for packaging (crates and which thrives in borders and sunny habitats in sandy alluvial soils and dunes. Its reproduction is primarily by root suckers boxes), pellets and partially as saw-logs. Plant density on pure arising from lateral roots from which it forms dense and large colonies. It is used as an ornamental tree appreciated for plantations can be higher than other poplars and the rotation its attractive double-coloured foliage, as a windbreak and for dune stabilisation thanks to its tolerance of salt winds. The reaches 18-25 years2, 6, 15. It is widely planted as an ornamental white poplar is free from threatening diseases, while it is considered an aggressive invasive species in North America, New tree in parks and gardens, for its attractive double-coloured Zealand and South Africa. This poplar covers an important ecological role as a component of floodplain mixed forests, which foliage2, 6. Poplar leaves could be used as cattle feed and as are ecosystems with very high biodiversity and that are strongly threatened by human activities. -

Price-List 2020
Biochemtech SRL Price-list 2020 Pheromone lures (page 1-18) Ready to use pheromone set (page 19-22) Traps (page 23-24) House insect products (page 25) Price categories (page 26) PHEROMONE LURES Catalogue Pest by latin name Pest by common name number AAB0001 Acalymma trivittatum stern Spotted Cucumber Beetle AAB0002 Acalymma vittatum Striped Cucumber Beetle AAB0003 Acleris rhombana Fruit tree tortrix AAB0004 Acrobasis nuxvorella Pecan Nut Case Bearer AAB0005 Acrobasis vaccinii Cranberry fruitworm AAB0006 Acrolepiopsis assectella Leek Moth AAB0007 Adoxophyes orana Summer fruit Tortrix AAB0008 Agriotes lineatus Lined Click Beetle AAB0009 Agriotes obscurus Dusky Wireworm AAB0010 Agriotes sordidus Click beetle AAB0011 Agriotes species Click beetle AAB0012 Agriotes spp Agriotes wireworm AAB0013 Agriotes sputator Common click beetle AAB0014 Agriotes ustulatus Click beetle AAB0015 Agrotis andina Quinoa cutworm phone: +373-22-926135 web: biochemtech.eu m/phone: +373-68361010 address: Str. Mesterul Manole 12, MD 2052, Chisinau, Moldova m/phone: +373-79569298 e-mail: [email protected] Page 1 of 25 Biochemtech SRL AAB0016 Agrotis exclamationis Heart and dart moth AAB0017 Agrotis ipsilon Black Cutworm AAB0018 Agrotis orthogonia Pale Western Cutworm AAB0019 Agrotis segetum Turnip Moth AAB0020 Ambrosia Beetle AAB0021 Amyelois transitella Navel orange worm AAB0022 Anarsia lineatella Peach Twig Borer AAB0023 Anastrepha fraterculus South African Fruit Fly AAB0024 Anastrepha ludens Mexican Fruit Fly AAB0025 Anomala rufocuprea Soybean beetle AAB0026 Anoplophora -
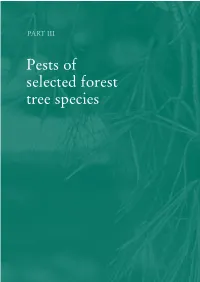
Part III. Pests of Selected Forest Tree Species
PART III Pests of selected forest tree species PART III Pests of selected forest tree species 143 Abies grandis Order and Family: Pinales: Pinaceae Common names: grand fir; giant fir NATURAL DISTRIBUTION Abies grandis is a western North American (both Pacific and Cordilleran) species (Klinka et al., 1999). It grows in coastal (maritime) and interior (continental) regions from latitude 39 to 51 °N and at a longitude of 125 to 114 °W. In coastal regions, it grows in southern British Columbia (Canada), in the interior valleys and lowlands of western Washington and Oregon (United States), and in northwestern California (United States). Its range extends to eastern Washington, northern Idaho, western Montana, and northeastern Oregon (Foiles, 1965; Little, 1979). This species is not cultivated as an exotic to any significant extent. PESTS Arthropods in indigenous range The western spruce budworm (Choristoneura occidentalis) and Douglas-fir tussock moth (Orgyia pseudotsugata) have caused widespread defoliation, top kill and mortality to grand fir. Early-instar larvae of C. occidentalis mine and kill the buds, while late- instar larvae are voracious and wasteful feeders, often consuming only parts of needles, chewing them off at their bases. The western balsam bark beetle (Dryocoetes confusus) and the fir engraver (Scolytus ventralis) are the principal bark beetles. Fir cone moths (Barbara spp.), fir cone maggots (Earomyia spp.), and several seed chalcids destroy large numbers of grand fir cones and seeds. The balsam woolly adelgid (Adelges piceae) is a serious pest of A. grandis in western Oregon, Washington and southwestern British Columbia (Furniss and Carolin, 1977). Feeding by this aphid causes twigs to swell or ‘gout’ at the nodes and the cambium produces wide, irregular annual growth rings consisting of reddish, highly lignified, brittle wood (Harris, 1978). -

Report of the State Entomologist on Injurious and Other Insects of The
: [From the Forty-fourth Report of the New York'State Museum.] SEVENTH REPORT ON THE Injurious and Other Insects STATE OF NEW YORK, Made to the Reo^enis of the University, Pursuant to Chapter 355 of the Laws of 1883. By J. a. LINTNER, Ph. D., State Entomologist. ALBANY JAMES B. LYON, STATE PRINTER. 1891. ?v.c'^UXlJo '-o'j^'^ L. TABLE OF CONTENTS. PAGE. INTRODUCTOKY 215 No serious insect attacks, or importation of insect pests during the year, 215. Abundance of the apple-tree tent-caterpillar, 215. The neglected orchards of the State, 215. The failure of the fruit crop of the State ascribable largely to seasonal conditions and fungoid attacks, 215. Exemption from the usual injury from the white- marked tussock-moth caterpillars, 216. Injuries to corn from the corn-worm, 216. Increasing depredations from the bud-worm, 216. Spread of the apple-leaf Bucculatrix in Western New York, 216. A New Y''ork locality for Chloropisca prolifica, and probable dis- covery of its breeding grounds, 216. Unusual abundance on Long Island of the northern lady-bird, and the 12-spotted Diabrotica, 217. Continued northern progress of the elm-leaf beetle, 217. Studies of the bean-weevil, 217. Prevalence of the grain aphis in rye fields in Eastern New York, 217. Unlocked for, and inex- plicable appearance of the 17-year Cicada on the Hudson river, 218. Collection of insects made in Keene valley, in the several orders, with notice of the more interesting forms, 219. The contri- butions to the department, 220. A collection purchased, con- taining rarities, 220. -

New Taxa of Cossidae from SE. Asia (Lepidoptera, Cossidae) by Ro M a N V
Atalanta (Dezember 2004) 35(3/4):369-382, col, pis. XIX, XXa, Wurzburg, ISSN 0171-0079 New taxa of Cossidae from SE. Asia (Lepidoptera, Cossidae) by Ro m a n V. Ya k o v lev received 20.X.2004 Summary: Two new genera of Cossidae from the Oriental fauna are described: Garuda gen. nov., Butaya gen. nov. (Zeuzerinae Boisduval, [1828]); and nine new species: Patopta ganesha spec. nov. (LT: Nepal, Ganesh Himal, valley of Mailung Khola), Cossus siniaevi spec. nov. (LT: China, Shaanxi prov, Tai Bai Shan Mts., Tsiling Mts., Houzhenzi), Paracossus khmer spec. nov. (LT: S. Cambodia, Sre Klong env., Kirirom), Paracossus microgenitalis spec. nov. (LT: S. Borneo, Sabah prov., Trus Madi bei, Apin Apin), Paracossus predictus spec. nov. (LT: N. Celebes, Mina- hassa) (Cossinae Leach, [1815]), Garuda galina spec. nov. (LT: China, Yunnan prov. (NE), Jinsha river, Tiger leaping gorge), Butaya gracilis spec. nov. (LT: China, W. Yunnan prov. Xishuang- banna Dai auton. pref., Puwen, 30 km SSW of Simao), Trismelasmos robinson spec. nov. (LT: Philippines, Leyte (S), Mt. Balocaue), and Panau borealis spec. nov. (LT: China, W-Yunnan prov., Xishuangbanna Dai auton. pref., Puwen, 30 km SSW Simao) (Zeuzerinae Boisduval, [1828]). One new synonym is stated: Cossus cossus chinensis Rothschild, 1912 = Cossus cossus orientalis Gaede, 1929, syn. nov. Pe3K>Me: .B CTaTbe npuBoanTcn onncaHnn HOBbix TaxcoHOB M3 IOB A3mm: nea poaa - Garuda gen. nov., Butaya gen. nov. (Zeuzerinae Boisduval, [1828]); h 9 HOBbix bhaob: Patopta ganesha spec. nov. (LT: Nepal, Ganesh Himal, valley of Mailung Khola), Cossus siniaevi spec. nov. (LT: China, Shaanxi prov, Tai Bai Shan Mts., Tsiling Mts., Houzhenzi), Paracossus khmer spec. -

Policy and Legislation Summary
© Ian Wallace Policy and Legislation Summary Legal disclaimer Whilst every effort has been made to be accurate in explaining complex legislation in layman’s language, this document does not constitute legal advice and neither the authors nor Buglife can guarantee the accuracy thereof. Anyone using the information does so at his/her own risk and shall be deemed to indemnify Buglife from any and all injury or damage arising from such use. SPECIES STATUS: LISTS OF INVERTEBRATE SPECIES COVERED BY POLICY AND LEGISLATION IN THE UK The following tables list the invertebrate species covered by the UK’s domestic wildlife legislation, national biodiversity policies and relevant international statutes. Most of these measures aim to protect vulnerable species, but some invasive alien species are also covered by legislation. The tables are as follows: 1. UK invertebrate species protected by international statutes 2A. Invertebrate species listed on Schedule 5 of the Wildlife and Countryside Act 1981 (as amended) for England and Wales and the Nature Conservation (Scotland) Act 2004. 2B. Invertebrate species protected under the Wildlife (Northern Ireland) Order 1985 (as amended) 3A. Invertebrate species listed under Section 41 of the Natural Environment and Rural Communities Act for England and under Section 42 for Wales 3B. Invertebrate species of principal importance for the conservation of biodiversity in Scotland 4. Invertebrate species endangered by trade and listed under the EU CITES Regulations 5A. Invertebrate species listed on Schedule 9 of the Wildlife and Countryside Act 9 (as amended) 5B. Invertebrate species listed on Schedule 9 of the Wildlife (Northern Ireland) Order (as amended) Further information For up to date information on UK legislation visit http://www.legislation.gov.uk. -
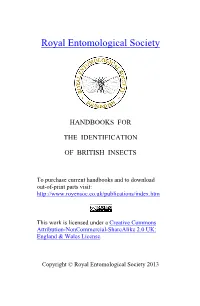
An Introduction to the Immature Stages of British Flies
Royal Entomological Society HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION OF BRITISH INSECTS To purchase current handbooks and to download out-of-print parts visit: http://www.royensoc.co.uk/publications/index.htm This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales License. Copyright © Royal Entomological Society 2013 Handbooks for the Identification of British Insects Vol. 10, Part 14 AN INTRODUCTION TO THE IMMATURE STAGES OF BRITISH FLIES DIPTERA LARVAE, WITH NOTES ON EGGS, PUP ARIA AND PUPAE K. G. V. Smith ROYAL ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON Handbooks for the Vol. 10, Part 14 Identification of British Insects Editors: W. R. Dolling & R. R. Askew AN INTRODUCTION TO THE IMMATURE STAGES OF BRITISH FLIES DIPTERA LARVAE, WITH NOTES ON EGGS, PUPARIA AND PUPAE By K. G. V. SMITH Department of Entomology British Museum (Natural History) London SW7 5BD 1989 ROYAL ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON The aim of the Handbooks is to provide illustrated identification keys to the insects of Britain, together with concise morphological, biological and distributional information. Each handbook should serve both as an introduction to a particular group of insects and as an identification manual. Details of handbooks currently available can be obtained from Publications Sales, British Museum (Natural History), Cromwell Road, London SW7 5BD. Cover illustration: egg of Muscidae; larva (lateral) of Lonchaea (Lonchaeidae); floating puparium of Elgiva rufa (Panzer) (Sciomyzidae). To Vera, my wife, with thanks for sharing my interest in insects World List abbreviation: Handbk /dent. Br./nsects. © Royal Entomological Society of London, 1989 First published 1989 by the British Museum (Natural History), Cromwell Road, London SW7 5BD.