Bad Feelings
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Dangerous Method
A David Cronenberg Film A DANGEROUS METHOD Starring Keira Knightley Viggo Mortensen Michael Fassbender Sarah Gadon and Vincent Cassel Directed by David Cronenberg Screenplay by Christopher Hampton Based on the stage play “The Talking Cure” by Christopher Hampton Based on the book “A Most Dangerous Method” by John Kerr Official Selection 2011 Venice Film Festival 2011 Toronto International Film Festival, Gala Presentation 2011 New York Film Festival, Gala Presentation www.adangerousmethodfilm.com 99min | Rated R | Release Date (NY & LA): 11/23/11 East Coast Publicity West Coast Publicity Distributor Donna Daniels PR Block Korenbrot Sony Pictures Classics Donna Daniels Ziggy Kozlowski Carmelo Pirrone 77 Park Ave, #12A Jennifer Malone Lindsay Macik New York, NY 10016 Rebecca Fisher 550 Madison Ave 347-254-7054, ext 101 110 S. Fairfax Ave, #310 New York, NY 10022 Los Angeles, CA 90036 212-833-8833 tel 323-634-7001 tel 212-833-8844 fax 323-634-7030 fax A DANGEROUS METHOD Directed by David Cronenberg Produced by Jeremy Thomas Co-Produced by Marco Mehlitz Martin Katz Screenplay by Christopher Hampton Based on the stage play “The Talking Cure” by Christopher Hampton Based on the book “A Most Dangerous Method” by John Kerr Executive Producers Thomas Sterchi Matthias Zimmermann Karl Spoerri Stephan Mallmann Peter Watson Associate Producer Richard Mansell Tiana Alexandra-Silliphant Director of Photography Peter Suschitzky, ASC Edited by Ronald Sanders, CCE, ACE Production Designer James McAteer Costume Designer Denise Cronenberg Music Composed and Adapted by Howard Shore Supervising Sound Editors Wayne Griffin Michael O’Farrell Casting by Deirdre Bowen 2 CAST Sabina Spielrein Keira Knightley Sigmund Freud Viggo Mortensen Carl Jung Michael Fassbender Otto Gross Vincent Cassel Emma Jung Sarah Gadon Professor Eugen Bleuler André M. -

A DANGEROUS METHOD a Sony Pictures Classics Presentation a Jeremy Thomas Production
MOVIE REVIEW Afr J Psychiatry 2012;15:363 A DANGEROUS METHOD A Sony Pictures Classics Presentation A Jeremy Thomas Production. Directed by David Cronenberg Film reviewed by Franco P. Visser As a clinician I always found psychoanalysis and considers the volumes of ethical rules and psychoanalytic theory to be boring, too intellectual regulations that govern our clinical practice. Jung and overly intense. Except for the occasional was a married man with children at the time. As if Freudian slip, transference encountered in therapy, this was not transgression enough, Jung also the odd dream analysis around the dinner table or became Spielrein’s advisor on her dissertation in discussing the taboos of adult sexuality I rarely her studies as a psychotherapist. After Jung’s venture out into the field of classic psychoanalysis. attempts to re-establish the boundaries of the I have come to realise that my stance towards doctor-patient relationship with Spielrein, she psychoanalysis mainly has to do with a lack of reacts negatively and contacts Freud, confessing knowledge and specialist training on my part in everything about her relationship with Jung to him. this area of psychology. I will also not deny that I Freud in turn uses the information that Spielrein find some of the aspects of Sigmund Freud’s provided in pressuring Jung into accepting his theory and methods highly intriguing and at times views and methods on the psychological a spark of curiosity makes me jump into the pool functioning of humans, and it is not long before the of psychoanalysis and psychoanalytic theory and two great minds part ways in addition to Spielrein ‘swim’ around a bit – mainly by means of reading or surfing the going her own way. -

Theoretical and Clinical Contributions of Sabina Spielrein
APAXXX10.1177/0003065115599989Adrienne HarrisTheoretical and Clinical Contributions of Sabina Spielrein 599989research-article2015 j a P a Adrienne Harris XX/X “LanguAGE IS THERE TO BEWILDER ITSELF AND OThers”: TheoreTICAL AND CLINICAL CONTRIBUTIONS OF SABINA SPIELREIN Keywords: psychoanalysis, Sabina Spielrein, Freud, Jung, language, Piaget, Vygotsky here are many ways to begin this story. On August 18, 1904, a T young Russian woman of nineteen is admitted to the Burghölzli Hospital. She is described as disturbed, hysterical, psychotic, volatile. She is Jung’s first patient and her transference to him was almost imme- diately passionate and highly erotized. After her release from the hospital that relationship is fatally compromised by Jung’s erotic involvement with her. Later she is caught up in the conflicts and breakdown of the relationship of Freud and Jung. We know this version of Sabina Spielrein’s entrance into the medical and psychoanalytic worlds of Europe from films and some early biogra- phies, from her letters and diaries written in the period 1906–1907,and even from her psychiatric records (Covington and Wharton 2003, pp. 79–108). Spielrein has been cast as a young madwoman, later involved Clinical Associate Professor of Psychology, NYU Postdoctoral Program in Psychotherapy and Psychoanalysis. A timeline to accompany this paper is available online at apa.sagepub.com. An earlier version of this paper was given as a plenary address at the Winter Meeting of the American Psychoanalytic Association, New York, January 2015. The author is indebted to many helpful readers: Ken Corbett, Steven Cooper, Donald Moss, Wendy Olesker, Bonnie Litowitz, and John Launer. -

Archetypes of Knowledge the Relevance of Jung’S Psychology of Scientific Discovery for Understanding Contemporary Technoscience
International Journal of Jungian Studies (2019) 1–21 brill.com/ijjs Archetypes of Knowledge The Relevance of Jung’s Psychology of Scientific Discovery for Understanding Contemporary Technoscience H.A.E. (Hub) Zwart Erasmus University Rotterdam [email protected] Abstract This paper substantiates why Jung’s psychology is still highly relevant for understand- ing science today. I explore how his methods and insights allow us to come to terms with the phenomenon of scientific discovery. After outlining core Jungian concepts and insights concerning science, I will focus on the relationship between alchemy and modern science. Also, I will highlight Jung’s understanding of scientific research as a practice of the self, directed at individuation (the integration of various aspects of the self into a coherent whole). Finally, I discuss the role of archetypes in the context of dis- covery of modern science. Whereas archetypal ideas may function as sources of insight and inspiration, the task for researchers is to come to terms with them, instead of being overwhelmed by them. Besides case studies discussed by Jung himself, I also present more recent examples, taken from molecular life sciences research and climate change research. Keywords Carl Gustav Jung – Jungian psychology of science – Jung and science – psychology of science – climate change – Anthropocene – archetypes – collective unconscious – indi- viduation – tertium non datur Carl Gustav Jung began his psychiatric career at the famous Burghölzli mental hospital near Zürich, where he conducted reaction time experiments to explore unconscious complexes. After his intense collaboration and subsequent break with Freud, he experienced a severe mental crisis, but recovered and continued his astonishing intellectual journey through the history of human inquiry, from © koninklijke brill nv, leiden, 2019 | doi:10.1163/19409060-01102005 2 10.1163/19409060-01102005 | zwart pre-historic times up to the present, focussing on alchemy as a practice of the self. -

Introduction to Psychology, Spring 2021 the Goal of This Course Is To
Introduction to Psychology, spring 2021 Mgr. Daniela Březnová, a psychologist, a candidate of IPA (International Psychoanalytic Association) working in a private practice The goal of this course is to experience and understand one’s internal world as well as the external world more creatively. We will study the development and functioning of the human mind and walk through the basic social psychology theories. 1. The conscious and unconscious mind a. The truth and the capacity to be honest b. Reaching the unconsciousness – hypnosis, surrealism, fairytales, dreams, imagination, free association c. Active listening Reading: • Movies: A dangerous method, Life of Pi • Aaron H. Esman: Psychoanalysis and surrealism: Andre Breton and Sigmund Freud • C. Jung: The Concept of the Collective Unconscious 2. Development of the mind a. Separation – individuation process b. Attachment style c. Mental Health Reading: • Movie: Groundhog Day • M. Mahler: The Psychological Birth of the Human Infant • O. Kernberg: Love relations in heterosexual couples • Bowlby: Attachment style (tbd) 3. Social psychology introduction a. Social cognition b. Self-justification c. Conformity d. Social influence e. Groups Reading: • The Social Animal (2018, 12th edition). Elliot Aronson. Worth Publishers. • Social Psychology (5th Edition). Authors: Gilovich, Keltner, Chen & Nisbett Requirements 1. Classroom work – mostly discussion, self-experience 2. Final paper – Essay on a chosen politician from the psychology perspective, using the concepts we have learnt (brief biography + use at least 3 different theoretical points to describe the person, his/her actions, behavior, and relationships). Use a combination of their personal history and the environment. Instead of pathologizing them, focus on understanding of their thinking process and WHY they behave the way they do. -

“A Dangerous Method”: Freud, Jung, and Spielrein
“A Dangerous Method”: Freud, Jung, and Spielrein David Cronenberg’s new film “A Dangerous Method” begins in the opening years of the twentieth century with the delivery to the Burghölzli Clinic of the Zurich Hospital of a young woman named Sabina Spielrein (Keira Knightly) who, suffering from hysteria, becomes one of the early patients to undergo psychoanalysis. Spielrein, a wealthy, well-educated, and lovely young Russian Jewish woman—whose hysterical outbreaks express themselves in fits, tortuous postures, tormented speech, and bizarre behavior—comes under the care of Dr. Carl Jung (Michael Fassbender). Jung, himself a follower of the Viennese physician Sigmund Freud (Viggo Mortensen), decides to experiment with his mentor’s revolutionary new treatment called “the talking cure.” The doctors pursue the unheard of radical course of listening to the mad patient. Rather than simply locking them up and administering baths, physical therapy and a regimen of work, these innovative doctors take an interest in the patients, in their symptoms and their words, in their family life and their current situation. Sitting in a chair behind his hysterical subject, Jung asks her to talk about her illness and her life in an attempt to help himself and her to understand the source of her hysterical symptoms. The idea is that through the process of coming to understand the source of her neurosis and by reenacting the relationship that brought about her mental illness through a simulation of that relationship with her psychologist, the patient will become a normal, mature adult. It will prove a dangerous method, for in the experience of the transference and counter-transference of the psychoanalytic experience—in violation of all the rules of Freud’s psychoanalysis—Jung succumbs to temptation and sleeps with Spielrein. -

A DANGEROUS METHOD Private Showing and Conference Discussion
Confederation for Analytical Psychology presents A DANGEROUS METHOD Private showing and conference discussion of David Cronenberg's film about Spielrein, Jung and Freud (This conference is offered as the fourth Andrew Samuels Lecture. Andrew was the founder chair of CAP which is an organisational member of the United Kingdom Council for Psychotherapy) Saturday 11th February 2012 10 am – 5 pm (9.30 am registration) Venue: Arundel House, 13-15 Arundel Street Temple Place, London WC2R 3DX (opposite Temple Underground) Cost (including lunch): £75; CAP members: £65; (limited number of £45 concessions) Booking form below EARLY BOOKING IS ADVISED AS SPACE STRICTLY LIMITED! People with an interest in film, the history of psychoanalysis, practitioners and academics from psychotherapy, counselling and analysis are invited to this event. To view a clip of the film, see http://www.imdb.com/video/imdb/vi3849821209/ The screening of A Dangerous Method will be followed by panel discussions and plenary. David Cronenberg’s compelling movie about the triangular relationship between Sabina Spielrein, C.G. Jung and Sigmund Freud opens a Pandora’s box of issues in depth psychology concerning the relations between women and men, women and women, men and men, and patients and analysts. The film is set in the early days of the psychoanalytic movement - the first faltering steps in a new approach to subjectivity and psychological healing, but already involving the end of the collaboration between Freud and Jung. The central theme of the film is Jung's complex relationship with his patient Sabina Spielrein - one which raises awkward and fascinating questions for Jungian and non-Jungian clinicians and academics alike. -
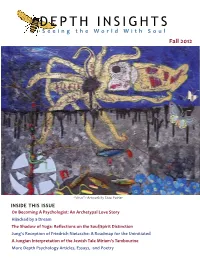
Depth Insights -- Depth Psychology and Jungian Scholarly E-Zine
DEPTH INSIGHTS Seeing the World With Soul Fall 2012 “Virus”~ Artwork by Staci Poirier INSIDE THIS ISSUE On Becoming A Psychologist: An Archetypal Love Story Hijacked by a Dream The Shadow of Yoga: Reflections on the Soul/Spirit Distinction Jung’s Reception of Friedrich Nietzsche: A Roadmap for the Uninitiated A Jungian Interpretation of the Jewish Tale Miriam’s Tambourine More Depth Psychology Articles, Essays, and Poetry Table of From the Executive Editor Contents There’s a lot going on on the planet surface of everyday events. Paying atten- On Becoming A Psychologist: today, much of it disturbing if you follow tion to how the inner world mirrors the 3 An Archetypal Love Story By Robert D. Romanyshyn the evening news. With so much technol- outer—and vice versa—is such a powerful ogy around us providing instantaneous tool for insight and growth, both personal- 9 Hijacked by a Dream access to information and events around ly and collectively. By Paco Mitchell the world, it’s easy sometimes to feel It is in this spirit of opening to what The Shadow of Yoga: overwhelmed and lose a sense of center is hidden, forgotten, lost, abandoned or 13 Reflections on the Soul/Spirit and self. invisible in the self--even as we reel from Distinction According to recent conversations disquieting events in the outer world--that By Jason Butler I’ve had with others, I don’t think I’m the I hope you will enjoy the wisdom and only one who feels that time is speeding beauty of the works offered in this issue Jung’s Reception of Friedrich 17 Nietzsche: A Roadmap for the up and globally, things are spiraling out of of Depth Insights. -

A Dangerous Method : the Story of Jung, Freud and Sabina Spielrein Pdf, Epub, Ebook
A DANGEROUS METHOD : THE STORY OF JUNG, FREUD AND SABINA SPIELREIN PDF, EPUB, EBOOK John Kerr | 624 pages | 01 Jan 2012 | ATLANTIC BOOKS | 9780857891785 | English | London, United Kingdom A Dangerous Method : The Story of Jung, Freud and Sabina Spielrein PDF Book Spielrein, one of the first women psychoanalysts, was Jung's patient, student, and lover; later, she was Freud's colleague in Vienna. Yes, Jung was an intellectual himself, and an aristocratic Swiss Protestant too his wealthy lifestyle thanks to his wife. If you ware interested in the history of our understanding of the human mind or women in academia and science then I recommend this book, but with the caveat that you will have to put up with unjustified pretensions and blunders. Show 0 comments. Reudite and elegant. Painful humiliation is her aphrodisiac, and she despises herself for this. To ask other readers questions about A Most Dangerous Method , please sign up. The good news is it make me feel more normal or less crazy! This book will fascinate anyone interested in the personal biographies of Freud or Jung, most particularly in reference to their breakup. The author Kerr must have had walls covered in post-it notes as he trails detective like three people through the changes of psychiatry into psychoanalysis during the early s. That is the prevailing view of contemporary experts. It is astonishing how petty and childish these larger-than-life custodians of our psychic health could be with one another. Seasonal depression is not a black -and-white…. In place of individual tragedy, Mr. -

Postgradmedj-2011-130489 14
On reflection Postgrad Med J: first published as 10.1136/bjo.2008.150151corr1 on 2 November 2011. Downloaded from month, the director David Cronenberg is Yet by a coincidencedIhavenoreason 2. Kerr J. A Most Dangerous Method: The story of releasing a movie about her, with the title to believe it is anything elsedthe movie Jung, Freud, and Sabina Spielrein. New York: Alfred ‘ ’ 15 Knopf, 1993. A dangerous method . Cronenberg is will be coming out exactly a century after 3. Carotenuto A. A Secret Symmetry: Sabina Spielrein best known for his horror and science Sabina Spielrein presented her lecture to between Freud and Jung. New York: Pantheon, 1982. fiction movies, which have earned him the Vienna Psychoanalytic Society on 4. McGuire W. The Freud/Jung Letters. Princeton: nicknames like the Baron of Blood and ‘Destruction as the cause of coming into Princeton University Press, 1974. the King of Venereal Horror. This movie, being’. It was on 29 November 1911 5. Covington C, Wharton B, eds. Sabina Spielrein, Forgotten Pioneer of Psychoanalysis. London: however, appears to be in a more that she stood before Freud, put Brunner-Routledge, 2003. measured genre. The script has been forward her argument about the biological 6. Van Waning A. The works of pioneering adapted from a play by Christopher basis of all the struggles we face as psychoanalyst Sabina Spielrein. Int Rev Psychoanal e Hampton, which in turn drew on her human beings, and summed these up in 1992;19:399 413. ‘ ’ 7. Ovcharenko V. Love, psychoanalysis and biography by John Kerr. The heroine in the the simple formula sex versus survival .It destruction. -
A Feiler, Attila Hörbiger, Oskar Sima, Fritz Rasp, 94‘ | 35 Mm
ZKOL TITEL APRIL und MAI 2013 Wagner-Kino Berlin.Dokument Der Aufstand im Warschauer Ghetto Hommage an Max und Emil Skladanowsky Umbrüche: Film als zeitgenössischer Akteur Kleine Werkschau zu Gerhard Lamprecht Unter Vorbehalt EL T KOLTI fa 1 Z »LEBENDE BILDER« AUS BERLIN Am 30. April, dem 150. Geburtstag von Max Skladanowsky ehrt das Zeug- hauskino die beiden Berliner Pioniere der Film- und Kinogeschichte. Auf dem Spielplan stehen alle überlieferten Filme der Gebrüder Max und Emil Skladanowsky in den derzeit besten Kopien. Die Filmhistoriker Ralf Forster und Jeanpaul Goergen sowie der Leiter der Filmrestaurierung im Bundesar- chiv-Filmarchiv Egbert Koppe werden in die Filme einführen, ihre Arbeit an den Kopien vorstellen und die filmhistorische Bedeutung der Gebrüder Skla- danowsky erläutern. Und selbstverständlich werden die Stummfilme musi- kalisch begleitet: Am Flügel greift Peter Gotthardt in die Tasten und sorgt für ein unterhaltsames Kinoerlebnis. Neben der Hommage an Max und Emil Skladanowsky lädt im April eine Werkschau zur Auseinandersetzung mit einem weiteren wichtigen Berliner Filmschaffenden ein. Der 1897 geborene und 1974 verstorbene Regisseur Gerhard Lamprecht war ein leidenschaftlicher Sammler von Filmen, Geräten und Dokumenten. Aus seiner Privatsammlung entstand 1963 die Deutsche Kinemathek, die in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden ist. Die Deutsche Kinemathek und das Zeughauskino nehmen das Jubiläum zum Anlass für eine kleine Werkschau, die kaum bekannte Dokumentarfilme Lamprechts aus den 1920er Jahren mit Filmen vor allem aus der Zeit von 1933 bis 1945 zusammenbringt. Besonders nachdrücklich prägt eine facettenreiche Filmreihe aus Anlass des 200. Geburtstags von Richard Wagner den aktuellen Spielplan. Die Retros- pektive WAGNER-KINO stellt die vielfältige Wagner-Rezeption im Medium Film vor, angefangen bei frühen biografischen Filmen über filmmusikalische Exkursionen und Dokumentationen bis hin zu experimentellen Formen, die mit Wagner-Motiven arbeiten. -

DL3 a Less Dangerous Method
WELCOME TO DREAM LAB DREAM LETTERS IN THIS EDITION ~ HISTORY vs. HOLLYWOOD ~ UNDERSTANDING YOUR DREAM SYMBOLS ~ DREAM INSIGHT IN FIVE MINUTES #3 ~ A WEEKEND OF DREAM DISCOVERY April ‘12 z A (Less) Dangerous Method z Separating History & Hollywood Jung & Spielrein: Sex Heals vs. Sex Sells Jung did have an afair with his patient, Sabina Spielrein, Dear Dreamers, and he did lie to Freud about What a powerful Dream Circle it. It’s also true that Jung we had last Thursday night. traced Spielrein’s symptoms The theme was “What can to sexual fixation on being dreams tell us about who we beaten by her father. There is, however, no evidence that are becoming?” We discussed A Dangerous Method is a Jung spanked Spielrein for Tibetan Dream Yoga, Mayan gripping historical film sexual pleasure, or that he Shamanic insight, and mixing sex and considered this part of her participants shared their psychoanalysis, while “cure.” depicting the demise of the personal experiences. Thank most influential relationship Freud & Jung: you for an illuminating night! in psycho-history: the bond Death and Rebirth between Carl Jung and Next week I’m travelling to The film focuses on Jung’s Sigmund Freud. respect for, and Australia’s 1st Dreams & disagreements with, Freud’s Imagination: Healing The film shows Freud revolutionary contribution to Pathways Conference in protecting his “authority” by psychoanalysis. But that’s just not sharing a revealing Sydney. There will be four the beginning of Jung’s story. dream, but omits the crucial days of morning-to-night In reality, the friendship importance of dreams in between Freud and Jung dream exploration, Freud & Jung’s discoveries.