Spitzensportkonzept “Challenge 2016”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Men's All-Time World Performers-Performances Rankings
Men’s All-Time World Performers-Performances Rankings Page 1 of 127 50 METER BACKSTROKE Top 2660 Performances 24.04** Liam Tancock, GBR 13th World Championships Rome 08-02-09 (Reaction Time: +0.60. (Note: Great Britain’s first male backstroke gold-medalist [50, 100, 200]. Tancock’s first international gold/second world- record. (Note: bronze medalist [2005, Montreal; ’07, Melbourne]) 24.07*# Camille Lacourt, FRA XXX European Championships Budapest 08-12-10 (Reaction Time: +0.74. (Nore: also clocked European-record/history’second-fastest 100 back en route to gold several days earlieir [52.11]) 24.08sf1 Tancock 13th World Championships Rome 08-01-09 (Reaction Time: +0.57) 24.23 Lacourt 16th World Championships Kazan 08-09-15 (Reaction Time: +0.68, gold medalist) 24.24a Junya Koga, JPN 13th World Championships Rome 08-02-09 (Reaction Time: +0.50. (Note: won 100 back gold in an Asian-record 52.26 clocking several days earlier.) 24.27sf2 Lacourt 16th World Championships Kazan 08-08-15 (Reaction Time: +0.69) 24.28 Koga 17th Asian Games Incheon 09-21-14 (Reaction Time: +0.52 [fastest of race]. (Note: Games record, Koga’s third-consecutive gold/record. Won @ Doha in 2K6 [25.40]; Guangzhou, 2K10 [25.08]) 24.29sf2 Koga 13th World Championships Rome 08-01-09 (Reaction Time: +0.48) 24.30sf1 Lacourt XXX European Championships Budapest 08-11-10 (Reaction Time: +0.71) 24.33* Randall Bal, USA/Stanford Eindhoven Swim Cup Eindhoven 12-05-08 (Reaction Time: +0.66) 24.34* Gerhard Zandberg, RSA/Arizona 13th World Championshps Rome 08-02-09 (Note: African record.) 24.36 Lacourt FRA Nationals/WCTs Strasbouug 03-27-11 (Note: French Open-“All Comers” record.) 24.37 Lacourt FRA Nats./Euro. -

EUROPEAN SHORT COURSE Swimming Championships Finalists
EUROPEAN SHORT COURSE Swimming Championships Finalists 20191 Some of the stars of the European Short Course Championships in Copenhagen- top row, left Kirill Prigoda (Russia), centre, Adam Peaty (Great Britain), right, Ruta Meilutyte (Lithuania); middle row, left, Radoslaw Kawecki (Poland), centre, Maxence Orange (France), right, Fanny Lecluyse (Belgium); bottom, left, Andri Govorov (Ukraine), centre, Sarah Koehler (Germany) and Julia Hassler (Liechtenstein), right, Matteo Rivolta (Italy) (Photos: Giorgio Scala & Andrea Staccioli, Deepbluemedia/Insidefoto) 2 European Short Course Swimming Championships Finalists Contents European Sprint Results - Men 4 European Sprint Results - Women 7 European Short Course Championship Venues 10 Short Course Results - Men 11 Short Course Results - Women 88 Short Course Results - Mixed 164 European Sprint Championships Medals Tables - by country 167 European Sprint Championships Medals Tables - by event 169 European Short Course Medals Tables - by country 172 European Short Course Medals Tables - by event 178 European Short Course Leading Medallists - all time 191 Please note that, unless stated otherwise, the photos in this book were taken at the 2017 European Short Course Championships in Copenhagen 3 European Sprints Results 1991 to 1994 This book is in two sections. The first The first European Sprints were held section deals with the European Sprint between December 6th and 8th 1991 at Championships held between 1991 and Gelsenkirchen, Germany when the city 1994; the second, with the European agreed to organise the event with only Short Course Championships from 1996 to four months notice. The first European the present time. The tables of individual Short Course Championships in Rostock medals and event medal tables at the end in 1996 saw a significant expansion with of this publication, therefore, treats them some 36 events. -
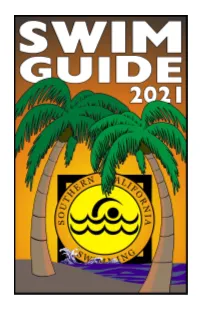
Scs-Swim-Guide.Pdf (Socalswim.Org
SOUTHERN CALIFORNIA SWIMMING, INC. (CA) CA is a Local Swimming Committee of USA SWIMMING, INC 2021 Swim Guide Published by the House of Delegates of Southern California Swimming Terry Stoddard, General Chairman SWIM OFFICE 28000 S. Western Ave., #226 San Pedro, CA 90732 -or- Postal Annex – Rancho Palos Verdes Attn: Southern California Swimming 28625 S. Western Ave., Box #182 Rancho Palos Verdes, CA 90275 (310) 684-1151 Monday - Friday, 8:30 a.m. - 4 p.m. Visit Southern California Swimming (CA) on the internet at https://www.socalswim.org Email: [email protected] NOTE: Updates to the 2021 Swim Guide will be available during the calendar year online at socalswim.org 1 Greetings, and Welcome to Southern California Swimming (CA)! CA is one of 59 Local Swimming Committees (LSCs) within USA Swimming. USA Swimming is one of the National Governing Bodies (NGBs) under the United States Olympic Committee (USOC) and the USOC is part of the Federation Internationale de Natation (FINA). FINA is the swimming organization within the International Olympic Committee (IOC)….the group that organizes the Olympics. So, your club is the grassroots level of membership for swimming that goes all the way up to the Olympics! From San Luis Obispo down to San Clemente and over to Las Vegas, we have about 25,000 athletes, coaches, officials and parent volunteers in our membership. Because our LSC is so large--the largest membership in the country--we have 6 Geographic sub- Committees: Coastal, Desert, Eastern, Metro, Pacific and Orange to help with administration and local competitions. CA oversees registration for all our clubs and individual members, swim meet sanctions—roughly 400 swim meets per year are sanctioned/approved by CA, multiple camps and all-star teams, as well as educational programs for everyone. -

Men's All-Time Top 50 World Performers-Performances
Men’s All-Time World Top 50 Performers-Performances’ Rankings Page 111 ο f 727272 MEN’S ALL-TIME TOP 50 WORLD PERFORMERS-PERFORMANCES RANKINGS ** World Record # 2nd-Performance All-Time +* European Record *+ Commonwealth Record *" Latin-South American Record ' U.S. Open Record * National Record r Relay Leadoff Split p Preliminary Time + Olympic Record ^ World Championship Record a Asian Record h Hand time A Altitude-aided 50 METER FREESTYLE Top 51 Performances 20.91** Cesar Augusto Filho Cielo, BRA/Auburn BRA Nationals Sao Paulo 12-18-09 (Reaction Time: +0-66. (Note: first South American swimmer to set 50 free world-record. Fifth man to hold 50-100 meter freestyle world records simultaneously: Others: Matt Biondi [USA], Alexander Popov [RUS], Alain Bernard [FRA], Eamon Sullivan [AUS]. (Note: first time world-record broken in South America. First world-record swum in South America since countryman Da Silva went 26.89p @ the Trofeu Maria Lenk meet in Rio on May 8, 2009. First Brazilian world record-setter in South America: Ricardo Prado, who won 400 IM @ 1982 World Championships in Guayaquil.) 20.94+*# Fred Bousquet, FRA/Auburn FRA Nationals/WCTs Montpellier 04-26-09 (Reaction Time: +0.74. (Note: first world-record of career, first man sub 21.0, first Auburn male world record-setter since America’s Rowdy Gaines [49.36, 100 meter freestyle, Austin, 04/81. Gaines broke his own 200 free wr following summer @ U.S. WCTs.) (Note: Bousquet also first man under 19.0 for 50 yard freestyle [18.74, NCAAs, 2005, Minneapolis]) 21.02p Cielo BRA Nationals Sao Paulo 12-18-09 21.08 Cielo World Championships Rome 08-02-09 (Reaction Time: +0.68. -

6-12-2020 Event 5 Men, 50M Freestyle Senioren Open 3-12-2020
Rotterdam Qualification Meet Rotterdam, 3- - 6-12-2020 Event 5 Men, 50m Freestyle Senioren Open 3-12-2020 - 10:27 Results Prelim Points: FINA 2020 rang naam vereniging tijd RT fin. FINA para Senioren Open 1. Thom de Boer De Dolfijn 199100181 21.74 +0,63 A 889 Nederlands Record Senioren 2. Meiron Amir Cheruti Israel Swimming Association 22.11 +0,57 A 845 3. Stan Pijnenburg HPC - PSV 199600427 22.16 +0,62 A 840 4. Jesse Puts HPC - De Dolfijn 199401147 22.18 +0,59 A 837 5. Nyls Korstanje KNZB 199901941 22.22 +0,64 A 833 6. Kenzo Simons HPC - De Dolfijn 200105415 22.28 +0,62 A 826 7. Andriy Govorov Ukraine 22.56 +0,61 A 796 8. Heiko Gigler Austrian Swimming Federation 22.68 +0,63 A 783 9. Kyle Stolk HPC - PSV 199605231 22.71 +0,64 B 780 10. Marcus J Schlesinger Israel Swimming Association 22.87 +0,58 B 764 11. Sebastien De Meulemeester Belgium OZEKA/11007/98 22.98 +0,62 B 753 12. Jasper Aerents Belgium BZK/10545/92 23.04 +0,62 B 747 13. Alexandre Marcourt Belgium 23.08 +0,65 B 743 14. Denis Loktev Israel Swimming Association 23.09 +0,62 B 742 15. Thomas Verhoeven Albion 199700311 23.10 +0,69 B 741 16. Nils Liess Swiss Swimming Federation 760 23.11 +0,69 ? 740 Jeroen Baars Blue Marlins (SG) 199200031 23.11 +0,72 ? 740 18. Louis Croenen Belgium SHARK/10133/94 23.16 +0,68 C 735 19. Thomas Thijs Belgium ZGEEL/10061/97 23.25 +0,54 C 727 20. -

Natalie Coughlin’S Success in the January 2014 - Volume 55 - No
MIXING UP YOUR TRAINING A YEAR IN REVIEW: 2013’s TOP SWIMMING STORIES A LOOK +INTO 2014 THE GLORY OF FOOD NATALIE COUGHLIN’S SUCCESS IN THE JANUARY 2014 - VOLUME 55 - NO. 01 KITCHEN $3.95 PHELPS CLEARS SURVIVE & FIRST HURDLE THRIVE: IN COMEBACK CRAIG DIETZ LEARN MORE AT SWIMMINGWORLD.COM AMERICA’S GOLDEN GIRL: CoughlinNatalie SPECIAL NEW YEAR OFFER: CHECK OUT PAGE 65 FOR SWIMMING WORLD’S NEW YEAR SPECIAL! JANUARY.indd 1 12/22/13 5:34 PM JANUARY.indd 2 12/22/13 5:34 PM JANUARY.indd 3 12/22/13 5:35 PM JANUARY.indd 4 12/22/13 5:35 PM JANUARY.indd 5 12/22/13 5:35 PM 029 Food, Glorious Food! by Natalie Coughlin Natalie Coughlin taught herself how 2014 to cook when she was in college...and JAN she absolutely loves it! 031 Take Home Points by Dr. G. John Mullen In a partnership with Swimming World 020 U Magazine, Swimming Science provides “Take Home Points” from in-depth 045 Q&A with Coach swimming research. Jason Turcotte ARY by Michael J. Stott FEATURES 032 Yoga for Swimmers by Steve Krojniewski 047 How They Train Gunnar 010 Swimming Stories of 2013 Yoga can help swimmers strengthen Bentz and Kylie Stewart 010 by Jason Marsteller their core, stretch the pectorals, open by Michael J. Stott the shoulders and add focus for peak 014 Lessons with the Legends: performance. 048 Survive and Thrive: Dick Hannula Finding A Way by Michael J. Stott 034 Goldminds: Swim to Win! by Shoshanna Rutemiller by Wayne Goldsmith Despite not having any arms or legs, 016 Strategic Pacing in Commitment—the decision to turn 39-year-old Craig Dietz is using his Distance Events (Part II) thoughts into actions—is the key to success in open water swimming to by Michael J. -

Helsinki 2010
Page: 1 Date: 18 July 2010 Time: 19:18:32 Results Total - With Points and lap times Competition name: European Junior Swimming Champ Competition place: Helsinki, Finland Organizer: LEN Referee: Chief Recorder: Event 1, 50m Breaststroke Women, Finals CR: Yuliya EFIMOVA 31.45 2007-07-18 Place Name Born Point FINA Finish Status Club 1 Lisa Fissneider 1994 898 32.20 Italy 2 Lina Rathsack 1994 883 32.37 Germany 3 Sara L Lougher 1994 874 32.48 Great Britain 4 Ana Pinho Rodrigues 1994 873 32.50 Portugal 5 Jenna Laukkanen 1995 872 32.51 Finland 6 Tjasa Vozel 1994 863 32.62 Slovenia 7 Veera Kivirinta 1995 860 32.66 Finland 8 Josephina Bartela 1994 850 32.79 Denmark 9 Laura Simon 1994 816 33.24 Germany 10 Kinga Cichowska 1994 795 33.53 Poland Event 1, 50m Breaststroke Women, Semifinals CR: Yuliya EFIMOVA 31.45 2007-07-18 Place Name Born Point FINA Finish Status Club 1 Lisa Fissneider 1994 891 32.28 Italy 2 Sara L Lougher 1994 876 32.46 Great Britain 3 Ana Pinho Rodrigues 1994 874 32.49 Portugal 4 Tjasa Vozel 1994 860 32.66 Slovenia 5 Jenna Laukkanen 1995 859 32.68 Finland 6 Veera Kivirinta 1995 852 32.76 Finland 7 Lina Rathsack 1994 849 32.80 Germany 8 Josephina Bartela 1994 848 32.82 Denmark 9 Laura Simon 1994 832 33.03 Germany 10 Kinga Cichowska 1994 811 33.30 Poland 11 Tina Meza 1994 801 33.45 Slovenia 12 Elizaveta Bazarova 1995 798 33.49 Russia 13 Fanny Deberghes 1994 786 33.66 France 14 Sofya Zhigunova 1995 773 33.84 Russia 15 Claire Polit 1995 771 33.88 France 16 Ana Radic 1994 770 33.89 Croatia 17 Malin Westman 1995 758 34.07 Sweden 18 Lina -

China's Swimming Icon?
SOLVE THE PERFORMANCE PUZZLE N TIPS ON TECHNIQUE N GO HARD CORE! APRIL 2012 —VOLUME 53 NO. 4 CHINA’S SWIMMING ICON? pagepage 1616 A MASTERS’ TOUCH — page 18 — “The daily news of swimming” Check us out online at: www.SwimmingWorldMagazine.com $3.95 USA • $4.50 CAN How They Train Wyatt Ubellacker Lane 9/Gutter Talk JANET EVANS MAKES 2012 U.S. OLYMPIC TRIALS LANCE ARMSTRONG COMPETES IN MASTERS MEET JAPAN’S RYOSUKE IRIE IMPRESSIVE IN AUSTRALIA KARLYN PIPES-NEILSEN RETURNS TO MASTERS SWIMMING PASSAGES: ARTHUR FRANCIS “REDS” HUCHT PASSAGES: JESSICA JOY REES PASSAGES: KELLEY LEMON PASSAGES: JOHN MACIONIS For the Record USA SWIMMING GRAND PRIX Columbia, Missouri ALABAMA HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS Auburn, Alabama COLORADO 4A HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS Thornton, Colorado COLORADO 5A HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS Fort Collins, Colorado CONNECTICUT HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS New Haven, Conn. EASTERN INTERSCHOLASTIC HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS Philadelphia, Pennsylvania GEORGIA 1A-4A HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS Atlanta, Georgia GEORGIA 5A HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS Atlanta, Georgia ILLINOIS HIGH SCHOOL BOYS CHAMPIONSHIPS Evanston, Illinois IOWA HIGH SCHOOL BOYS CHAMPIONSHIPS Marshalltown, Iowa LOUISIANA DIVISION I HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS Sulphur, Louisiana LOUISIANA DIVISION II HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS Sulphur, Louisiana LOUISIANA DIVISION III HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS Sulphur, Louisiana LOUISIANA DIVISION IV HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS Sulphur, Louisiana MASSACHUSETTS DIVISION I HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS Cambridge, Massachusetts MASSACHUSETTS DIVISION II HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS Cambridge, Massachusetts MICHIGAN DIVISION I HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS Ypsilanti, Michigan MICHIGAN DIVISION II HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS Holland, Michigan MICHIGAN DIVISION III HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS Rochester, Michigan NEW YORK HIGH SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIPS Buffalo, New York WASHINGTON, D.C. -

20 August 2014
DAILY NEWS 20 August 2014 EVENT OFFICIAL PARTNER EVENT SPONSOR / SUPPLIER DAILY NEWS 20 AUGUST 2014 det hat, steht Cagnotto in den Startlöchern, Philip Heintz, 23 Jahre, 200m Lagen WM 2013 ZWEIMAL GOLD UND EIN WELTREKORDLER ihren Titel von 2013 zu verteidigen. Nicht zu Platz 28 (200m L Finale: 18:00 Uhr) WELTREKORD FÜR GROSSBRITANNIEN BIEDERMANN AUF vergessen ist unter anderem Nadezda Bazhi- Tina Punzel, 19 Jahre, 1m-Brett Junioren-EM na (RUS), die am Montag im Team Event Gold 2010 Bronze (1m-Brett Finale: 14:00 Uhr) GOLDKURS gewann. Die Männer treten heute im belieb- ten Synchronspringen vom 10m-Turm an. In Großer Auftritt für Paul Biedermann (GER): der Favoritenrolle sind die Deutschen Patrick INTERNATIONAL STARS Nachdem er das Finale über 400m Freistil Hausding und Sascha Klein. Seit 2008 sind verpasst hatte, war der Frust groß. Das merkte Yannick Agnel (FRA), 22 years, 200m Free- man gestern im Halbfinale über 200m Freistil. style WC 2013 Gold (200m F final: 18:00 hrs) Er ließ nichts anbrennen und qualifizierte sich Rikke Moeller Pedersen (DEN), 25 years, souverän als Erster für das Finale am heutigen 100m Breaststroke EC 2010 Silver (100m B fi- Mittwoch. Mit deutschen Medaillenchancen nal: 18:00 hrs) geht es heute für Markus Deibler und Philip Laszlo Cseh (HUN), 28 years, 200m Individu- Heintz ins Finale über 200m Lagen. Der seit al Medley EC 2012 Gold (200m IM final: 18:00 Jahren ungeschlagene Ungar Laszlo Cseh hrs) wird sich den Platz ganz oben auf dem Podi- Femke Heemskerk (NED), 26 years, 100m um wohl nicht so einfach nehmen lassen. -

Len European Championships Aquatic Finalists
LEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS AQUATIC FINALISTS 1926-2016 2 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS GLASGOW 2ND-12TH AUGUST 2018 SWIMMING AT TOLLCROSS INTERNATIONAL SWIMMING CENTRE DIVING AT ROYAL COMMONWEALTH POOL, EDINBURGH ARTISTIC (SYNCHRONISED) SWIMMING AT SCOTSTOUN SPORTS CAMPUS, GLASGOW OPEN WATER SWIMMING IN LAKE LOMOND 2 Contents Event Page Event Page European Championship Venues 5 4x100m Freestyle Team- Mixed 123 4x100m Medley Team – Mixed 123 50m Freestyle – Men 7 100m Freestyle – Men 9 Open Water Swimming – Medals Table 124 200m Freestyle – Men 13 400m Freestyle – Men 16 5km Open Water Swimming – Men 125 800m Freestyle – Men 20 10km Open Water Swimming – Men 126 1500m Freestyle – Men 21 25km Open Water Swimming – Men 127 50m Backstroke – Men 25 5km Open Water Swimming – Women 129 100m Backstroke – Men 26 10km Open Water Swimming – Women 132 200m Backstroke – Men 30 25km Open Water Swimming – Women 133 50m Breaststroke – Men 34 Open Water Swimming – Team 5km Race 136 100m Breaststroke – Men 35 200m Breaststroke – Men 38 Diving – Medals Table 137 50m Butterfly – Men 43 1m Springboard – Men 138 100m Butterfly – Men 44 3m Springboard – Men 140 200m Butterfly – Men 47 3m Springboard Synchro - Men 143 10m Platform – Men 145 200m Individual Medley – Men 50 10m Platform Synchro – Men 148 400m Individual Medley – Men 54 1m Springboard – Women 150 4x100m Freestyle Team – Men 58 3m Springboard – Women 152 4x200m Freestyle Team – Men 61 3m Springboard Synchro – Women 155 4x100m Medley Team – Men 65 10m Platform – Women 158 10m Platform Synchro – Women 161 -

Tripletta ITA 100 Rana Uomini. Recap Written by Redazione | 27 Gennaio 2020
22° Euro Meet – Tripletta ITA 100 rana uomini. Recap written by Redazione | 27 Gennaio 2020 Cala il sipario sulla 22esima edizione dell’Euro Meet 2020, manifestazione in vasca lunga organizzata dalla Federnuoto del Lussemburgo (FSLN) valida come prima tappa del circuito Len Swimming Cup, segue il link alla pagina dei risultati in real time. Anche nella terza giornata di gare la migliore prestazione tecnica è stata realizzata dalla svedese Sarah Sjoestrom nei 100 stile libero (53.02). La rappresentativa azzurra con Ceccon, Martinenghi, Bianchi e Di Pietro ha vinto la staffetta 4×100 mista mixed. Gli azzurri sul podio nella terza giornata 400 SL – 2) Romei Giorgia 4.12.00 100 RA U – 1) Martinenghi Nicolò 59.96 100 RA U – 2) Poggio Federico 1.00.62 100 RA U – 3) Scozzoli Fabio 1.00.82 200 DO U – 2) Ciccarese Christopher 1.59.42 100 SL U – 2) Ceccon Thomas 48.98 4×100 MX mixed – 1) Fed. ITALIA 3.49.79 GIORNO 2 – La migliore prestazione femminile della seconda giornata è stata nuovamente nuotata dalla svedese Sarah Sjoestrom nei 50 stile libero (24.14), seconda l’azzurra Silvia Di Pietro (25.33), per il settore maschile il migliore è stato lo sprinter francese Florent Manaoudou che ha nuotato i 50 stile libero in 21.56 davanti al brasiliano Bruno Fratus (21.77). In chiusura di giornata la formazione italiana ha vinto la staffetta 4×100 stile libero mixed con Ivano Vendrame (50.46), Manuel Frigo (49.07), Silvia Di Pietro 55.87 e Ilaria Bianchi (57.17). Gli azzurri sul podio nella seconda giornata 50 RA – 1) Martinenghi Nicolò 27.18 50 RA – 2) Scozzoli Fabio 27.33 1500 SL – 1) Salin Giulia 16.35.81 50 SL – 2) Di Pietro Silvia 25.33 4×100 sl mixed – 1) Italia 3.32.52 GIORNO 1 – La migliore prestazione femminile della giornata è stata nuotata dalla svedese Sarah Sjoestrom nei 50 farfalla (25.12), per il settore maschile il migliore è stato l’ucraino Mykhaylo Romanchuk che ha nuotato i 1500 stile libero in 14.53.58. -
Men's All-Time World Performers-Performances
MEN’S ALL-TIME WORLD PERFORMERS-PERFORMANCES RANKINGS ** World Record # 2nd-Performance All-Time +* European Record *+ Commonwealth Record *" Latin-South American Record ' U.S. Open Record * National Record r Relay Leadoff Split p Preliminary Time + Olympic Record ^ World Championships Record a Asian Record h Hand time A Altitude Adjusted 50 METER FREESTYLE Top 5928 Performances 20.91** Cesar Augusto Filho Cielo, BRA/Auburn BRA Nationals Sao Paulo 12-18-09 (Reaction Time: +0-66. (Note: first South American swimmer to set 50 free world-record. Fifth man to hold 50-100 meter freestyle world records simultaneously: Others: Matt Biondi [USA], Alexander Popov [RUS], Alain Bernard [FRA], Eamon Sullivan [AUS]. (Note: first time world-record broken in South America. First world-record swum in South America since countryman Da Silva went 26.89p @ the Trofeu Maria Lenk meet in Rio on May 8, 2009. First Brazilian world record-setter in South America: Ricardo Prado, who won 400 IM @ 1982 World Championships in Guayaquil.) 20.94+*# Fred Bousquet, FRA/Auburn FRA Nationals/WCTs Montpellier 04-26-09 (Reaction Time: +0.74. (Note: first world-record of career, first man sub 21.0, first Auburn male world record-setter since America’s Rowdy Gaines [49.36, 100 meter freestyle, Austin, 04/81. Gaines broke his own 200 free wr following summer @ U.S. WCTs.) (Note: Bousquet also first man under 19.0 for 50 yard freestyle [18.74, NCAAs, 2005, Minneapolis]) 21.02p Cielo BRA Nationals Sao Paulo 12-18-09 21.08 Cielo 13th World Championships Rome 08-02-09 (Note: first man to win Olympic/World Championships 50 frees in consecutive years since USA’s Anthony Ervin did it @ Sydney [Olympics, 2000] and Fukuoka [2001].