Die Kunst, Blauen Dunst Zu Vermarkten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PL 43 Coût Des Soins De Santé Et Des Dommages- Intérêts Liés Au Tabac
CAS – 001M C.P. – P.L. 43 Coût des soins de santé et des dommages- intérêts liés au tabac Le 9 juin 2009 Monsieur Geoffrey Kelley Président Commission des affaires sociales Assemblée nationale Québec (Québec) G1A 1A3 Objet : Le projet de loi 43 : Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac Monsieur le président, Au nom de l’Association pour les droits des non-fumeurs, je vous remercie beaucoup de l’occasion que vous nous offrez de témoigner devant vous sur le projet de loi 43 : la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac. Je vous félicite pour la décision de vous joindre aux autres provinces et territoires au Canada et d’entreprendre des démarches afin de tenir responsable les principaux fabricants de tabac au pays, non seulement pour avoir manqué à leur obligation d’informer le public sur la nocivité de leurs produits, mais surtout pour avoir mis en œuvre une vaste conspiration visant à jeter le doute au sein des législateurs et du public sur les véritables dangers de l’usage du tabac. À notre avis, cette initiative ne vise pas à savoir si les fabricants de tabac ont commis ou non une telle fraude mais plutôt de connaître l’ampleur de celle-ci. Il suffit simplement de jeter un coup d’œil aux documents publiés à ce jour par différentes instances juridiques pour comprendre que la communauté de la santé, dont nous faisons partie, n’exagère en rien lorsqu’elle qualifie d’odieux le comportement de l’industrie du tabac au Canada. -

1 Rylander Affair Professor Ragnar Rylander Was a Member of The
Rylander Affair Professor Ragnar Rylander was a member of the faculty at the University of Geneva who did extensive research funded by the tobacco industry. After litigation Rylander lost against two tobacco control advocates (for defamation), the University conducted the equivalent of a UC Privilege and Tenure Hearing. The report was made public. In contrast the to unwillingness of UCORP and others at UC, the Committee viewed the issues in the broader context. As a result of this recommendation, the President of the University of Geneva announced that the university would not longer accept money from the tobacco industry. Here is an announcement of the decision and some associated links: Geneva, Friday October 29, 2004 16h00 local time The University of Geneva just made public a few hours ago its report on the "Affaire Rylander". Here are two excerpts of the summary (translation by PAD), which set the tone of the whole report. "The scientific community and the public must know that Ragnar Rylander's studies on the effects of environmental tobacco smoke on health are marred with serious suspicion, because the author has not revealed his conflicts of interest which were susceptible of influencing the significance of these studies and because he cannot be considered as an independent scientist, considering his role as secret employee of the tobacco industry. The Fact Finding Commission proposes that the following journals be notified of this situation: - European Journal of Public Health; - Archives of Environmental Health; -International Journal of Epidemiology" "Prof. Rylander's multiple breaches of scientific integrity take their full significance only when placed in the framework of the strategy conceived and carried out by the tobacco industry to throw doubt on the toxicity of tobacco smoke, particularly for the non-smokers. -

Motor Vehicle Air Pollution
wHotPEPt92.4 Distr:Limited Original:English Motor Vehicle Air Pollution Public Health Impact and Control Measures Editedby David Mage and Olivier Zali Division of EnvironmentalHealth EcotoxicologyService World HealthOrganization Departmentof PublicHealth Geneva,Switzedand Republicand Cantonof Geneva Geneva,Switzerland @ World HealthOrganization and ECOTOX ,lgg2 This documentis not issuedto the generalpublic, and all rights are reservedby the World HealthOrganization (WHO) andthe Serviceof Ecotoxicology (ECOTOX)of the Departmentof PublicHealth, Geneva. The documentmay be reviewed,abstracted, quoted, reproduced or translated,in part or in whole, with the prior written permissionof WHO or ECOTOX. Partsof this documentmay be storedin a retrievalsystem or transmittedin any form or by any means- electronic,mechanical or other- with the prior written permissionof WHO or ECOTOX. The views expressedin the documentby namedauthors are solelythe responsibilityof thoseauthors. The geographicaldesignations employed and the presentationof materialin this documentdo not imply the expressionof any opinionwhatsoever on the part of WHO concerningthe legal statusof any country,territory, city or areaof its authorities,or concerningthe delimitationof its frontiersor boundaries. Credits:cover photograph of Genevaby E.J. Aldag @.J. Press),Geneva; cover photographof Mexico City by ASL, Lausanne;stamp design, copyright Sweden PostStamps. MOTOR VEHICLE AIR POLLUTION PTJBLICHEALTII IMPACT AND CONTROLMEASURES Contents Page Foreword- Wilfried Kreiseland Guy-OlivierSegond v Executivesummary vii 1.Introduction.... 1 2. Review of the health effectsof motor vehicle traffic . 13 - Part I. Epidemiologicalstudies of the healtheffects of air pollutiondue to motorvehicles - IsabelleRomieu 13 - Part II. Effectson humansof environmentalnoise particutarly from road traffic - RagnarRylander 63 3. Humanexposure to motor vehicleair pollutants- PeterG. Flachsbart 85 4. Reviewof motor vehicleemission control mqNures andtheir effectiveness- Michael P. Walsh 115 5. -

Advances in APPLIED MICROBIOLOGY
Advances in APPLIED MICROBIOLOGY VOLUME 69 Advances in APPLIED MICROBIOLOGY VOLUME 69 Edited by ALLEN I. LASKIN Somerset, New Jersey, USA SIMA SARIASLANI Wilmington, Delaware, USA GEOFFREY M. GADD Dundee, Scotland, UK AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON NEW YORK • OXFORD • PARIS • SAN DIEGO SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO Academic Press is an imprint of Elsevier Academic Press is an imprint of Elsevier 525 B Street, Suite 1900, San Diego, CA 92101-4495, USA 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA 32, Jamestown Road, London NW1 7BY, UK First edition 2009 Copyright # 2009 Elsevier Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher Permissions may be sought directly from Elsevier’s Science & Technology Rights Department in Oxford, UK: phone (+44) (0) 1865 843830; fax (+44) (0) 1865 853333; email: [email protected]. Alternatively you can submit your request online by visiting the Elsevier web site at http://elsevier.com/locate/permissions, and selecting Obtaining permission to use Elsevier material Notice No responsibility is assumed by the publisher for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negli- gence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products, instructions or ideas contained in the material herein. Because of rapid advances in the medical sciences, in particular, independent verification of diagnoses and drug dosages should be made ISBN: 978-0-12-374824-9 ISSN: 0065-2164 For information on all Academic Press publications visit our website at www.elsevierdirect.com Printed and bound in the USA 091010987654321 CONTENTS Contributors ix 1. -

Stop Smoking Systems BOOK
Stop Smoking Systems A Division of Bridge2Life Consultants BOOK ONE Written by Debi D. Hall |2006 IMPORTANT REMINDER – PLEASE READ FIRST Stop Smoking Systems is Not a Substitute for Medical Advice: STOP SMOKING SYSTEMS IS NOT DESIGNED TO, AND DOES NOT, PROVIDE MEDICAL ADVICE. All content, including text, graphics, images, and information, available on or through this Web site (“Content”) are for general informational purposes only. The Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, OR DELAY IN SEEKING IT, BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ IN THIS PROGRAMMATERIAL. NEVER RELY ON INFORMATION CONTAINED IN ANY OF THESE BOOKS OR ANY EXERCISES IN THE WORKBOOK IN PLACE OF SEEKING PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE. Computer Support Services Not Liable: IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY ADVICE, COURSE OF TREATMENT, DIAGNOSIS OR ANY OTHER INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS THAT YOU OBTAIN THROUGH THIS SITE. Confirm Information with Other Sources and Your Doctor: You are encouraged to confer with your doctor with regard to information contained on or through this information system. After reading articles or other Content from these books, you are encouraged to review the information carefully with your professional healthcare provider. Call Your Doctor or 911 in Case of Emergency: If you think you may have a medical emergency, call your doctor or 911 immediately. DO NOT USE THIS READING MATERIAL OR THE SYSTEM FOR SMOKING CESSATION CONTAINED HEREIN FOR MEDICAL EMERGENCIES. No Endorsements: Stop Smoking Systems does not recommend or endorse any specific tests, products, procedures, opinions, physicians, clinics, or other information that may be mentioned or referenced in this material. -

The Adverse Health Effects of Smoking and the Tobacco Industry’S Efforts to Limit Tobacco Control
THE ADVERSE HEALTH EFFECTS OF SMOKING AND THE TOBACCO INDUSTRY’S EFFORTS TO LIMIT TOBACCO CONTROL Prepared by: Jonathan M. Samet, MD, MS Director, USC Institute for Global Health Distinguished Professor and Flora L. Thornton Chair, Department of Preventive Medicine, Keck School of Medicine of USC University of Southern California 2001 North Soto Street, Suite 330A Los Angeles, California 90089-9239, USA Phone: +1 323 865 0803 Fax: +1 323 865 0854 Email: [email protected] 1 Table of Contents Summary ....................................................................................................................................................... 4 Professional Qualifications ........................................................................................................................... 6 Approach ....................................................................................................................................................... 9 Introduction and Context ............................................................................................................................ 10 Scientific approaches to smoking and health ......................................................................................... 11 Epidemiological research ........................................................................................................................ 14 Identifying causes of disease................................................................................................................... 15 The -
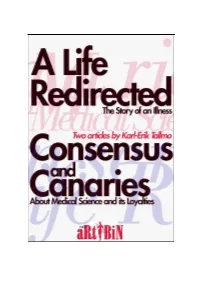
Red Canaries En.Pdf
A Life Redirected The Story of an Illness Consensus and C a n a r i e s About Medical Science and its Loyalties Two articles by Karl-Erik Tallmo This is a special PDF version of two articles by Karl-Erik Tallmo, from issue no 23 of web magazine The Art Bin, published 7 January, 2003. Addresses to WWW pages are included in this version primarily in cases when a reference is available on the web only and not in print. The HTML versions of these articles contain many more URL’s than the PDF. See http://www.art-bin.com/art/redirected_en.html http://www.art-bin.com/art/canaries_en.html © Karl-Erik Tallmo, Nisus Publishing, 2003 C o n t e n t s There are no subheadings in the articles, but the following clickable key- word links will guide the reader to various topics in the text. A Life Redirected 7 The outbreak and the first nine years 7 Being chronically ill changes your whole life 40 Celebrities with CFS etc 45 Consensus and Canaries 53 ”Non-specific symptoms” and somatization 54 Scientific research: risk assessment and health alerts 68 Consensus 71 Scientists as industry consultants 76 Controversial scientists 78 The thalidomide scandal 84 Research infiltrated by the tobacco industry 94 EGIL – the Nordic branch 102 The Ragnar Rylander affair 108 The PVC industry 113 Individual susceptibility and limit values 120 Three positive happenings 126 A Life Redirected The Story of an Illness s I woke up one morning in May 1993, everything changed. Life A changed. -

PREPARE YOUR CONGRESS Advance Programme
HELP SHAPE THE FUTURE OF RESPIRATORY SCIENCE AND MEDICINE PREPARE YOUR CONGRESS Advance Programme TAKE PART IN ERS LONDON 2016 ERSCONGRESS. ORG PROGRAMME AT A GLANCE REGISTRATION FEES Early bird (until 12 Standard (13 July to Onsite (from 3 July 2016) 2 September 2016) September 2016) Postgraduate courses € 95 € 125 € 140 Full day postgraduate course € 155 € 200 € 220 Challenging clinical cases € 70 € 90 € 100 Meet the expert € 70 € 90 € 100 Educational skills workshops € 70 € 90 € 100 Professional development € 25 € 35 € 40 worshops ERS International Congress 2016 OUTLINE PROGRAMME SATURDAY 03 SEPTEMBER, 2016 SATURDAY 03 SEPTEMBER 2016 EPIDEMIOLOGY/ START END TYPE SESSION TAG IMPORTANT INFORMATION ENVIRONMENT 08:00 10:20 Skills workshop SW1 Inhaler techniques Clinical Registration for this session is additional to the congress registration fee and is €100 on site, €90 INFECTION standard or €70 for early bird registration. INTENSIVE CARE 10:40 13:00 Skills workshop SW2 Inhaler techniques Clinical Registration for this session is additional to the congress registration fee and is €100 on site, €90 ONCOLOGY standard or €70 for early bird registration. PAEDIATRIC 14:30 16:50 Skills workshop SW3 Inhaler techniques Clinical Registration for this session is additional to the congress registration fee and is €100 on site, €90 PHYSIOLOGY standard or €70 for early bird registration. 09:30 17:30 Postgraduate PG1 Asthma and chronic Clinical Registration for this session is additional to the SLEEP Course obstructive pulmonary disease Translational congress registration fee and is €220 on site, €200 standard or €155 for early bird registration. An update in assessment and INDUSTRY treatment 09:30 17:30 Postgraduate PG2 Advanced thoracic Clinical Registration for this session is additional to the Course ultrasound congress registration fee and is €220 on site, Enhance your sonography €200 standard or €155 for early bird registration. -

Conseil Communal Lausanne No 11 Séance Du Mardi 26 Octobre 2004 Présidence De M
119e année 2004-2005 – Tome II Bulletin du Conseil communal Lausanne No 11 Séance du mardi 26 octobre 2004 Présidence de M. Maurice Calame (Lib.), président Sommaire Ordre du jour . 93 Ouverture de la séance . 96 Divers: 1. Point 1 de l’ordre du jour . 96 2. Salut au Bureau du Conseil communal de Renens . 96 3. Absence excusée de Mme Silvia Zamora, conseillère municipale . 96 4. Organisation de la séance . 100 Communications: 1. Immeuble avenue du Théâtre 12, Opéra de Lausanne – Augmentation du compte d’attente . 97 2. Nomination de M. Claude-Alain Luy en qualité de chef du Service du gaz et du chauffage à distance des SIL . 97 3. Mandat d’études parallèles d’aménagements paysagers le long du futur m2 entre Ouchy et Grancy – Ouverture d’un compte d’attente . 97 Lettre: Demande d’urgence de la Municipalité pour les préavis Nos 2004/35 et 2004/25 (Municipalité) . 96 Question: No 23 Incidence de la fermeture d’une voie de circulation pendant les travaux à l’avenue Benjamin-Constant (Mme Florence Germond) . 98 Interpellations: 1. Horaires des classes enfantines (Mme Florence Germond). Dépôt . 99 2. «Quel avenir pour la Haute Ecole d’ingénieurs et de gestion à Lausanne?» (M. Alain Bron et consorts). Dépôt . 99 Motion: «Faciliter le tri des déchets pour augmenter le taux de recyclage» (Mme Christina Maier). Dépôt . 99 Questions orales . 99 91 Séance No 11 du mardi 26 octobre 2004 Préavis: No 2004/35 Arrêté d’imposition pour l’année 2005 (Administration générale et Finances) . 101 Rapport polycopié de M. Jean-Christophe Bourquin, président de la Commission permanente des finances, rapporteur . -

THE TOBACCO INDUSTRY DOCUMENTS What They Are, What They Tell Us, and How to Search Them a Practical Manual
WHO-EM/TFI/005/E/G Distribution: General THE TOBACCO INDUSTRY DOCUMENTS What they are, what they tell us, and how to search them A practical manual World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean Cairo 2002 © World Health Organization 2002 This document is not a formal publication of the World Health Organization (WHO), and all rights are reserved by the Organization. The document may, however, be freely reviewed, abstracted, reproduced or translated, in part or in whole, but not for sale or for use in conjunction with commercial purposes. The views expressed in documents by named authors are solely the responsibility of those authors. Printed by WHO EMRO Document WHO -EM/TFI/005/E/G/06.02/200 The tobacco documents 3 CONTENTS ACKNOWLEDGEMENT................................................. 4 THE TOBACCO INDUSTRY DOCUMENTS: AN INTRODUCTION............................................................. 5 What the documents are and where they came from......................................................................... 5 What the documents tell us .................................... 9 Why are these documents important?.................. 23 KEY INTERNET ADDRESSES (URLs) FOR ACCESSING THE DOCUMENTS........................................................ 24 DOCUMENT COLLECTIONS ....................................... 26 SEARCHING THE DOCUMENTS ................................ 28 The Philip Morris document face sheet and the 4B index...................................................................... 28 ARE ALL -

“We Are Still Not Yet out of the Woods in W.A.”: Western Australia and the International Tobacco Industry
“We are still not yet out of the woods in W.A.”: Western Australia and the international tobacco industry Julia Staff ord, Laura Bond and Mike Daube WA Tobacco Document Searching Program Western Australia and the international tobacco industry “We are still not yet out of the woods in W.A.”: Western Australia and the international tobacco industry Monograph Julia Staff ord, Laura Bond and Mike Daube WA Tobacco Document Searching Program Curtin University of Technology “We are still not yet out of the woods in W.A.” First published in 2009 by the WA Tobacco Document Searching Program Health Research Campus Curtin University of Technology GPO Box U1987 Perth Western Australia 6845 Copyright © WA Tobacco Document Searching Program, 2009 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilised in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. To obtain copies of this publication please contact: WA Tobacco Document Searching Program Health Research Campus Curtin University of Technology GPO Box U1987 Perth Western Australia 6845 Australia Telephone: 08 9266 7117 Facsimile: 08 9266 9244 Website: www.healthsciences.curtin.edu.au/watdsp/ Email: [email protected] The WA Tobacco Document Searching Program gratefully acknowledges the funding support of Healthway, the Western Australian Health Promotion Foundation and the Australian Council on Smoking and Health. Suggested citation: Staff ord J, Bond L, Daube M. “We are still not yet out of the woods in W.A.”: Western Australia and the international tobacco industry. -

Shock at Rylander Appointment Japan, India
323 News analysis....................................................................................... Tob Control: first published as on 24 November 2004. Downloaded from As to how the appointment could ever public places. In a letter about the European Union: shock have happened, one answer may lie in vehicles to the British Medical Journal, that familiar problem whereby those Professor Hiroshi Kawane from the at Rylander guarding the corridors of power have Japanese Red Cross Hiroshima College appointment little detailed knowledge of what goes of Nursing shrewdly observed, ‘‘I think Almost anyone toiling at the coal face of on outside in the real world, and most second-hand smoke combined with tobacco control knows the name of important, fail to consult those who do. exhaust fumes from SmoCar has Ragnar Rylander, and for the most It can only be hoped that this time, become a health hazard for non- alarming of reasons. Therefore, how some hard lessons will be learned. With smokers in the vicinity of the car’’. could the Swedish scientist have been millions of tobacco industry documents Meanwhile, something similar has appointed to the Scientific Committee now available—including, incidentally, appeared in India. Godfrey Phillips, on Health and Environmental Risks of over 16 000 relating to Rylander—and Indian subsidiary of Philip Morris, the European Commission, the secret- communication between health advo- launched a similar mobile smoking ariat of the European Union? How could cates around the world easier and lounge in Mumbai (formerly Bombay), advisers to Health Commissioner David quicker than in anyone’s wildest dreams which was parked at various landmark Byrne, renowned for his strong leader- just a decade ago, it now takes only sites for a few days each, followed by ship on tobacco control, have failed to moments to check out the credentials of appearances in Ahmedabad, Delhi, and note the widespread publicity given to almost all individuals being considered Baroda.