2 Geschichte Und Funktion Des Method Acting
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Blurred Lines Between Role and Reality: a Phenomenological Study of Acting
Antioch University AURA - Antioch University Repository and Archive Student & Alumni Scholarship, including Dissertations & Theses Dissertations & Theses 2019 Blurred Lines Between Role and Reality: A Phenomenological Study of Acting Gregory Hyppolyte Brown Follow this and additional works at: https://aura.antioch.edu/etds Part of the Psychology Commons BLURRED LINES BETWEEN ROLE AND REALITY: A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF ACTING A Dissertation Presented to the Faculty of Antioch University Santa Barbara In partial fulfillment of the requirements for the the degree of DOCTOR OF PSYCHOLOGY In CLINICAL PSYCHOLOGY by GREGORY HIPPOLYTE BROWN August 2019 This dissertation, by Gregory Hippolyte Brown, has been approved by the committee members signed below who recommend that it be accepted by the faculty of Antioch University Santa Barbara in partial fulfillment of requirements for the degree of DOCTOR OF PSYCHOLOGY Dissertation Committee: _________________________ Brett Kia-Keating, Ed.D. Chairperson __________________________ Sharleen O‘ Brien, Ph.D. Second Faculty __________________________ Thalia R. Goldstein, Ph.D. External Expert ii Copyright © 2019 Gregory Hippolyte Brown iii Abstract When an actor plays a character in a film, they try to connect with the emotions and behavioral patterns of the scripted character. There is an absence of literature regarding how a role influences an actor’s life before, during, and after film production. This study examined how acting roles might influence an actor during times on set shooting a movie or television series as well as their personal life after the filming is finished. Additionally the study considered the psychological impact of embodying a role, and whether or not an actor ever has the feeling that the performed character has independent agency over the actor. -
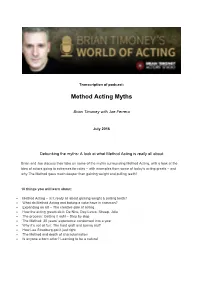
Method Acting Myths
Transcription of podcast: Method Acting Myths Brian Timoney with Joe Ferrera July 2016 Debunking the myths: A look at what Method Acting is really all about Brian and Joe discuss their take on some of the myths surrounding Method Acting, with a look at the idea of actors going to extremes for roles – with examples from some of today’s acting greats – and why The Method goes much deeper than gaining weight and pulling teeth! 10 things you will learn about: • Method Acting – Is it really all about gaining weight & pulling teeth? • What do Method Acting and baking a cake have in common? • Expanding on art – The creative side of acting • How the acting greats do it: De Niro, Day-Lewis, Streep, Jolie • The process: Getting it right – Step by step • The Method: 30 years’ experience condensed into a year • Why it’s not all fun: The hard graft and boring stuff • How Lee Strasburg got it just right • The Method and depth of characterisation • Is anyone a born actor? Learning to be a natural Page 2 Full Transcript One man – One mission: To rid the world of low-standard and mediocre acting, once and for all. Brian Timoney, the world’s leading authority on Method Acting, brings you powerful, impactful, volcanic acting and ‘business of acting’ techniques in his special Acting Podcasts. It’s Brian Timoney’s World of Acting – unplugged and unleashed. Brian: Hi everyone, it’s Brian here. Welcome onto today’s podcast. And I have Joe with me – welcome, Joe. Joe: Thank you very much for having me, Brian. -
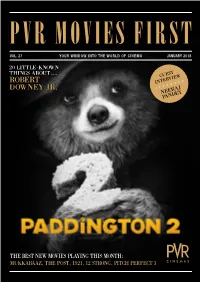
Robert Downey Jr
PVR MOVIES FIRST VOL. 27 YOUR WINDOW INTO THE WORLD OF CINEMA JANUARY 2018 20 LITTLE-KNOWN THINGS ABOUt…. GUEST RVIEW ROBERT INTE DOWNEY JR. RAJ NEE EY PAND THE BEST NEW MOVIES PLAYING THIS MONTH: MUKKABAAZ, THE POST, 1921, 12 STRONG, PITCH PERFECT 3 GREETINGS ear Movie Lovers, We rewind to “ Scent of a Woman, “ the 1992 film that earned Al Pacino his first Oscar for his portrayal of a Here’s the January edition of Movies First, your exclusive cantankerous colonel. window to the world of cinema. T race the fast-rising career graph of American writer- Th e year kickstarts with “ Paddington 2”, a fabulous follow director Alex Garland , and join us in wishing superstar up to Paul King’s superhit animation comedy. Watch Nicholas Cage a Happy Birthday. out for Hugh Grant’s scene-stealing turn as an appalling villain, and the non-stop side-splitting gags. We really hope you enjoy the issue. Wish you a fabulous month of movie watching. Neeraj Pandey’s much awaited “Aiyaary” arrives on screen, and we have the man himself telling us what to Regards expect from this intense patriotic thriller. Akshay Kumar plays “ Pad Man ,” which tackles a bold and beautiful Gautam Dutta social subject. CEO, PVR Limited USING THE MAGAZINE We hope youa’ll find this magazine easy to use, but here’s a handy guide to the icons used throughout anyway. You can tap the page once at any time to access full contents at the top of the page. PLAY TRAILER SET REMINDER BOOK TICKETS SHARE PVR MOVIES FIRST PAGE 2 CONTENTS This January everyone’s favourite bear is back for seconds. -

Why Hollywood Isn't As Liberal As We Think and Why It Matters
Claremont Colleges Scholarship @ Claremont CMC Senior Theses CMC Student Scholarship 2019 Why Hollywood Isn't As Liberal As We Think nda Why It Matters Amanda Daily Claremont McKenna College Recommended Citation Daily, Amanda, "Why Hollywood Isn't As Liberal As We Think nda Why It Matters" (2019). CMC Senior Theses. 2230. https://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/2230 This Open Access Senior Thesis is brought to you by Scholarship@Claremont. It has been accepted for inclusion in this collection by an authorized administrator. For more information, please contact [email protected]. 1 Claremont McKenna College Why Hollywood Isn’t As Liberal As We Think And Why It Matters Submitted to Professor Jon Shields by Amanda Daily for Senior Thesis Fall 2018 and Spring 2019 April 29, 2019 2 3 Abstract Hollywood has long had a reputation as a liberal institution. Especially in 2019, it is viewed as a highly polarized sector of society sometimes hostile to those on the right side of the aisle. But just because the majority of those who work in Hollywood are liberal, that doesn’t necessarily mean our entertainment follows suit. I argue in my thesis that entertainment in Hollywood is far less partisan than people think it is and moreover, that our entertainment represents plenty of conservative themes and ideas. In doing so, I look at a combination of markets and artistic demands that restrain the politics of those in the entertainment industry and even create space for more conservative productions. Although normally art and markets are thought to be in tension with one another, in this case, they conspire to make our entertainment less one-sided politically. -

Pdf, 742.59 KB
00:00:00 Dan McCoy Host On this episode, we discuss: Doolittle! 00:00:03 Stuart Host Why do they call him “Do little”? I think he does a lot in this movie! Wellington [Laughs.] 00:00:08 Elliott Kalan Host The—Stu, that’s exactly what I was gonna say. 00:00:11 Dan Host And it was what Audrey predicted was gonna be the gag. [Multiple people laugh.] 00:00:15 Elliott Host That is the exact thing I have written in my notes to say, Stu, for this—for this part. Ah. Two peas in a pod. 00:00:22 Music Music Light, up-tempo, electric guitar with synth instruments. 00:00:49 Dan Host Hey, everyone, and welcome to The Flop House. I’m Dan McCoy. 00:00:52 Stuart Host Oh hey there! I’m Stuart Wellington. 00:00:54 Elliott Host Top o’ the morning! Or whenever you’re listening to this—midnight? I don’t know! I’m Elliott Kalan. And Dan, who’s joining us? 00:01:01 Crosstalk Crosstalk Stuart: Yeah, Dan. Elliott: Or Stuart. 00:01:02 Dan Host Uh… 00:01:03 Elliott Host Or Dan. 00:01:04 Crosstalk Crosstalk Elliott: Or Stuart? Dan: I thought we decided on Stuart— 00:01:05 Dan Host —but I can say it. It’s—it’s David Sims, of the Blank Check podcast and he is the, uh… film reviewer for The Atlantic. And that is a—that is a big, high-toned magazine. That is, uh, that is a respected publication. -

All of the Apple Is Me: Process Work & Acting an Exploration & Practical Guide
All of the Apple is Me: Process Work & Acting An Exploration & Practical Guide Lisa Blair September 27, 2009 Process Work Institute Submitted in partial fulfillment of the Master of Arts in Process Work and the Diploma in Process Work All content and exercises are meant for individual use only and should not be duplicated or distributed for classroom or other use. Please do not make partial or complete copies of this manuscript without permission by the author. Copyright © 2009 2 If I compare myself to a large, meaty, round apple, I discover that my inner and outer cliché image of myself is only a wedge of it – possibly the wedge with the rosy cheek on the skin. But I have to become aware of myself as the total apple – the firm inner flesh as well as the brown rotten spot, the stem, the seeds, the core. All of the apple is me. ‐ Uta Hagen, Respect for Acting 3 4 Table of Contents Acknowledgements............................................................... 7 Introduction .......................................................................... 9 Act I: Acting Techniques for the Actor A Brief Overview of Theories of Acting................................. 23 Actor Preparation.................................................................. 43 Act II: Process Work Techniques for the Actor Identity.................................................................................. 51 Edgework .............................................................................. 57 The Killer .............................................................................. -

Mary in Film
PONT~CALFACULTYOFTHEOLOGY "MARIANUM" INTERNATIONAL MARIAN RESEARCH INSTITUTE (UNIVERSITY OF DAYTON) MARY IN FILM AN ANALYSIS OF CINEMATIC PRESENTATIONS OF THE VIRGIN MARY FROM 1897- 1999: A THEOLOGICAL APPRAISAL OF A SOCIO-CULTURAL REALITY A thesis submitted to The International Marian Research Institute In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree Licentiate of Sacred Theology (with Specialization in Mariology) By: Michael P. Durley Director: Rev. Johann G. Roten, S.M. IMRI Dayton, Ohio (USA) 45469-1390 2000 Table of Contents I) Purpose and Method 4-7 ll) Review of Literature on 'Mary in Film'- Stlltus Quaestionis 8-25 lli) Catholic Teaching on the Instruments of Social Communication Overview 26-28 Vigilanti Cura (1936) 29-32 Miranda Prorsus (1957) 33-35 Inter Miri.fica (1963) 36-40 Communio et Progressio (1971) 41-48 Aetatis Novae (1992) 49-52 Summary 53-54 IV) General Review of Trends in Film History and Mary's Place Therein Introduction 55-56 Actuality Films (1895-1915) 57 Early 'Life of Christ' films (1898-1929) 58-61 Melodramas (1910-1930) 62-64 Fantasy Epics and the Golden Age ofHollywood (1930-1950) 65-67 Realistic Movements (1946-1959) 68-70 Various 'New Waves' (1959-1990) 71-75 Religious and Marian Revival (1985-Present) 76-78 V) Thematic Survey of Mary in Films Classification Criteria 79-84 Lectures 85-92 Filmographies of Marian Lectures Catechetical 93-94 Apparitions 95 Miscellaneous 96 Documentaries 97-106 Filmographies of Marian Documentaries Marian Art 107-108 Apparitions 109-112 Miscellaneous 113-115 Dramas -

Glorious Technicolor: from George Eastman House and Beyond Screening Schedule June 5–August 5, 2015 Friday, June 5 4:30 the G
Glorious Technicolor: From George Eastman House and Beyond Screening Schedule June 5–August 5, 2015 Friday, June 5 4:30 The Garden of Allah. 1936. USA. Directed by Richard Boleslawski. Screenplay by W.P. Lipscomb, Lynn Riggs, based on the novel by Robert Hichens. With Marlene Dietrich, Charles Boyer, Basil Rathbone, Joseph Schildkraut. 35mm restoration by The Museum of Modern Art, with support from the Celeste Bartos Fund for Film Preservation; courtesy The Walt Disney Studios. 75 min. La Cucaracha. 1934. Directed by Lloyd Corrigan. With Steffi Duna, Don Alvarado, Paul Porcasi, Eduardo Durant’s Rhumba Band. Courtesy George Eastman House (35mm dye-transfer print on June 5); and UCLA Film & Television Archive (restored 35mm print on July 21). 20 min. [John Barrymore Technicolor Test for Hamlet]. 1933. USA. Pioneer Pictures. 35mm print from The Museum of Modern Art. 5 min. 7:00 The Wizard of Oz. 1939. USA. Directed by Victor Fleming. Screenplay by Noel Langley, Florence Ryerson, Edgar Allan Woolf, based on the book by L. Frank Baum. Music by Harold Arlen, E.Y. Harburg. With Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Ray Bolger, Margaret Hamilton, Billie Burke. 35mm print from George Eastman House; courtesy Warner Bros. 102 min. Saturday, June 6 2:30 THE DAWN OF TECHNICOLOR: THE SILENT ERA *Special Guest Appearances: James Layton and David Pierce, authors of The Dawn of Technicolor, 1915-1935 (George Eastman House, 2015). James Layton and David Pierce illustrate Technicolor’s origins during the silent film era. Before Technicolor achieved success in the 1930s, the company had to overcome countless technical challenges and persuade cost-conscious producers that color was worth the extra effort and expense. -

Coaching for Film and Television | Systemic Career Consulting | Authenticity Training | Heike Hanold-Lynch
Coaching for film and television | Systemic career consulting | Authenticity training | Heike Hanold-Lynch Glaubwürdigkeit – Das Wesentliche wirken lassen, bis es wirkt Ein Transferangebot aus dem Schauspiel-Coaching Zusammenfassung Darstellerische Glaubwürdigkeit ist menschliche Glaubwürdigkeit. Diese hat mehr mit Sein als Schein zu tun, ist kein So-tun-als-ob. Glaubwürdige Persönlichkeiten wirken wie glaubwürdige Schauspieler durch sich selbst und aus sich selbst heraus, in lebendigem Kontakt mit dem Gegenüber. Die Voraussetzung dafür ist Vertrauen in die eigene Identität durch Verwurzelung in authentischer Erfahrung, denn jede Performance entwickelt sich aus dem individuellen Sein, unabhängig von Inhalt, Form und Methodik. Das Resümee meines zwölfjährigen Coachingalltags im Spannungsfeld wirtschaftlicher Effizienz und künstlerischer Überzeugungskraft beschreibt meinen Coachingansatz, der Glaubwürdigkeit und Wesentlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Mein hier erstmals vorgestelltes Glaubwürdigkeitsmodell und dessen Methoden existentieller Wesentlichkeit bestehen auch den Transfer zu anderen Zielgruppen. Schlüsselwörter Selbstvertrauen Schauspielkunst Film- und Fernsehproduktionen Credibility – Creating Credibility Through the Essential A transfer of experience from acting coaching Abstract Credibility as an actor means credibility as a person. It has much more to do with reality than appearance and isn’t just about pretending. Credible personalities convince in the way credible actors do: They draw from within and create a living connection with others. The most important prerequisite is trusting in your own identity by being rooted in authentic experiences, because every performance develops from inside a person regardless of the content, form, or methodology. This summary of twelve years of everyday coaching, which took place in the tense relationship between economic efficiency and the artistic power of persuasion, describes my personal coaching approach, where credibility and materiality are at the center. -

At the Core of the Strasberg Curriculum Are the Method Acting Classes
SPRING 2020 CLASSES METHOD ACTING At the core of the Strasberg curriculum are the Method Acting classes. Students are required to take two Method Acting classes per semester, each with a different teacher. These classes are designed to train the actor in Lee Strasberg’s systematic approach to acting known throughout the world as The Method. The technique develops the actor’s ability to respond with real behavior to imaginary stimuli and trains the actor to use their personal experience to fire their imagination. These four-hour classes are divided into two parts: work on one’s self and work on the character. The work one’s self employs Lee Strasberg’s relaxation and sensory exercises to train the actor’s concentration, and eliminate the actor’s individual habits of mental and physical tension, which limit their ability to express. The relaxation is repeated in every class, building over the course of study a keen awareness of one’s body and the ability to relax at will. Sensory exercises are also done each class, but become more complicated throughout the course of study. Sensory work begins with recreating ordinary objects and sensations using the five senses and moves towards more emotional stimuli. This part of class focuses on training an actor’s talent. The second part of class focuses on applying the exercises to scenework and learning how the sensory can help fulfill the demands placed upon the actor by a particular script. Students use the exercises to create organic behavior, make truthful choices, and also learn the way in which improvisation can be used to explore a character’s motivation and deepen one’s understand of the character and scene. -

Anti-Theatrical Ideology in American Method Acting Michael L. Quinn
Fall 1995 5 Self-Reliance and Ritual Renewal: Anti-theatrical Ideology in American Method Acting Michael L. Quinn American Method acting is not only a realistic artistic technique but also an ideological formation. Almost every account of the adaptation of the Stanislavsky system by the Group Theater generation describes the new "Method" as distinctively American, yet this nationalist aspect of the project has rarely been examined from a historical standpoint that relates it to the dominant forces of American artistic culture; either the Method's arguments for its objectivity have been accepted as scientfically progressive, or its roots are traced to progressive European models (Ashby 1). On the contrary, the Method represents perhaps the most successful merging of a theoretcially conceived theatrical technique with the intellectual traditions that shape the history of American artistic culture. Most critics of the Method in America have produced explanations of the Method's dominance by taking issue either with its artistic claims for superiority or with its satisfied closure into a repressively conceived realism—both arguments that could be carried out solely on the basis of Stanislavsky's work, rather than considering that of his American epigones (Marowitz; Dolan 84-86). I view the emergence of the Method as the productive juncture of a theatrical practice and a revolutionary ideology, an imaginative intersection of innovation and energy that resulted in a remarkable body of work before its force subsided in the face of subsequent, similar cultural transformations; though American debates about the finer points of its technique still continue, the intellectual vitality of the Method revolution has been in a steady decline for about three decades (Schechner). -

Kinoteka2020 Guide-Compressed.Pdf
Welcome to Kinoteka 18! 1 kinoteka.org.u k Welcome to Kinoteka 18! Welcome to Kinoteka 18! 1 CONTENTS WELCOME TO KINOTEKA 18! Welcome to KINOTEKA 18! ................................................................ 1 As we enter a new decade, Polish film documentaries with a trio of recent films, continues to go from strength to strength. spanning topics such as loneliness, Japanese While Agnieszka Holland, that tireless voice students’ struggles with learning the Polish SCREENINGS & EVENTS from the old guard of Polish film-making, language, and romantic intimacy among the Opening Night Gala ....................................................................... 4 continues to channel her vision with Mr. tragedy of the Warsaw Ghetto. New Polish Cinema ........................................................................ 6 Jones, a number of newer talents have broken We continue to bring you the best in through – most notably, screenwriter Mateusz exclusive cinematic experiences with a Documentaries ............................................................................ 12 Pacewicz and actor Bartosz Bielenia in Corpus series of interactive events and showcases Focus: Richard Boleslawski ............................................................... 16 Christi, Poland’s short-listed entry for this encompassing the breadth of cinema history. Family Event .............................................................................. 18 year’s Academy Awards. At the 18th Kinoteka The Cinema Museum focuses on the early Tadeusz Kantor