Micrelaps Muelleri Böttger, 1880 (Serpentes: Atractaspididae)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

A Molecular Phylogeny of the Lamprophiidae Fitzinger (Serpentes, Caenophidia)
Zootaxa 1945: 51–66 (2008) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2008 · Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) Dissecting the major African snake radiation: a molecular phylogeny of the Lamprophiidae Fitzinger (Serpentes, Caenophidia) NICOLAS VIDAL1,10, WILLIAM R. BRANCH2, OLIVIER S.G. PAUWELS3,4, S. BLAIR HEDGES5, DONALD G. BROADLEY6, MICHAEL WINK7, CORINNE CRUAUD8, ULRICH JOGER9 & ZOLTÁN TAMÁS NAGY3 1UMR 7138, Systématique, Evolution, Adaptation, Département Systématique et Evolution, C. P. 26, Muséum National d’Histoire Naturelle, 43 Rue Cuvier, Paris 75005, France. E-mail: [email protected] 2Bayworld, P.O. Box 13147, Humewood 6013, South Africa. E-mail: [email protected] 3 Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Rue Vautier 29, B-1000 Brussels, Belgium. E-mail: [email protected], [email protected] 4Smithsonian Institution, Center for Conservation Education and Sustainability, B.P. 48, Gamba, Gabon. 5Department of Biology, 208 Mueller Laboratory, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802-5301 USA. E-mail: [email protected] 6Biodiversity Foundation for Africa, P.O. Box FM 730, Bulawayo, Zimbabwe. E-mail: [email protected] 7 Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology, University of Heidelberg, INF 364, D-69120 Heidelberg, Germany. E-mail: [email protected] 8Centre national de séquençage, Genoscope, 2 rue Gaston-Crémieux, CP5706, 91057 Evry cedex, France. E-mail: www.genoscope.fr 9Staatliches Naturhistorisches Museum, Pockelsstr. 10, 38106 Braunschweig, Germany. E-mail: [email protected] 10Corresponding author Abstract The Elapoidea includes the Elapidae and a large (~60 genera, 280 sp.) and mostly African (including Madagascar) radia- tion termed Lamprophiidae by Vidal et al. -

Journal of the East Africa Natural History Society and National Museum
JOURNAL OF THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY AND NATIONAL MUSEUM 15 October, 1978 Vol. 31 No. 167 A CHECKLIST OF mE SNAKES OF KENYA Stephen Spawls 35 WQodland Rise, Muswell Hill, London NIO, England ABSTRACT Loveridge (1957) lists 161 species and subspecies of snake from East Mrica. Eighty-nine of these belonging to some 41 genera were recorded from Kenya. The new list contains some 106 forms of 46 genera. - Three full species have been deleted from Loveridge's original checklist. Typhlops b. blanfordii has been synonymised with Typhlops I. lineolatus, Typhlops kaimosae has been synonymised with Typhlops angolensis (Roux-Esteve 1974) and Co/uber citeroii has been synonymised with Meizodon semiornatus (Lanza 1963). Of the 20 forms added to the list, 12 are forms collected for the first time in Kenya but occurring outside its political boundaries and one, Atheris desaixi is a new species, the holotype and paratypes being collected within Kenya. There has also been a large number of changes amongst the 89 original species as a result of revisionary systematic studies. This accounts for the other additions to the list. INTRODUCTION The most recent checklist dealing with the snakes of Kenya is Loveridge (1957). Since that date there has been a significant number of developments in the Kenyan herpetological field. This paper intends to update the nomenclature in the part of the checklist that concerns the snakes of Kenya and to extend the list to include all the species now known to occur within the political boundaries of Kenya. It also provides the range of each species within Kenya with specific locality records . -

A Molecular Phylogeny of the Lamprophiidae Fitzinger (Serpentes, Caenophidia)
Zootaxa 1945: 51–66 (2008) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2008 · Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) Dissecting the major African snake radiation: a molecular phylogeny of the Lamprophiidae Fitzinger (Serpentes, Caenophidia) NICOLAS VIDAL1,10, WILLIAM R. BRANCH2, OLIVIER S.G. PAUWELS3,4, S. BLAIR HEDGES5, DONALD G. BROADLEY6, MICHAEL WINK7, CORINNE CRUAUD8, ULRICH JOGER9 & ZOLTÁN TAMÁS NAGY3 1UMR 7138, Systématique, Evolution, Adaptation, Département Systématique et Evolution, C. P. 26, Muséum National d’Histoire Naturelle, 43 Rue Cuvier, Paris 75005, France. E-mail: [email protected] 2Bayworld, P.O. Box 13147, Humewood 6013, South Africa. E-mail: [email protected] 3 Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Rue Vautier 29, B-1000 Brussels, Belgium. E-mail: [email protected], [email protected] 4Smithsonian Institution, Center for Conservation Education and Sustainability, B.P. 48, Gamba, Gabon. 5Department of Biology, 208 Mueller Laboratory, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802-5301 USA. E-mail: [email protected] 6Biodiversity Foundation for Africa, P.O. Box FM 730, Bulawayo, Zimbabwe. E-mail: [email protected] 7 Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology, University of Heidelberg, INF 364, D-69120 Heidelberg, Germany. E-mail: [email protected] 8Centre national de séquençage, Genoscope, 2 rue Gaston-Crémieux, CP5706, 91057 Evry cedex, France. E-mail: www.genoscope.fr 9Staatliches Naturhistorisches Museum, Pockelsstr. 10, 38106 Braunschweig, Germany. E-mail: [email protected] 10Corresponding author Abstract The Elapoidea includes the Elapidae and a large (~60 genera, 280 sp.) and mostly African (including Madagascar) radia- tion termed Lamprophiidae by Vidal et al. -

Obituary for JENS BØDTKER RASMUSSEN (1947-2005)
Obituary for JENS BØDTKER RASMUSSEN SALAMANDRA 41 4 161-165 Rheinbach, 20 November 2005 ISSN 0036-3375 Obituary for JENS BØDTKER RASMUSSEN (1947-2005) The international herpetological community was shocked when the sad news dispersed that JENS BØDTKER RASMUSSEN had passed away on the 3rd of May of this year. The shock was the greater as we, his friends and colleagues, were completely unprepared for this terrible news: A severe illness had defeated JENS with- in only a few weeks and took him brutally away from his family as well as from his professional life as the herpetological cura- tor of the Zoological University Museum of Copenhagen. His death finished abruptly a long-term and still flourishing period of suc- cessful work on the African snake fauna. JENS BØDTKER RASMUSSEN was born on the 16th of April 1947 in Copenhagen where he spent also his entire school time. Still being a schoolboy, he visited regularly the Zoolo- gical Museum of his city, which at that time was still in its old building in Copenhagen’s Photo: MOGENS ANDERSEN. Krystalgade. He kept his close contacts to this museum also as a student and he re- ceived much support by the then head of the lege to spend the nights in the office of Dr. vertebrate department, Dr. F.W. BRAESTRUP. In BRAESTRUP. At these occasions I received my these years – the museum had received a new first impressions of and experiences with the and functional, modern building at Universi- remarkable scientific herpetological collec- tetsparken – our acquaintance and friendship tions of the Copenhagen Museum, and I used began. -

Appendix 1 Vernacular Names
Appendix 1 Vernacular Names The vernacular names listed below have been collected from the literature. Few have phonetic spellings. Spelling is not helped by the difficulties of transcribing unwritten languages into European syllables and Roman script. Some languages have several names for the same species. Further complications arise from the various dialects and corruptions within a language, and use of names borrowed from other languages. Where the people are bilingual the person recording the name may fail to check which language it comes from. For example, in northern Sahel where Arabic is the lingua franca, the recorded names, supposedly Arabic, include a number from local languages. Sometimes the same name may be used for several species. For example, kiri is the Susu name for both Adansonia digitata and Drypetes afzelii. There is nothing unusual about such complications. For example, Grigson (1955) cites 52 English synonyms for the common dandelion (Taraxacum officinale) in the British Isles, and also mentions several examples of the same vernacular name applying to different species. Even Theophrastus in c. 300 BC complained that there were three plants called strykhnos, which were edible, soporific or hallucinogenic (Hort 1916). Languages and history are linked and it is hoped that understanding how lan- guages spread will lead to the discovery of the historical origins of some of the vernacular names for the baobab. The classification followed here is that of Gordon (2005) updated and edited by Blench (2005, personal communication). Alternative family names are shown in square brackets, dialects in parenthesis. Superscript Arabic numbers refer to references to the vernacular names; Roman numbers refer to further information in Section 4. -

The Herpetological Journal
Volume 8, Number 3 July 1998 ISSN 0268-0130 THE HERPETOLOGICAL JOURNAL Published by the Indexed in BRITISH HERPETOLOGICAL SOCIETY Current Contents Th e Herpetological Jo urnal is published quarterly by the British Herpetological Society and is issued freeto members. Articles are listed in Current Awareness in Biological Sciences, Current Contents, Science Citation Index and Zoological Record. Applications to purchase copies and/or for details of membership should be made to the Hon. Secretary, British Herpetological Society, The Zoological Society of London, Regent's Park, London NWl 4RY, UK. Instructions to authors are printed inside the back cover. All contributions should be addressed to the Editor (address below). Editor: Richard A. Griffiths, The Durrell Institute of Conservation and Ecology, University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NJ, UK Associate Editor: Leigh Gillett Editorial Board: Pim Arntzen (Oporto) Donald Broadley (Zimbabwe) John Cooper (Wellingborough) John Davenport (Millport) Andrew Gardner (Oman) Tim Halliday (Milton Keynes) Michael Klemens (New York) Colin McCarthy (London) Andrew Milner (London) Henk Strijbosch (Nijmegen) Richard Tinsley (Bristol) BRITISH HERPETOLOGICAL SOCIETY Copyright It is a fundamental condition that submitted manuscripts have not been published and will not be simultaneously submitted or published elsewhere. By submitting a manuscript, the authors agree that the copyright for their article is transferred to the publisher if and when the article is accepted for publication. The copyright covers the exclusive rights to reproduce and distribute the article, including reprints and photographic reproductions. Permission for any such activities must be sought in advance from the Editor. ADVERTISEMENTS The Herpetological Journal accepts advertisements subject to approval of contents by the Editor, to whom enquiries should be addressed. -

Pdf> (Accessed of Life
Molecular Phylogenetics and Evolution 94 (2016) 537–547 Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Combining phylogenomic and supermatrix approaches, and a time-calibrated phylogeny for squamate reptiles (lizards and snakes) based on 52 genes and 4162 species q ⇑ Yuchi Zheng a,b, John J. Wiens b, a Department of Herpetology, Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China b Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Arizona, Tucson, AZ 85721-088, USA article info abstract Article history: Two common approaches for estimating phylogenies in species-rich groups are to: (i) sample many loci Received 26 May 2015 for few species (e.g. phylogenomic approach), or (ii) sample many species for fewer loci (e.g. supermatrix Revised 30 September 2015 approach). In theory, these approaches can be combined to simultaneously resolve both higher-level rela- Accepted 8 October 2015 tionships (with many genes) and species-level relationships (with many taxa). However, fundamental Available online 22 October 2015 questions remain unanswered about this combined approach. First, will higher-level relationships more closely resemble those estimated from many genes or those from many taxa? Second, will branch sup- Keywords: port increase for higher-level relationships (relative to the estimate from many taxa)? Here, we address Missing data these questions in squamate reptiles. We combined two recently published datasets, one based on 44 Phylogenomic Phylogeny genes for 161 species, and one based on 12 genes for 4161 species. The likelihood-based tree from the Squamata combined matrix (52 genes, 4162 species) shared more higher-level clades with the 44-gene tree (90% Supermatrix vs. -

A Phylogeny and Revised Classification of Squamata, Including 4161 Species of Lizards and Snakes
BMC Evolutionary Biology This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully formatted PDF and full text (HTML) versions will be made available soon. A phylogeny and revised classification of Squamata, including 4161 species of lizards and snakes BMC Evolutionary Biology 2013, 13:93 doi:10.1186/1471-2148-13-93 Robert Alexander Pyron ([email protected]) Frank T Burbrink ([email protected]) John J Wiens ([email protected]) ISSN 1471-2148 Article type Research article Submission date 30 January 2013 Acceptance date 19 March 2013 Publication date 29 April 2013 Article URL http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/93 Like all articles in BMC journals, this peer-reviewed article can be downloaded, printed and distributed freely for any purposes (see copyright notice below). Articles in BMC journals are listed in PubMed and archived at PubMed Central. For information about publishing your research in BMC journals or any BioMed Central journal, go to http://www.biomedcentral.com/info/authors/ © 2013 Pyron et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. A phylogeny and revised classification of Squamata, including 4161 species of lizards and snakes Robert Alexander Pyron 1* * Corresponding author Email: [email protected] Frank T Burbrink 2,3 Email: [email protected] John J Wiens 4 Email: [email protected] 1 Department of Biological Sciences, The George Washington University, 2023 G St. -

Systematics of Collared Snakes and Burrowing Asps (Aparallactinae
University of Texas at El Paso DigitalCommons@UTEP Open Access Theses & Dissertations 2017-01-01 Systematics Of Collared Snakes And Burrowing Asps (aparallactinae And Atractaspidinae) (squamata: Lamprophiidae) Francisco Portillo University of Texas at El Paso, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.utep.edu/open_etd Part of the Zoology Commons Recommended Citation Portillo, Francisco, "Systematics Of Collared Snakes And Burrowing Asps (aparallactinae And Atractaspidinae) (squamata: Lamprophiidae)" (2017). Open Access Theses & Dissertations. 731. https://digitalcommons.utep.edu/open_etd/731 This is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UTEP. It has been accepted for inclusion in Open Access Theses & Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@UTEP. For more information, please contact [email protected]. SYSTEMATICS OF COLLARED SNAKES AND BURROWING ASPS (APARALLACTINAE AND ATRACTASPIDINAE) (SQUAMATA: LAMPROPHIIDAE) FRANCISCO PORTILLO, BS, MS Doctoral Program in Ecology and Evolutionary Biology APPROVED: Eli Greenbaum, Ph.D., Chair Carl Lieb, Ph.D. Michael Moody, Ph.D. Richard Langford, Ph.D. Charles H. Ambler, Ph.D. Dean of the Graduate School Copyright © by Francisco Portillo 2017 SYSTEMATICS OF COLLARED SNAKES AND BURROWING ASPS (APARALLACTINAE AND ATRACTASPIDINAE) (SQUAMATA: LAMPROPHIIDAE) by FRANCISCO PORTILLO, BS, MS DISSERTATION Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at El Paso in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Biological Sciences THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO May 2017 ACKNOWLEDGMENTS First, I would like to thank my family for their love and support throughout my life. I am very grateful to my lovely wife, who has been extremely supportive, motivational, and patient, as I have progressed through graduate school. -

Patterns of Species Richness, Endemism and Environmental Gradients of African Reptiles
Journal of Biogeography (J. Biogeogr.) (2016) ORIGINAL Patterns of species richness, endemism ARTICLE and environmental gradients of African reptiles Amir Lewin1*, Anat Feldman1, Aaron M. Bauer2, Jonathan Belmaker1, Donald G. Broadley3†, Laurent Chirio4, Yuval Itescu1, Matthew LeBreton5, Erez Maza1, Danny Meirte6, Zoltan T. Nagy7, Maria Novosolov1, Uri Roll8, 1 9 1 1 Oliver Tallowin , Jean-Francßois Trape , Enav Vidan and Shai Meiri 1Department of Zoology, Tel Aviv University, ABSTRACT 6997801 Tel Aviv, Israel, 2Department of Aim To map and assess the richness patterns of reptiles (and included groups: Biology, Villanova University, Villanova PA 3 amphisbaenians, crocodiles, lizards, snakes and turtles) in Africa, quantify the 19085, USA, Natural History Museum of Zimbabwe, PO Box 240, Bulawayo, overlap in species richness of reptiles (and included groups) with the other ter- Zimbabwe, 4Museum National d’Histoire restrial vertebrate classes, investigate the environmental correlates underlying Naturelle, Department Systematique et these patterns, and evaluate the role of range size on richness patterns. Evolution (Reptiles), ISYEB (Institut Location Africa. Systematique, Evolution, Biodiversite, UMR 7205 CNRS/EPHE/MNHN), Paris, France, Methods We assembled a data set of distributions of all African reptile spe- 5Mosaic, (Environment, Health, Data, cies. We tested the spatial congruence of reptile richness with that of amphib- Technology), BP 35322 Yaounde, Cameroon, ians, birds and mammals. We further tested the relative importance of 6Department of African Biology, Royal temperature, precipitation, elevation range and net primary productivity for Museum for Central Africa, 3080 Tervuren, species richness over two spatial scales (ecoregions and 1° grids). We arranged Belgium, 7Royal Belgian Institute of Natural reptile and vertebrate groups into range-size quartiles in order to evaluate the Sciences, OD Taxonomy and Phylogeny, role of range size in producing richness patterns. -

Effectiveness of Phylogenomic Data and Coalescent Species-Tree Methods for Resolving Difficult Nodes in the Phylogeny of Advance
Molecular Phylogenetics and Evolution 81 (2014) 221–231 Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Effectiveness of phylogenomic data and coalescent species-tree methods for resolving difficult nodes in the phylogeny of advanced snakes (Serpentes: Caenophidia) ⇑ R. Alexander Pyron a, , Catriona R. Hendry a, Vincent M. Chou a, Emily M. Lemmon b, Alan R. Lemmon c, Frank T. Burbrink d,e a Dept. of Biological Sciences, The George Washington University, 2023 G St. NW, Washington, DC 20052, USA b Dept. of Scientific Computing, Florida State University, Tallahassee, FL 32306-4120, USA c Dept. of Biological Science, Florida State University, Tallahassee, FL 32306-4295, USA d Dept. of Biology, The Graduate School and University Center, The City University of New York, 365 5th Ave., New York, NY 10016, USA e Dept. of Biology, The College of Staten Island, The City University of New York, 2800 Victory Blvd., Staten Island, NY 10314, USA article info abstract Article history: Next-generation genomic sequencing promises to quickly and cheaply resolve remaining contentious Received 7 January 2014 nodes in the Tree of Life, and facilitates species-tree estimation while taking into account stochastic gene- Revised 29 July 2014 alogical discordance among loci. Recent methods for estimating species trees bypass full likelihood-based Accepted 22 August 2014 estimates of the multi-species coalescent, and approximate the true species-tree using simpler summary Available online 3 September 2014 metrics. These methods converge on the true species-tree with sufficient genomic sampling, even in the anomaly zone. However, no studies have yet evaluated their efficacy on a large-scale phylogenomic data- Keywords: set, and compared them to previous concatenation strategies. -
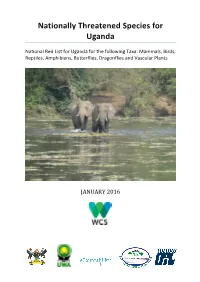
Nationally Threatened Species for Uganda
Nationally Threatened Species for Uganda National Red List for Uganda for the following Taxa: Mammals, Birds, Reptiles, Amphibians, Butterflies, Dragonflies and Vascular Plants JANUARY 2016 1 ACKNOWLEDGEMENTS The research team and authors of the Uganda Redlist comprised of Sarah Prinsloo, Dr AJ Plumptre and Sam Ayebare of the Wildlife Conservation Society, together with the taxonomic specialists Dr Robert Kityo, Dr Mathias Behangana, Dr Perpetra Akite, Hamlet Mugabe, and Ben Kirunda and Dr Viola Clausnitzer. The Uganda Redlist has been a collaboration beween many individuals and institutions and these have been detailed in the relevant sections, or within the three workshop reports attached in the annexes. We would like to thank all these contributors, especially the Government of Uganda through its officers from Ugandan Wildlife Authority and National Environment Management Authority who have assisted the process. The Wildlife Conservation Society would like to make a special acknowledgement of Tullow Uganda Oil Pty, who in the face of limited biodiversity knowledge in the country, and specifically in their area of operation in the Albertine Graben, agreed to fund the research and production of the Uganda Redlist and this report on the Nationally Threatened Species of Uganda. 2 TABLE OF CONTENTS PREAMBLE .......................................................................................................................................... 4 BACKGROUND ....................................................................................................................................