Ausgabe 48 Inhalt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

100 Years of Helmut Newton: the Making of SUMO and the Birth of BABY SUMO HELMUT NEWTON the BABY SUMO Edition
100 Years of Helmut Newton: The Making of SUMO and the Birth of BABY SUMO HELMUT NEWTON The BABY SUMO Edition The Making of Helmut Newton’s Helmut Newton checks a printing sheet during Frankfurt Book Fair, 1999. SUMO _065-240_TASCHEN_MAGAZIN_2020-1_GB_EU_37454.indb 180 01.10.20 15:17 _065-240_TASCHEN_MAGAZIN_2020-1_GB_EU_37454.indb 181 01.10.20 15:17 Over a period of two years, Helmut Newton and Benedikt Taschen exchanged letters, faxes, and phone calls to define details of the SUMO pro duc tion. At some point, not amused by the prospect of having to sign the entire print run of 10,000 copies, Newton tried to wrestle out of the agreement, Helmut Newton signing the pages which were suggesting to “maybe sign a few dozen” printing sheets. subsequently bound into SUMO. Monte Carlo, 1999. Photo by Photo: © Alice Springs / Maconochie Photography Photography Maconochie Maconochie / / Springs Springs Alice Alice © © Photo: Photo: Alice Springs. _065-240_TASCHEN_MAGAZIN_2020-1_GB_EU_37454.indb 182 01.10.20 15:17 _065-240_TASCHEN_MAGAZIN_2020-1_GB_EU_37454.indb 183 01.10.20 15:17 Benedikt Taschen with suite at the Sunset Helmut Newton, the book. At 620,000 the handmade dummy Marquis Hotel, Benedikt Taschen and deutschmarks it made of SUMO when first Hollywood, 1997. Photo auctioneer Simon de the world record price present ing his idea of by Helmut Newton. Pury after the auction of for a book published in producing a gigantic SUMO copy number the 20th century, Berlin, book to stunned Helmut one, signed by over 100 2000. Photo by Alice and June Newton in his celebrities portrayed in Springs. -

Ingressi Di Milano Curated by Karl Kolbitz Photographs by Matthew Billings, Paola Pansini, and Delfino Sisto Legnani
Press Release Ingressi di Milano Curated by Karl Kolbitz Photographs by Matthew Billings, Paola Pansini, and Delfino Sisto Legnani TASCHEN Store Milan (1st Floor Gallery), Via Meravigli 17 April 5 – June 18 2017 “One might call the ingressi Milan’s best-kept secret, the architectural equivalent of Poe’s purloined letter: a secret that is “prominently hidden” for all to see, and for a more restricted number to enter. With the ingressi, in fact, we are dealing with spaces that, by a peculiar logic of representation, start as passages to a given place but end up becoming their own destinations.” - Daniel Sherer TASCHEN is pleased to announce the opening of Ingressi di Milano, a new exhibition of photographs curated by Karl Kolbitz. The show is presented in parallel with the release of Kolbitz’s eponymous TASCHEN publication, an unprecedented look at Milan’s design DNA. Over the course of countless trips to Milan, Kolbitz’s exploration of the city’s eclectic aesthetics triggered the following, paradoxical question: in a city famous the world over as an exporter of design, how has its multitude of exuberant entryways remained so inconspicuous? In his book, Kolbitz opens the doors to these remarkable Milanese spaces, leading us through 144 of the city’s most sumptuous entrance halls dating from 1920 to 1970. At the intersection of art, architecture, and design, the collection showcases the work of some of the city’s most illustrious architects and designers, including Giovanni Muzio, Gio Ponti, Piero Portaluppi, and Luigi Caccia Dominioni, as well as non-pedigreed architecture of equal impact and interest. -

Tom of Finland
TOM OF FINLAND 1920-1991 born 1920, Kaarina, Finland EDUCATION 1946 Markkinointi-instituutti, Helsinki, Finland SELECTED SOLO EXHIBITIONS (* indicates a publication) 2021 Pen and Ink 1965 – 1989, David Kordansky Gallery, Los Angeles, CA Tom of Finland - The Darkroom, curated by Berndt Arell, Fotografiska, New York, NY 2020 Tom of Finland - The Darkroom, curated by Berndt Arell, Fotografiska, Tallinn, Estonia; Fotografiska, New York, NY; Fotografiska, Stockholm, Sweden Tom of Finland: Love and Liberation, presented by House of Illustration, Tom of Finland Foundation, and the Finnish Institute, House of Illustration, London, England Reality & Fantasy, The World of Tom of Finland, GALLERY X, Tokyo, Japan *Tom of Finland: Made in Germany, Galerie Judin, Berlin, Germany 2018 TOM House: The Work and Life of Tom of Finland, organized by Graeme Flegenheimer, Mike Kelley's Mobile Homestead, Museum of Contemporary Art Detroit, MI 2017 Touko Laaksonen – Tom of Finland: Of Music and Men, Waino-Aaltonen- Museum, Turku, Finland The Man Behind Tom of Finland: Loves and Lives, curated by Susanna Luoto, Salon Dahlmann, Berlin, Germany *The Man Behind Tom of Finland: Ecce Homo, curated Susanna Luoto, Galerie Judin, Berlin, Germany 2016 The Pleasure of Play, Kunsthalle Helsinki, Helsinki, Finland 2015 The Pleasure of Play, Artists Space, New York, NY [email protected] www.davidkordanskygallery.com T: 323.935.3030 F: 323.935.3031 Sealed with a Secret: Correspondence of Tom of Finland, Postimuseu, Tampere, Finland *Early Work 1944 – 1972, David Kordansky Gallery, Los Angeles, CA 2013 Tom of Finland Preliminary Drawings, Stuart Shave/Modern Art, London, England 2012 Tom of Finland, Kulturhuset, Stockholm, Sweden Tom of Finland: Male Masterworks, World Erotic Art Museum, Miami Beach, FL 2011 Tom of Finland: Public and Private, Antebellum, Hollywood, CA Tom of Finland: Original Drawings, PHD, St. -

JEFF KOONS Jeff Koons: the Sculptor
JEFF KOONS Jeff Koons: The Sculptor. Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt, Germany Née/Born – 1955, York, PA, USA Jeff Koons. Fondation Beyeler, Basel, Switzerland Vit et travaille/Lives and works – New York, NY, USA 2011 Moustache by Jeff Koons. High Museum of Art, Atlanta, GA, USA EDUCATION ARTIST ROOMS: Jeff Koons. National Galleries of Scotland, Edinburgh, UK 1976 BFA, Maryland Institute College of Art, 2010 Jeff Koons: Popeye Sculpture. Galerie de Noirmont, Baltimore, MD, USA Paris, France 1975-76 School of the Art Institute of Chicago, IL, USA Dictator. Gagosian Gallery, New York, NY, USA 1972-75 Maryland Institute College of Art, Baltimore, Jeff Koons: Cracked Egg (Blue). Conservatory, MD, USA Aylesbury, Waddesdon Manor, Buckinghamshire, UK EXPOSITION INDVIDUELLES SÉLECTIONNÉES 2009 Jeff Koons: New Paintings. Gagosian Gallery, Beverly SELECTED SOLO EXHIBITIONS Hills, CA, USA Jeff Koons: Popeye Series. Serpentine Gallery, London, 2017 Jeff Koons. Gagosian, Beverly Hills, CA, USA UK 2016 Jeff Koons. Almine Rech Gallery, London, UK 2008 Jeff Koons: Celebration. Neue Nationalgalerie, Berlin, Jeff Koons: Now. Newport Street Gallery, Germany London, UK Jeff Koons. Galerie Max Hetzler, Berlin, Germany 2015 Jeff Koons: Gazing Ball Paintings. Gagosian Gallery, Jeff Koons: Versailles. Château de Versailles, France New York, NY, USA Jeff Koons. Museum of Contemporary Art, Chicago, Jeff Koons: Balloon Venus (Orange). Natural History IL, USA Museum Vienna, Vienna, Austria Jeff Koons: On the Roof. Metropolitan Museum of Art, Jeff Koons In Florence. Palazzo Vecchio and Piazza New York, NY, USA della Signoria, Florence, Italy 2007 Jeff Koons: Popeye. Gagosian Gallery - Davies Street, Jeff Koons: A Retrospective. Guggenheim Museum London, UK Bilbao, Bilbao, Spain Jeff Koons: Hulk Elvis. -

The Kippenberger Conundrum: How the Wildly Prolific Artist’S Artist Became an Eight-Figure Auction Darling
The Kippenberger Conundrum: How the Wildly Prolific Artist’s Artist Became an Eight-Figure Auction Darling BY Nate Freeman POSTED 01/08/18 12:40 PM Martin Kippenberger. COURTESY TASCHEN It was the peak of the 2014 fall auction season in New York, and though nearly two decades had gone by since Martin Kippenberger’s death of liver failure in 1997, the artist’s market had never been hotter. Prior to its bellwether postwar and contemporary evening sale, Christie’s had set the estimate for a prized 1988 Kippenberger self-portrait in its November sale at $20 million—an aggressive estimate, but one that paid off. It was bought by dealer Larry Gagosian, hammering at $20 million for a with-premium total of $22.5 million. The sale capped a run of seasons where the Kippenberger market rose precipitously—an irony for an artist who lampooned both “try-hard” artists who sucked up to the market people and the market people who got suckered into buying any of it. All of Kippenberger’s top ten highest-selling works at auction have come in the last five years, and after the one-two punch of 1988 works sold at Christie’s in May and November 2014—the $22.5 million picture nabbed by Gagosian, but also another work from the same series that sold for $18.6 million—the same auction house sold two more Kippenbergers in May 2015: another 1988 self-portrait for $16.4 million, and one of his 1996 paintings of Jacqueline Picasso for $12.5 million. The “Picasso Paintings”—or, as they’re sometimes called, the “Underwear Paintings”—are perhaps Kippenberger’s most beloved series, based on photographs taken of Picasso, his hero, but self-effacing in tone. -

Media Contact
FOR IMMEDIATE RELEASE Friday, January 18, 2013 THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, LOS ANGELES (MOCA), ANNOUNCES 2012 ACQUISITIONS 117 significant objects added to museum’s renowned permanent collection through generous gifts and new acquisitions Two permanent collection exhibitions MOCA’s Permanent Collection: A Selection of Recent Acquisitions and A Point of View: Selected Gifts from the Lawrence A. Rickels Collection opening at MOCA Grand Avenue Los Angeles - The Museum of Contemporary Art announced today the acquisition of 117 important objects, adding to its renowned collection of more than 6,700 works. 2012 saw an extremely generous level of giving among its donors and artists, and the efforts of the museum’s Acquisition & Collection, Photography, and Drawings committees, as well as those of many philanthropic individuals and institutions have enabled MOCA to cultivate one of the premier collections of contemporary art in the world. ‚2012 was an extraordinary year for gifts and new acquisitions to the MOCA collection. Several major works acquired have been presented in recent MOCA exhibitions, including the original storyboard for Kenneth Anger’s seminal film Puce Moment, one of the great body prints by David Hammons, a large-scale gunpowder drawing by Cai Guo-Qiang, an installation by the late Mike Kelley donated as a gift from the artist, and the first work by Mark Bradford to enter the MOCA collection,‛ said MOCA Director Jeffrey Deitch. Among the 2012 acquisition highlights are; MOCA Announces 2012 Acquisitions Page 2 of 5 MAJOR GIFTS Continuing her generous tradition of giving, one of MOCA’s most engaged patrons and long-serving trustee Dallas Van Breda made a promised gift of Ghost and Stooges (2011), a new painting by Los Angeles artist Mark Bradford, recently presented at MOCA in The Painting Factory, and the first work by the artist to enter the museum’s permanent collection. -

Read Ebook {PDF EPUB} Moorish Architecture in Andalusia by Marianne Barrucand Moorish Architecture in Andalusia by Marianne Barrucand
Read Ebook {PDF EPUB} Moorish Architecture in Andalusia by Marianne Barrucand Moorish Architecture in Andalusia by Marianne Barrucand. This page is dedicated to the Muslims of Spain of 1492 who laid their lives to protect Andalus in the face of aggression while struggling to uphold Islam. ". I will forgive all the shortcomings and remove the evil deeds of those who were expelled from their homes or were persecuted for My sake and who fought for My cause and were slain. I shall admit them into Gardens underneath which rivers flow. This is their reward from Allah, and with Allah alone is the richest reward!" (Al-Qur'an, 3:195) 8 th -11 th Century map of Muslim Spain 15 th Century map of Christian Spain. Andalusia When It Was. A Muslim's Tour of Andalusia When the 'Moors' Ruled Spain Spain Prevents Teaching of Islam. Islamic Art Links. Islamic Spain 1250-1500 by L.P. Harvey Isabella (based on a true story) by Muhammad Saeed Dehlvi Muslim Spain: Its History and Culture by Anwar Chejne Al-Andalus: The Art of Islamic Spain edited by Jerrilynn D. Dodds Moorish Architecture in Andalusia by Marianne Barrucand Alhambra: A Moorish Paradise by Gabrielle Van Zuylen Tales of the Alhambra by Washington Irving Blood on the Cross: by Ahmad Thomson Moorish Style by Myles Danby. Muslim Spain's Legacy , by Abdullah Hakim Quick Deeper Roots: Muslims in the Americas before Columbus by A.H. Quick. The border reads "Wa La Ghalib Illa Allah" from right to left. This beautiful and powerful inscription written in Arabic surrounds the Alhambra walls. -

Martin Kippenberger
MARTIN KIPPENBERGER Born 1953 in Dortmund, Germany Died 7 March 1997 in Vienna SELECTED ONE-PERSON EXHIBITIONS 2006 Dieter Roth / Martin Kippenberger, Hauser & Wirth Coppermill, London Martin Kippenberger, Tate Modern, London Ihr Kippy Kippenberger, Baerbel Graesslin Gallery, Frankfurt (cat.) 2005 The Bermuda Triangle, Syros to Dawson City: The First Connection and 40 Drawings from the Collection of Michel Wurthle, Foundation 20 21, New York (cat.) Self-Portraits, Luhring Augustine, New York (cat.) 2003 Museum Für Neue Kunst, Karlsruhe. Germany (cat.) Venedig 2003 (with Candida Höfer), Venice Bienalle, German Pavillion, Venice (cat.) 2002 Martin Kippenberger– Hotel Drawings, David Zwirner, New York Martin Kippenberger– Metro-Net Projects, Beaumont-Public + König-bloc, Luxembourg Martin Kippenberger– Selected Works, Zwirner & Wirth, New York 2001 Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt Martin Kippenberger- ‘Bilder einer Ausstellung’, Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt 2000 Galerie Gisela Capitain, Cologne Metro Pictures, New York Martin Kippenberger: Hotel Drawings and The Happy End of Franz Kafka's 'Amerika', joint exhibition at The Smart Museum and The Renaissance Society, University of Chicago 1999 David Nolan Gallery, New York Martin Kippenberger: Self-portraits, The Happy End of Franz Kafka's 'America', Sozialkistentransport, Lanterns, etc., Deichtorhallen, Hamburg Together Again Like Never Before: The Complete Poster Works of Martin Kippenberger, 1301PE, Los Angeles 1998 Martin Kippenberger, MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles -
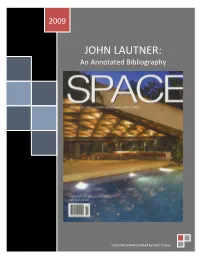
JOHN LAUTNER: an Annotated Bibliography
2009 JOHN LAUTNER: An Annotated Bibliography Compiled and Annotated by John Crosse Wolff Residence (see item 220.) 2 John Lautner: An Annotated Bibliography (Uncorrected Proof – Not for Sale) Chemosphere (Malin House) (see item 136.) Compiled and Annotated by John Crosse ©2009 modern-ISM Press 6333 Esplanade Playa del Rey, CA 90293 [email protected] 310-301-6339 3 Introduction The 2008 Hammer exhibition “Between Earth and Heaven: The Architecture of John Lautner” and Getty-Hammer Symposium “Against Reason: John Lautner and Postwar Architecture” created a flood of publicity and generated much renewed interest in Lautner‟s life and work. It also motivated me to look deeper into the literature for information on this unique and creative genius. A logical starting point for me was to perform a “Lautner” search in my 8,000 item “Julius Shulman Annotated Bibliography” prepared while researching a book on Shulman cover photos. The search resulted in 275 articles with Shulman photos of Lautner projects. Shulman has logged close to 75 assignments on Lautner projects over the years for various clients ranging from Lautner himself to book and article authors, magazine editors, newspaper reporters, exhibition curators, homeowners and realtors. He also used his considerable marketing skills and contacts with publishers and editors to help spread the gospel of modernism according to Lautner to a global audience. This bibliography compiles my Shulman-Lautner findings with the excellent bibliographic foundation laid by Ludolf von Alvensleben in the 1991 Viennese exhibition catalog “John Lautner: Architect: Los Angeles”, “John Lautner, Architect” with text by Lautner and edited by Frank Escher and the John Lautner Foundation web site. -

VISUAL ACOUSTICS Press Notes FINAL
Presents VISUAL ACOUSTICS “Case Study House #22.” Copyright J. Paul Getty Trust. A film by Eric Bricker RELEASE DATE: Oct. 9, 2009 in NYC at Cinema Village and Oct. 16, 2009 in LA at Landmark Nuart RUNNING TIME: 84 minutes RATING: Unrated OFFICIAL WEBSITE: www.arthousefilmsonline.com, www.juliusshulmanfilm.com Distributor Contact: Publicity Contact: Erin Owens Emma Griffiths Arthouse Films Emma Griffiths PR 80 Greene Street c/o HASTENS 449 Court Street #2L New York, NY 10012 Brooklyn, NY 11231 [email protected] [email protected] 212.966.1760 917.806.0599 FILMMAKERS Director ERIC BRICKER Producer ERIC BRICKER Producer BABETTE ZILCH Production Consultant KAREN LEE ARBEENY Executive Producer LISA HUGHES MICHELLE OLIVER Co-Producer WILL PAICE FREDERIC LIEBERT Associate Producer ROSE NIELSEN Director of Photography AIKEN WEISS DANTE SPINOTTI Editor CHARLTON MCMILLAN Composer CHARLIE CAMPAGNA Writer ERIC BRICKER PHIL ETHINGTON Co-Writer JESSICA HUNDLEY LISA HUGHES Design and Animation TROLLBACK + COMPANY 2 FEATURING JULIUS SHULMAN Narrated by DUSTIN HOFFMAN with FRANCES ANDERTON CATHERINE MEYLER WIM DE WIT KIMBERLI MEYER HERNAN DIAZ-ALONSO RAYMOND RICHARD NEUTRA FRANK ESCHER ROSE NIELSEN GEORGE FENNEMAN JUERGEN NOGAI TOM FORD MARK SCHINDLER CARLOS VON FRANKENBERG CHRIS SHANLEY FRANK O. GEHRY DANTE SPINOTTI MITCH GLAZER PIERLUIGI SERRAINO BETH EDWARDS HARRIS BUCK STAHL THOMAS S. HINES CARLOTTA STAHL SHARON JOHNSTON JOSEPH ROSA RAY KAPPE ROB ROTHBLATT CRAIG KRULL ED RUSCHA MARK LEE ANGELIKA TASCHEN RICARDO LEGORRETA BENEDIKT TASCHEN IRENE LOTSPEICH-PHILLIPS KAZYS VARNELIS JANICE LYLE MICHAEL WEBB KELLY LYNCH LEIGH WIENER LEO MARMOL E. STEWART WILLIAMS JUDY MCKEE ALINKA ZABLUDOVSKY 3 SYNOPSIS Narrated by Dustin Hoffman, VISUAL ACOUSTICS celebrates the life and career of Julius Shulman, the world’s greatest architectural photographer, whose images brought modern architecture to the American mainstream. -

California Dreamin': Walton Ford Explores
ARTnews November 30, 2017 GAGOSIAN California Dreamin’: Walton Ford Explores Golden State Origin Myths at Gagosian Beverly Hills Nate Freeman Walton Ford, Ars Gratia Artis, 2017. PHOTO: © TOM POWELL. ART: © WALTON FORD/COURTESY GAGOSIAN The book publisher and collector Benedikt Taschen lives in a John Lautner–designed Los Angeles home dubbed the Chemosphere, and on a late September morning, the Chemosphere was under attack by deep-fanged giant saber-toothed tigers emerging from the tar pits. The creatures came out of the black muck and galloped up the hills, the blinking city behind them, and when they approached the base of the modernist icon of architecture, they found a fair- skinned mountain lion to make prey. Claws out, saliva oozing down teeth, the big cats prepared to feast. “In the classic Hollywood horror film pitch, I’m saying, the animals rise out of the pits and come and attack contemporary L.A.,” said Walton Ford, who had painted the narrative of rampaging beasts as a masterful triptych called La Brea (2016). We were standing in the Gagosian space on West 21st street in New York, looking at the work that would make up “Calafia,” Ford’s show currently up at Gagosian in Beverly Hills through December 16. “It’s some dumb concept pitch that’s kind of like Sharknado,” Ford went on, referring to a made- for-TV movie in which there is a tornado filled with sharks. “Unbeknownst to L.A. this thing is happening, and they’re coming across the hill. And the first victim is the mountain lion being killed by the saber-toothed tiger right at the foot of the Chemosphere—my friend Benedikt Tachen’s house. -

DIAN HANSON Line of Graphite, Touko Laaksonen Changed How the World Perceived the Homosexual Male.” — Instinct Magazine, U.S
“With a subtle and playful curved DIAN HANSON line of graphite, Touko Laaksonen changed how the world perceived the homosexual male.” — Instinct magazine, U.S. The artist: Touko Laaksonen, who would become Tom of Finland (1920- THE ART OF MAKING BOOKS 1991), began drawing cartoons at age five. His experiences as a young OF FINLAND soldier in WWII provided much of his artistic inspiration, and while he worked OF FINLAND TASCHEN’s Great Adventure began back in 1980, when eighteen-year-old in the Finnish advertising industry, he secretly created erotic drawings of Benedikt Taschen opened a shop in his native Cologne, Germany, to market his hyper-masculine men. His work first appeared in the American magazine massive comics collection. Within a year he began publishing catalogues pro- Physique Pictorial in 1957 and the Tom of Finland legend was born. Tom’s art moting his wares, but it wasn’t until 1984 that his first art-book breakthrough continues to play an important role in promoting self-confidence, positive occurred: he purchased 40,000 remainder copies of a Magritte book printed in self-image and openness in the gay community. English, reselling them for a fraction of their original price. From a young age, Taschen had been interested in art but found that art books were too expensive The editor: Dian Hanson was a 25-year veteran of men’s magazine THE COMICS VOLUME I and hard to obtain, and the success of this daring move proved that Taschen publishing before becoming TASCHEN’s Sexy Book editor in 2001. Her was not alone in thinking that the art-book market should be democratized.