Volltext (1331Kb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Study of Selected Works of Ignaz Joseph Pleyel
The Woman's College of The University of North Carolina LIBRARY CQ no. Ml COLLEGE COLLECTION Gift of Rachel Elizabeth Mu^eon y A STUDY OF SELECTED WORKS OF IGNAZ JOSEPH PLEYEL by Rachel Elizabeth Hudson A Thesis Submitted to the Faculty of the Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree '... Master of Education in Music Education Greensboro July, 1964 Approved by f-GL Director • h APPROVAL SHEET This thesis has been approved by the following committee of the Faculty of the Graduate School at the University of North Carolina at Greensboro. Greensboro, North Carolina. Thesis Director Oral Examination Committee Members %^McA^ $££* %6-L**<L-^ July 17, 1964 2703 Date of Examination ii HUDSON, RACHEL ELIZABETH. A Study of Selected Works of Ignaz Joseph Pleyel. (1964) Directed by: Dr. Lee Rigs by. 165 pp. The purpose of this study is to help fulfill a need in keyboard instruc - tion for more materials which are both worthy and exemplary of the period they reflect. For students in the intermediate grades, much of the literature re- flecting the classic style of the eighteenth century is far too difficult in its technical and interpretive demands. This is not true of many of the composi- tions of Ignaz Joseph Pleyel, but unfortunately his works fell into oblivion during the early nineteenth century and have up to the present played a very small role in the performing repertoire. The present discussion deals first with the biography of Pleyel, describ- ing his life as a composer and later as a successful business man. -

SCRIPT LISZT & CHOPIN in PARIS.Pdf
LISZT & CHOPIN IN PARIS Written by John Mark Based on Actual Events Tel. (941) 276-1474 e-mail:[email protected] FIRST/2 /201 DRAFT 03 7 6 LISZT & CHOPIN IN PARIS 1 EXT. ISOLA BELLA. LAKE MAGGIORE - DAY 1 Three shadowy silhouettes in a small boat dip their oars into glassy surface of the lake heading towards the island. REPORTER and his ASSISTANT step on the ground, as the sun sets on the baroque garden in front of large castle. REPORTER (knocking loud on the front door) Hello.... Anyone there? BUTLER opens the door the reporter flashes his card. REPORTER (CONT’D) Good evening! I’m from Le Figaro and we came to see Mister Rachmaninoff. Butler closes the door half way. BUTLER He’s not here Sir. You just missed them. REPORTER Do you know where they are? BUTLER Yes. They’re leaving Europe. CUT TO 2 EXT. HÔTEL RITZ-PARIS - DAY 2 A crowd of PAPARAZZI floods vintage, four-door M-335 cabriolet as it comes to STOP. SERGEI RACHMANINOFF (65) and his wife NATALIA SATINA (62) exit the car and walk to the front door in the attempt to leave the flashing photographers behind them. TITLES ROLL: PARIS 1939. PAPARAZZO #1 (following them to the door) Welcome to the Ritz Monsieur Rachmaninoff. 2. PAPARAZZO #2 We heard you’re leaving Europe. CAMERA MOVES ALONG as CROWD in the lobby intensifies and paparazzi flash their cameras. As the composer and his wife pass through the door, the throng of paparazzi gets narrower while they keep snapping pictures following them to the elevator. -

Le Pianiste: Parisian Music Journalism and the Politics of the Piano, 1833–35
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2016 Le Pianiste: Parisian Music Journalism and the Politics of the Piano, 1833–35 Shaena B. Weitz Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/760 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] LE PIANISTE: PARISIAN MUSIC JOURNALISM AND THE POLITICS OF THE PIANO, 1833–35 By SHAENA B. WEITZ A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York Graduate Center 2016 ii © 2016 SHAENA B. WEITZ All Rights Reserved iii LE PIANISTE: PARISIAN MUSIC JOURNALISM AND THE POLITICS OF THE PIANO, 1833–35 By SHAENA B. WEITZ This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Musicology to satisfy the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy Janette Tilley ___________________ ____________________________________ Date Chair of Examining Committee Norman Carey ___________________ ____________________________________ Date Executive Officer Anne Stone Richard Kramer Dana Gooley Supervisory Committee THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iv Abstract LE PIANISTE: PARISIAN MUSIC JOURNALISM AND THE POLITICS OF THE PIANO, 1833–35 By Shaena B. Weitz Advisor: Anne Stone This dissertation examines the French music journal entitled Le Pianiste, published in Paris from 1833 to 1835. -
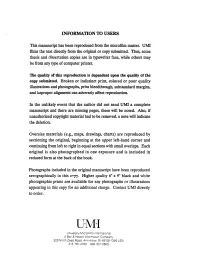
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality af this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignmentcan adversely afreet reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI University Microfilms International A Beil & Howell information C om pany 300 Nortfi Z eeb Roac. Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313 761-4700 800 521-0600 Order Number 91S04S0 Sîgîsmimd Thalberg (1812—1871), forgotten piano virtuoso: His career and musical contributions Hominick, Ian Glenn, D.M.A. -

Masha Dimitrieva Camille Pleyel · Klavierwerke
Camille Pleyel · Klavierwerke Masha Dimitrieva Camille Pleyel (1788–1855) Ein genialer Sohn eines Camille komponierte bis 1830 um die 50 genialen Vaters Werke. Camilles Eltern erkannten bald, dass er das Talent seines Vaters geerbt hatte; er besaß Camille Pleyel sowohl dessen musikalische Anlagen als auch die unternehmerischen Begabungen. Camille 1 « Le Matelot » Caprice sur une Romance favorite de Madame Duchambge Joseph Stephan Camille Pleyel, genannt Camille, entwickelte sich schon als Schüler seiner Eltern G-Dur op. 38 (1824) PN 1679 8:28 der grandiose Klavierbauer, Verleger, Kompo- sehr vorteilhaft. Später, nachdem er Eleve von nist und begnadete Pianist, war das älteste Kind Johann Ludwig Dussek (= Jan Ladislav Dusík; « Un Troubadour Béarnais » avec Variations, Introduction et Finale von Ignaz Joseph Pleyel (*1757 Ruppersthal, 1760–1812), Daniel Gottlieb Steibelt (1765-1823) g-Moll op. 1 (1816) PN 1190 Niederösterreich; †1831 bei Paris) und Gabrielle und Friedrich Wilhelm Kalkbrenner (1785–1849) 2 I. Introduzione 0:47 Pleyel, geb. Lefèbvre. „Er hat eine musikalische gewesen war, wurde er zu einem der besten 3 II. Variaziones I - IX 9:28 Seele“, sagte sein Vater. Pianisten seiner Zeit. Und er sollte auch ein Ludwig van Beethoven schrieb an Ignaz und anerkannter Komponist und sehr erfolgreicher 4 Nocturne à la Field B-Dur op. 52 (1828) PN 1777 4:22 Camille Pleyel in Paris am 26. April 1807: Unter nehmer werden. Am 5. April 1831 heirate- Mein lieber verehrter Pleiel – Was machen te er die hervorragende Pianistin Marie-Félicité- sie, was ihre Familie, ich habe schon oft ge- Denise Moke, genannt Camilla (1811–1875), die 5 Blanding af Arier uddragene af Rossinis Operaer N. -

Marie Pleyel Gehörte Zu Den Berühmtesten Klaviervirtuo- Sinnen Des 19
Pleyel, Marie Marie Pleyel gehörte zu den berühmtesten Klaviervirtuo- sinnen des 19. Jahrhunderts. Sie konzertierte in den wichtigsten Metropolen Europas und wurde wegen ihres klaren und zugleich ausdrucksvollen Spiels sowie ihrer besonderen Ausstrahlung und Schönheit von Publikum und Presse sehr geschätzt. Ihr hohes künstlerisches Nive- au, das auf ihre Studien bei Ignaz Moscheles und Fried- rich Kalkbrenner sowie den lebenslangen Willen der Künstlerin, an sich und ihrer Pianistik zu arbeiten, zu- rückzuführen ist, erlaubte es ihr, die schwierigsten und brillantesten Werke aufzuführen und stellte sie auf eine Stufe mit Franz Liszt und Sigismund Thalberg. Während ihrer Lehrtätigkeit am Konservatorium in Brüs- sel (1848-1872) war sie für insgesamt 482 Schülerinnen verantwortlich und baute eine Klavierklasse auf, die euro- paweit bekannt wurde. Sie war Auftraggeberin und Widmungsträgerin mehrerer Werke, u.a. sind ihr die „3 Nocturnes, op. 9“ von Frédé- ric Chopin, sowie die „Réminiscences de Norma“ von Franz Liszt zugeeignet. Als Komponistin verfasste Marie Pleyel mehrere Werke, die sie im Rahmen ihrer Konzerte auch öffentlich vort- rug. Kritiken lassen jedoch annehmen, dass ihr komposi- Marie Pleyel. Lithografie von Marie Alexandre Alophe (Paris: torisches Schaffen weit hinter ihrem pianistischen Kön- Bertauts) nen zurückblieb. Bekannt wurde Marie Pleyel auch wegen ihrer großen Sc- Marie Pleyel hönheit. Zahlreiche Beziehungen mit bekannten Män- Geburtsname: Camille Marie Denise Moke nern des damaligen Kulturlebens, unter ihnen Ferdinand Hiller, Hector Berlioz, Franz Liszt sowie Gérard de Ner- * 4. September 1811 in Paris, Frankreich val und Alfred Tattet, werden ihr nachgesagt. † 30. März 1875 in Brüssel, Belgien Orte und Länder Pianistin, Klavierpädagogin, Komponistin, Professorin, Die ersten Auftritte von Marie Pleyel, zu dieser Zeit noch Konzertveranstalterin als Camille Moke bekannt, fanden 1825 in Brüssel, Gent und Paris statt. -

Compositori Mitteleuropei E La Nascita Di Un Virtuosismo Pianistico Francese
CONVEGNO INTERNAZIONALE COMPOSITORI MITTELEUROPEI E LA NASCITA DI UN VIRTUOSISMO PIANISTICO FRANCESE Roma, Istituto Storico Austriaco e Villa Medici 11-13 Ottobre 2012 ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON CENTRO STUDI OPERA OMNIA LUIGI BOccHERINI www.luigiboccherini.org CONVEGNO INTERNAZIONALE COMPOSITORI MITTELEUROPEI E LA NASCITA DI UN VIRTUOSISMO PIANISTICO FRANCESE Organizzato da Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca Istituto Storico Austriaco, Roma Accademia di Francia a Roma - Villa Medici in collaborazione con Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, Venezia Haute École de Musique, Genève Istituto Storico ‘Fraknói’, presso l’Accademia d’Ungheria in Roma Roma, Istituto Storico Austriaco e Villa Medici 11-13 Ottobre 2012 Comitato Scientifico Richard Bösel, Roma Rémy Campos, Genève/Paris Éric de Chassey, Roma Alexandre Dratwicki, Venezia Pierre Goy, Genève/Fribourg Roberto Illiano, Lucca Annick Lemoine, Roma Fulvia Morabito, Lucca Massimiliano Sala, Lucca Rohan H. Stewart-MacDonald, Leominster, uk KEYNOTE SPEAKERS Leon Plantinga, New Haven, ct, usa Pierre Goy, Genève/Fribourg GIOVEDÌ 11 OTTOBRE (Istituto Storico Austriaco, Viale Bruno Buozzi 111-113, Roma) ore 9.30-10.00 Benvenuto e registrazione 10.00-10.30 Saluti • RICHARD BÖSEL (Direttore, Istituto Storico Austriaco) • ANNICK LEMOINE (Responsabile dipartimento di storia dell’arte, Accademia di Francia a Roma) • ETIENNE JARDIN (Coordinatore scientifico dei convegni, Palazzetto Bru Zane, Venezia) • MASSIMILIANO SALA (Presidente, Centro Studi Opera