Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

President's Message
Fédération Internationale de l'Activité Physique Adaptée International Federation of Adapted Physical Activity Volume 19, Number 3 July, 2011 NENEWWSSLETTELETTERR www.ifapa.biz President’s Message Dear Colleagues, It is a great honor and a real pleasure to write this first President’s message. I joined IFAPA in 1999. Since then I have been implicated in the life of IFAPA as the European Representative, then Vice-President and President Elect since ISAPA 2009 in Gävle. Shayke Hutzler gave me the “hammer,” symbol of the Presidency, during the closing ceremony of ISAPA 2011 in Paris. I wish to thank all Past-Presidents who shared with me their passion, their ideas and perspectives, and gave me their entire support. They will continue to be involved with the board of IFAPA as mentors, advisers in the scope of the Past President Council Claire Boursier implemented during ISAPA 2011. My wish as President of IFAPA is to develop our federation in all regions of the world, especially in Africa and South America. The role of the regional representatives will be crucial on this regard as well as the student representative. To help them, one of the Vice-Presidents will be in charge of the develop- ment, and in all regions a student will be nominated to second the regional representatives and the IFAPA board students’ representative. I wish to welcome all new board members and thank all the ones whose turn finished. Another main challenge to develop IFAPA is linked to language. Translating the main issues (newsletters, articles, proceedings of ISAPAs, etc.) in diverse languages will be a priority. -

IPC Athletics Open European Championships Espoo 22.8.2005-27.8.2005 Men F11 Discus Final Results 25.8.2005 12:30
10. EPC-Europameisterschaft Leichtathletik, Espoo/FIN, 17.-28.08.2005 Name Verein Bdl. Bewerb Klasse Leistung Platzierung Bauer Mario VSG St. Pölten NÖ 800m T 46 2.10,97min 6. 1500m 4.19.18min 7. 4x100m Staffel DNF DNF Dubin Wolfgang VSC ASVÖ Wien W Kugel F 36 11,16m Silber Diskus 25,70m Bronze Ferchl Gottfried RSCTU T 100m 18,15sec 5. 200m 31,80sec Gold 400m 57,13sec 5. 800m 1.56,38min 5. Marathon krank DNS Gaggl Stefan VSC Villach K 100m T 46 11,83sec Bronze 200m 24,35sec SF 4x100m Staffel DNF DNF Geierspichler Tom RSV Salzburg S 400m T 52 1.05,60min Gold 800m u. 1500m krank krank Linhart Michael NÖVSV NÖ 100m T 44 12,28sec 5. 200m 25,85sec 5. 4x100m Staffel DNF DNF Marinkovic Bil ABSV Wien W Speer F 11 46,54m Bronze Diskus 38,46m Silber Mayer Robert BSRO T 100m T 44 12,18sec 4. 200m 25,06sec Bronze 400m 54,72sec Gold 4x100m Staffel DNF DNF Monschein Willibald VSC ASVÖ Wien W Diskus F 11 33,48m 5. Kugel 11,92m Bronze Scherney Andrea ABSV Wien W Diskus T/F 44 35,62m Bronze Kugel 11,03m Silber Weitsprung 5,31m Gold Tischler Georg BBSV B Kugel F 54 9,35m Silber Wliszczak Dennis NÖVSV NÖ Hochsprung F 42 165cm Silber IPC Athletics Open European Championships Espoo 22.8.2005-27.8.2005 Men F11 Discus final Results 25.8.2005 12:30 Posn Name Nationality L/O Result 1 David Casinos F11 Spain 1972 3 38,77 37,71 38,77 X 36,50 37,79 X 2 Bil Marinkovic F11 Austria 1973 8 38,46 25,52 37,95 38,12 38,46 36,03 36,64 3 Volodymyr Piddubnyy F11 Ukraine 1966 6 34,01 28,00 X X 28,92 34,01 X 4 Yuriy Piskov F11 Ukraine 1969 2 33,92 29,51 29,73 31,41 23,89 33,92 -

2020 Virgin Money London Marathon 2020 Virgin Money London Marathon 1
2020 Virgin Money London Marathon 2020 Virgin Money London Marathon 1 CONTENTS 01 MEDIA INFORMATION Page 5 ELITE MEN 42 The Events & Start Times 6 Entries 42 Media Team Contacts 6 Awards & Bonuses 42 Media Facilities 6 Preview 43 Press Conferences 6 Biographies 44 The London Marathon Online 7 Olympic Qualifying Standard 54 Essential Facts 8 What’s New in 2020 10 ELITE WHEELCHAIR PREVIEW 55 The Course 11 Wheelchair Athletes 56 Stephen Lawrence Charitable Trust 11 Abbott World Marathon Elite Race Route Map 12 Majors Accumulator 56 Pace Guide 13 T54 Women Entries 56 Running a Sustainable Marathon 14 Biographies 57 London Marathon Events Limited 15 T54 Men Entries 59 Biographies 60 02 THE 40TH RACE 16 How It All Began 17 05 ABBOTT WORLD Four Decades of Marathon Moments 19 MARATHON MAJORS 65 The Ever Presents 23 How It Works 66 Qualifying Races 67 03 CHARITIES, FUNDRAISING AbbottWMM Wanda Age Group & THE TRUST 25 World Championships 67 Charities & Fundraising 26 The Abbott World Marathon 2020 Charity of the Year – Mencap 27 Majors Races 68 The London Marathon Charitable Trust 33 Abbott World Marathon Majors Series XIII (2019/20) 74 04 ELITE RACES 31 Abbott World Marathon Majors Wheelchair Series 76 ELITE WOMEN 32 Entries 32 Awards & Bonuses 32 Preview 33 Biographies 34 CONTENTS CONTINUED >> 2020 Virgin Money London Marathon 2 06 THE MASS EVENT 79 BRITISH MARATHON STATISTICS 119 Starters & Finishers 80 British All-Time Top 20 119 2020 Virgin Money British Record Progression 120 London Marathon Virtual Race Stats 81 The Official Virgin Money -
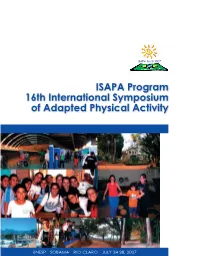
ISAPA Program 16Th International Symposium of Adapted Physical Activity
ISAPA Brazil 2007 ISAPA Program 16th International Symposium of Adapted Physical Activity UNESP - SOBAMA - RIO CLARO - JULY 24-28, 2007 ISAPA Brazil 2007 Program ISAPA Brazil 2007 is organized by the Sao Paulo State University (UNESP) and supported by the Brazilian Society of Adapted Motor Activity (Sobama). © Copyright 2007 ISAPA Brazil 2007 ISAPA Brazil 2007 Program Editors and Publishers Eliane Mauerberg-deCastro Debra Frances Campbell Sponsors and supporters UNESP Instituto de Biociências Departamento de Educação Física Ministério do Esporte Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 1 ISAPA Location ............................................................................................................................................. 6 ISAPA Committees ........................................................................................................................................ 9 ISAPA’s Invited Guests ............................................................................................................................... 12 Awards ........................................................................................................................................................... 28 Pre-Conference Activities ......................................................................................................................... 32 Cultural Activities ....................................................................................................................................... -

Magisterarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Magisterarbeit Titel der Magisterarbeit Medienberichterstattung im Behindertensport. – Ein Vergleich von österreichischen und deutschen Medien zur Zeit der Paralympics in Peking 2008. Verfasserin Julia Lebersorg (Bakk. rer. nat.) angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Wien, im Jänner 2009 Studienkennzahl It. Studienblatt: A 066 826 Studienrichtung It. Studienblatt: Magisterstudium Sportwissenschaft Betreuerin: Ass. Prof. Mag. Dr. Maria Dinold Vorwort: Ich möchte mich hiermit bei meiner Betreuerin, Frau Prof. Maria Dinold, für die nützlichen Ratschläge und die unterstützende Literatur bedanken. Weiters danke ich dem Medienreferat des Instituts für Sportwissenschaft, welches mir die zu analysierenden Medien aufgenommen und zu Verfügung gestellt hat. Besonderer Dank gilt selbstverständlich meinen Eltern, die mir mein Studium ermöglichten und finanzierten. Nicht nur während meiner Magisterarbeit, auch davor stützten sie mich mit Rat und Tat. Ein Dankeschön an alle, die mir beim Sammeln des Zeitungs- und Videomaterials geholfen haben. 2 Inhaltsverzeichnis : 1. Einleitung .......................................................................................................................... 6 2. Ansätze und Definitionen zum Begriff ‚Behinderung’ ......................................................... 8 2.2. Entstehung des Begriffes und die Abgrenzung von ......................................................... -
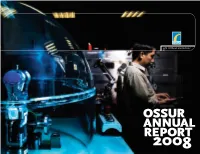
Ossur Annual Report 2008
key figures total sales research and development sales by geography 350 25 Asia 300 4% 20 250 Americas US Dollars in Millions 15 US Dollars in Millions 46% 200 150 10 100 5 50 EMEA 0 0 50% 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 ebitda eps & cash eps sales by segment 15 80 Other 12 Compression 2% 70 therapy 6% 60 Prosthetics 9 50 US Dollars in Millions US cents per share 41% 40 6 30 3 20 10 Bracing 0 2004 2005 2006 2007 2008 & supports 0 51% 2004 2005 2006 2007 2008 EPS Cash EPS table of contents overview 2008 annual report 2008 the year was characterized by internal focus. in 2008, focusing on processes and profitability was 02 CEO’s address one of ossur’s Main tasks. twenty products were discontinued and profits increased. 04 Strategy 06 Market and environMent the total sales aMounted to usd 350 Million, representing a 4% growth. no acquisitions were 10 prosthetics Made in 2008. earnings before interest, tax, depreciation and aMortization (EBITDA) aMounted to 11 Bionics usd 79 Million or 23% of sales. earnings increased by usd15 Million. 12 Operations 18 locations growth in the sales of prosthetics continues, increasing 9%, which confirMs ossur’s strong 20 Bracing and supports & coMpression therapy position in this Market segMent, and the coMpany’s technical leadership. growth in the sales of 22 TeaM ossur bracing and supports was 1% and sales of coMpression therapy products grew by 5%. 24 Research and developMent 28 HuMan resources working capital froM operating activities increased by 32% and net cash provided by operating 30 Corporate social responsibility activities increased by 16% between years. -

Welcome to the Official Records Database for Para-Athletics for Athletes with Disabilities
Welcome to the official Records Database for Para-Athletics for Athletes With Disabilities While we endeavour to monitor performances of known athletes through results, not all records and results can be identified and coaches and athletes should take some responsibilty if a record has been set or broken to complete the records claim forms. These are available to download on the Athletics Australia website. Records: Records set at Athletics Australia National Open and Age events will be produced automatically. Records set at IPC and INAS International events will be processed automatically. Records set at others times will require claim forms including all details. Athletes with a National Review status will be ineligible for Records. Will be produced atwice a eah calendar year. (January/February and again in June/July) Records in blue and listed as (pending) means the record is awaiting IPC approval Some Records in purple may indicate a record has been beating but not sanctioned/verified by the IPC Age Ruling: Note: For all Athletics Australia (AA) events and records underage eligibility is determined by the athlete’s age at the completion of the calendar year in which the event is occurring. Eg: For an athlete to compete or claim an Under 18 record in 2018 they must not turn 18 during the 2018 calendar year! Contact: For further information contact: Neil Fuller, AA Athletes with a Disability (AWD) Statistician PO Box 1194, Kensington Gardens, SA 5068 E-Mail: [email protected] Mobile: 0433 518 461 The following links are for International Sports for the Disabled - Athletics Records IPC http://www.paralympic.org/Athletics/ResultsRankingsRecords IBSA http://www.ibsa.es/eng/deportes/athletics/records.htm IWAS http://athletics.iwasf.com/ CP-ISRA http://www.cpisra.org/html/sports/results.htm INAS http://www.inas.org Must be registrated athletes with AUSRAPID. -

Baseline Study “Participation & Exclusion of Displaced Youth with Disabilities in European Sport”
Baseline Study “Participation & Exclusion of Displaced Youth with Disabilities in European Sport” Output number O.1.1 Document’s title Baseline Study “Participation & Exclusion of Displaced Youth with Disabilities in European Sport” Nature1 R Dissemination Level 2 PU Author (email) Alice Bruni, - [email protected] Institution Camilla Baldini, Leading partner AttivaMente Participating partners ALL 1 R=Document, report; DEM=Demonstrator, pilot, prototype; DEC=website, patent fillings, videos, etc.; OTHER=other 2 PU=Public, CO=Confidential, only for members of the consortium (including the EACEA Services, if asked), CI=Classified, as referred to in Commission Decision 2001/844/EC Sports as a Tool for Empowerment of (Dis)Abled & Displaced Youth Modifications Index Date Version 27/01/2020 1st Draft 05/02/2020 Revision and additions by HPC 27/02/2020 2nd Draft 26/03/2020 Final Revision and additions by HPC 1 | P a g e STEADY Project 603399-EPP-1-2018-1-EL-SPO-SCP This work is a part of the STEADY project. STEADY has received funding from the European Union’s Erasmus+ Sport programme under grant agreement no 2018-3286/001-001. Content reflects only the authors’ view and European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains. 2 | P a g e Sports as a Tool for Empowerment of (Dis)Abled & Displaced Youth Partners 3 | P a g e STEADY Project 603399-EPP-1-2018-1-EL-SPO-SCP ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ACRONYM EXPLANATION AT Austria BG Bulgaria DYD Displaced Youth with Disabilities EACEA Education, Audiovisual -

Magisterarbeit
Magisterarbeit Titel der Magisterarbeit Medienberichterstattung im Behindertensport. – Ein Vergleich von österreichischen und deutschen Medien zur Zeit der Paralympics in Peking 2008. Verfasserin Julia Lebersorg (Bakk. rer. nat.) angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Wien, im Jänner 2009 Studienkennzahl It. Studienblatt: A 066 826 Studienrichtung It. Studienblatt: Magisterstudium Sportwissenschaft Betreuerin: Ass. Prof. Mag. Dr. Maria Dinold Vorwort: Ich möchte mich hiermit bei meiner Betreuerin, Frau Prof. Maria Dinold, für die nützlichen Ratschläge und die unterstützende Literatur bedanken. Weiters danke ich dem Medienreferat des Instituts für Sportwissenschaft, welches mir die zu analysierenden Medien aufgenommen und zu Verfügung gestellt hat. Besonderer Dank gilt selbstverständlich meinen Eltern, die mir mein Studium ermöglichten und finanzierten. Nicht nur während meiner Magisterarbeit, auch davor stützten sie mich mit Rat und Tat. Ein Dankeschön an alle, die mir beim Sammeln des Zeitungs- und Videomaterials geholfen haben. 2 Inhaltsverzeichnis : 1. Einleitung .......................................................................................................................... 6 2. Ansätze und Definitionen zum Begriff ‚Behinderung’ ......................................................... 8 2.2. Entstehung des Begriffes und die Abgrenzung von .......................................................... ‚Behinderung’ zu Krankheit .................................................................................................. -

The Official Records Database for Para-Athletics for Athletes with Disabilities
Welcome to the official Records Database for Para-Athletics for Athletes With Disabilities While we endeavour to monitor performances of known athletes through results, not all records and results can be identified and coaches and athletes should take some responsibilty if a record has been set or broken to complete the records claim forms. These are available to download on the Athletics Australia website. Records: Records set at Athletics Australia National Open and Age events will be produced automatically. Records set at IPC and INAS International events will be processed automatically. Records set at others times will require claim forms including all details. Athletes with a National Review status will be ineligible for Records. Will be produced atwice a eah calendar year. (January/February and again in June/July) Records in blue and listed as (pending) means the record is awaiting IPC approval Some Records in purple may indicate a record has been beating but not sanctioned/verified by the IPC Age Ruling: Note: For all Athletics Australia (AA) events and records underage eligibility is determined by the athlete’s age at the completion of the calendar year in which the event is occurring. Eg: For an athlete to compete or claim an Under 18 record in 2018 they must not turn 18 during the 2018 calendar year! Contact: For further information contact: Neil Fuller, AA Athletes with a Disability (AWD) Statistician PO Box 1194, Kensington Gardens, SA 5068 E-Mail: [email protected] Mobile: 0433 518 461 The following links are for International Sports for the Disabled - Athletics Records IPC http://www.paralympic.org/Athletics/ResultsRankingsRecords IBSA http://www.ibsa.es/eng/deportes/athletics/records.htm IWAS http://athletics.iwasf.com/ CP-ISRA http://www.cpisra.org/html/sports/results.htm INAS http://www.inas.org Must be registrated athletes with AUSRAPID. -

Sportbericht 2003-2004 Sportbericht 2003-2004 Sportbericht 2 Von 319 III-301-BR/2006 Der Beilagen - Bericht - Hauptdokument
III-301-BR/2006 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 1 von 319 Republik Österreich Sportbericht 2003-2004 Sportbericht 2003-2004 Sportbericht 2 von 319 III-301-BR/2006 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 19. Sportbericht 2003-2004 Staatssekretariat für Sport 1010 Wien, Ballhausplatz 2 Sektion Sport 1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 12 www.sport.austria.gv.at [email protected] Herausgeber, Eigentümer und Verleger Bundeskanzleramt, Sektion Sport 1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 12 T +43 (1) 53 115-0 F +43 (1) 505 62 35 Für den Inhalt verantwortlich Sektionschef Mag. Robert Pelousek Abteilungsleiter Christian Felner Bearbeitung und Gestaltung im Rahmen einer Projektarbeit Cornelia Praxmarer Beiträge Bundeskanzleramt, Sektion Sport verschiedene Bundesministerien, Organisationen und Institutionen III-301-BR/2006 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument 3 von 319 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort des Herrn Bundeskanzlers …………………………………… 7 Vorwort des Herrn Staatssekretärs für Sport …………………………………… 9 Bundes-Sportförderungsgesetz 2005 …………………………………… 13 BUNDESKANZLERAMT – SEKTION SPORT Organisationsschema …………………………………… 22 Bundes-Sportförderung Grundlagen .................................................. 24 Allgemeine Bundes-Sportförderung .................................................. 25 Investitionsförderung .................................................. 25 Sonstige Förderungen .................................................. 25 Administration und Konsumation .................................................. 25 Österreichische Bundes-Sportorganisation -

Jean-Guy Talamoni
Lire page 18 www.lemonde.fr 57e ANNÉE – Nº 17128 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE -- MARDI 7 AOÛT 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Proche-Orient : guerre quotidienne Voyage dans le « cybersquat » b a De Ramallah De nombreuses personnalités et entreprises ont été dépossédées de leur nom sur Internet à Tel-Aviv : nouveau b De nouvelles catégories sont créées pour mettre de l’ordre sur le réseau b Les attributions de « .biz » week-end sanglant se terminaient lundi pour les marques déposées b La course mondiale aux noms de domaine est relancée PROTÉGER son nom sur Inter- droits. Les entreprises avaient ainsi a Israéliens net n’est pas chose aisée. Selon la jusqu’au lundi 6 août pour revendi- règle du « premier arrivé, premier quer les adresses se terminant par et Palestiniens servi », n’importe qui peut déposer «. biz » (pour « business »). Ce nou- SHAUN BEST/REUTERS un nom de site suivi de la célèbre veau suffixe fera son apparition en enfermés dans le cycle extension «. com ». On recense octobre, en même temps que ATHLÉTISME plus de 22 millions d’adresses avec «. info » et quelques semaines des violences cette terminaison. De nombreuses avant «. name ». Quatre autres personnalités et entreprises ont fait extensions dont «. museum » sui- Greene, pour a les frais de cette liberté absolue et vront dans les prochains mois. En Israël, ont eu maille à partir avec des L’introduction de ces nouvelles « squatteurs » du cyberespace. Au catégories ne fait pas l’unanimité. la troisième fois la renaissance d’un prix de longs procès, d’arbitrages Le directeur général de l’Associa- ou de négociations à l’amiable, tion française pour le nommage Le sprinter américain Maurice Gree- mouvement de la paix elles sont souvent parvenues à récu- Internet (Afnic) craint ainsi que ces ne a remporté pour la troisième fois pérer leur nom.