3. Flüchtlinge Der Nachkriegszeit in Oberösterreich 21
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
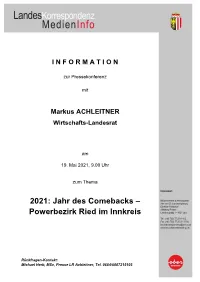
I N F O R M a T I O N
I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Markus ACHLEITNER Wirtschafts-Landesrat am 19. Mai 2021, 9.00 Uhr zum Thema 2021: Jahr des Comebacks – Powerbezirk Ried im Innkreis Rückfragen-Kontakt: Michael Herb, MSc, Presse LR Achleitner, Tel. 0664/6007215103 2 LR Achleitner ZUSAMMENFASSUNG: Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner unterwegs im Bezirk Ried im Innkreis: Powerbezirk Ried im Innkreis mit Wirtschaftskraft und schnellem Internet Corona-konform mit Maske und Abstand war Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner heute einen Tag lang im Bezirk Ried im Innkreis unterwegs und zeigte sich beeindruckt von der großen Dynamik im Bezirk: „2021 soll für Oberösterreich das Jahr des Comebacks werden. Wir arbeiten dafür, dass möglichst viele Menschen in Beschäftigung bleiben oder rasch wieder in Beschäftigung kommen, die Wirtschaft wieder volle Fahrt aufnimmt und die Unternehmen investieren“, erklärte Landesrat Achleitner. Der Bezirkstag fand genau am Tag der Öffnung von Gastronomie und Tourismus statt – deshalb wurde er auch ganz bewusst mit einem Pressegespräch beim „Rieder Wirt“ in Ried/Innkreis gestartet: „Heute endet der Lockdown endlich auch für die Tourismuswirtschaft und die Betriebe, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Gäste haben endlich wieder eine Perspektive. Gastronomie und Hotellerie freuen sich darauf, endlich wieder Gäste bewirten bzw. beherbergen zu können. Sie haben sich darauf auch entsprechend vorbereitet. Seitens des Landes unterstützen wir sie unter anderem mit „myVisitPass“, einem webbasierten App-System mit QR-Code zur Gästeregistrierung, das den Betrieben kostenlos zur Verfügung gestellt wird“, unterstrich Landesrat Markus Achleitner. Starke Unternehmen, verankert in der Region Verwurzelt in der Region, erfolgreich und innovativ, das zeichnet die Unternehmen HARTJES in Pramet und LÖFFLER in Ried aus, die Landesrat Achleitner besuchte. -

Verordnung Ried Im Innkreis.Pdf
Verordnung des Bundesdenkmalamtes betreffend den pol. Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich Auf Grund des § 2a des Denkmalschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 170/1999, wird verordnet: § 1. Folgende unbewegliche Denkmale des (pol. und Ger.-) Bezirkes Ried im Innkreis, die gemäß § 2 oder § 6 Abs. 1 leg.cit. kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, werden unter die Bestimmungen des § 2a Denkmalschutzgesetz gestellt: Bezeichnung Adresse EZ Gst.Nr. KG Gemeinde 4754 Andrichsfurt Friedhof 46 839 46101 Andrichsfurth Kriegerdenkmal 94 843 46101 Andrichsfurth Bildstock Pötting 139 811/2 46101 Andrichsfurth Kath. Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit 139 .120 46101 Andrichsfurth Bründlkapelle Hl. Dreifaltigkeit Pötting 139 .97 46101 Andrichsfurth Gemeinde 4980 Antiesenhofen Reichersberger Pfarrhof Straße 3 547 3115 46002 Antiesenhofen Kath. Pfarrkirche hl. Ägi- Reichersberger dius und Friedhof Straße OG 3158 548 .250, 3158 46002 Antiesenhofen Gemeinde 4971 Aurolzmünster Pfarrhof Rieder Straße 6 350 127/1 46104 Aurolzmünster Kath. Pfarrkirche hl. Mauritius 351 169/1 46104 Aurolzmünster Marktbrunnen Marktplatz, vor Nr. 32 370 270/10 46104 Aurolzmünster Gemeinde 4906 Eberschwang Pfarrhof, ehem. Tratten- bachsches Schlössl Eberschwang 8 8 310 46108 Eberschwang Elisabethkapelle 77 167 46108 Eberschwang Kath. Pfarrkirche Eberschwang hl. Michael OG. 18 384 .18 46108 Eberschwang Gemeinde 4971 Eitzing Pfarrhof, Kindergarten Eitzinger Pl. 4 126 .36 46109 Eitzing Kath. Pfarrkirche Mariä Kirchenplatz Himmelfahrt und Friedhof OG. 52 392 .52, 713 46109 Eitzing Gemeinde 4922 Geiersberg Kath. Pfarrkirche hl. Leonhard 331 .1 46113 Geiersberg Brunnenkapelle Geiersberg 367 2096/2 46113 Geiersberg Pestkapelle Pramerdorf 383 .204 46113 Geiersberg Gemeinde 4943 Geinberg Pfarrhof, ehem. Gemeinde- amt Kirchenplatz 4 221 536/10 46010 Geinberg Kath. Pfarrkirche hl. Michael, Friedhof und Friedhofsmauer Kirchenplatz 1 482 526 46010 Geinberg Rotes Kreuz 493 1790 46010 Geinberg Gemeinde 4942 Gurten Bezeichnung Adresse EZ Gst.Nr. -

MASI-Termine Bezirk Braunau 2021 (Pdf)
MASI-Termine 2021 KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort 1 MO 28. Dez Pischelsdorf a. E. 5 MO 25. Jan Pischelsdorf a. 9 MO 22. Feb Pischelsdorf a. 13 MO 22. Mrz Pischelsdorf a. 17 MO 19. Apr Pischelsdorf a. 21 MO 17. Mai Pischelsdorf a. E. 25 MO 14. Jun Pischelsdorf a. E. 1 DI 29. Dez St. Johann 5 DI 26. Jan Handenberg 9 DI 23. Feb Maria Schmolln 13 DI 23. Mrz St. Johann 17 DI 20. Apr Handenberg 21 DI 18. Mai Maria Schmolln 25 DI 15. Jun St. Johann 1 MI 30. Dez Franking 5 MI 27. Jan Auerbach 9 MI 24. Feb Franking 13 MI 24. Mrz Auerbach 17 MI 21. Apr Franking 21 MI 19. Mai Auerbach 25 MI 16. Jun Franking 1 DO 31. Dez FEIERTAG 5 DO 28. Jan Neukirchen a. E. 9 DO 25. Feb Neukirchen a. E. 13 DO 25. Mrz Neukirchen a. E. 17 DO 22. Apr Neukirchen a. E. 21 DO 20. Mai Neukirchen a. E. 25 DO 17. Jun Neukirchen a. E. 1 FR 01. Jan FEIERTAG 5 FR 29. Jan Lochen 9 FR 26. Feb Mauerkirchen 13 FR 26. Mrz Lochen 17 FR 23. Apr Mauerkirchen 21 FR 21. Mai Lochen 25 FR 18. Jun Mauerkirchen 2 MO 04. Jan Kirchberg b. M. 6 MO 01. Feb Kirchberg b. M. 10 MO 01. Mrz Kirchberg b. M. 14 MO 29. Mrz Kirchberg b. -
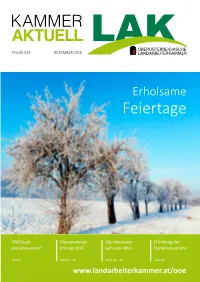
Feiertage Pixelio by M
FOLGE 319 DEZEMBER 2016 Erholsame Feiertage Pixelio by M. Großmann by Pixelio PREGnant Dienstnehmer- Alle Pensionen Erhöhung der „Verschwunden“ Ehrung 2016 auf einen Blick Darlehenssumme Seite 3 Seite 4 – 11 Seite 14 – 15 Seite 26 verlässlich, kompetentwww.landarbeiterkammer.at/ooe – deine Landarbeiterkammer 1 Inkassokosten in vielen Fällen rechtswidrig Mag.a Ulrike Weiß, MBA Ein Nachweis über den bringung der Forderung mit einer Ratenzahlungs- tatsächlich entstandenen nichts beitragen, ist dem- vereinbarung schnell zur Schaden an die Schuldner nach jedenfalls nicht ge- Hand. Damit verbunden wird nicht erbracht. deckt. Ist es überhaupt ab- anerkennt der Schuldner sehbar, dass der Schuldner aber auch die bisher ver- Inkassokosten müssen nicht zahlen kann – z. B. rechneten Inkassokosten. notwendig, zweckmäßig weil er das dem Gläubiger Ein solches Anerkenntnis und angemessen sein mitteilt und ein Ratenan- ist aber nur gültig, wenn In der Praxis werden dem suchen stellt – ist die Be- die Inkassokosten geson- Schuldner die in der Inkas- treibung durch ein Inkas- dert angegeben und nach sogebühren-Verordnung sobüro überhaupt nicht Inkassoschritten aufge- vorgesehenen Schuldner- zweckmäßig und es dürfen schlüsselt werden. In der gebühren in voller Höhe für solche Maßnahmen Regel ist auch das Verbrau- verrechnet. Der Gesetz- Mag.a Ulrike Weiß, MBA auch keine Kosten verrech- cherkreditgesetz auf Raten- Konsumenteninformation geber aber gibt hier nur net werden. zahlungsvereinbarungen Arbeiterkammer OÖ Höchstsätze vor, und die Die Inkassokosten müssen anwendbar. In diesem ersatzfähigen Inkassokos- außerdem in einem ange- Fall hat der Schuldner ein ten sind jeweils nach den Rücktrittsrecht und das In- Zahlreiche Beschwerden messenen Verhältnis zur besonderen Umständen kassobüro muss über den bei den Konsumenten- betriebenen Forderung ste- im Einzelfall zu bemessen effektiven Jahreszinssatz schützern der Arbeiter- hen. -

Physiotherapeutinnen Ohne Vertrag 2021
HINWEIS: Diese Listen finden Sie auch auf unserer Homepage www.oegk.at (Vertragspartner-Service-Therapeutensuche) PhysiotherapeutInnen ohne Vertrag 2021 Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, dass Wahltherapeuten nicht verpflichtet sind uns Änderungen mitzuteilen und die Daten daher nicht immer den letzten Stand entsprechen. BRAUNAU Name Straße Ort TelefonNr. 2. TelefonNr. E-Mail Zusatzausbildungen HB weitere Informationen AUER Harald Braunauerstr. 17 4962 Mining 0664/73069927 [email protected] HB AUGUSTIN Barbara Hofstätterstr. 7 5274 Burgkirchen 0699/11876315 [email protected] MLD HB BARTH Christian Weilhartstraße 40 5121 Ostermiething 06278/7117 0179/1204601 [email protected] MLD BARTOSCH-DICK Ursula Auerbach 18 5222 Auerbach 07747/20030 Erwachsenenbobath HB BAUCHINGER Jürgen Salzburgerstr. 120 5280 Braunau 0676/4622327 [email protected] MLD nein BAUER Christian Leithen 12 4933 Wildenau 0680/3256602 [email protected] HB BEINHUNDNER Silvia Pischelsdorf 56 5233 Pischelsdorf 07742/7075 0650/6680212 [email protected] HB BREITENBERGER Christina Davidstraße 17 5145 Neukirchen 0650/9208214 [email protected] Erwachsenenbobath HB BURGSTALLER Christoph Straussweg 7 5211 Friedburg 0660/3160350 [email protected] HB CHRISTL Birgit Dr. Finsterer Weg 6/2 5252 Aspach 0664/9509960 [email protected] Erwachsenenbobath HB siehe auch Ried/I. DAXER Johannes Rieder Hauptstrasse 42 5212 Schneegattern 0677/63156023 [email protected] MLD, Bindegewebsmass. HB DEMM Tanja Mitterweg 1 5230 Mattighofen 0664/2119110 [email protected] Kinderbobath HB siehe auch Linz Stadt und in Neudorf 22 5231 Schalchen DENK Wiebke Mittererb 5 5211 Friedburg 07746/2795 MLD DENK Gertraud Aham 2 4963 St. Peter/Hart 07722/62666 DENK Daniela Kerschham 26 5221 Lochen 0680/2353433 [email protected] MLD HB siehe auch Ried/I. -

844 Ried Im Innkreis
@|action=saveto:Q:\FP_DL\G_T\L-Folder\AF1009G0L80725|@ @|append = Q:\FP_DL\G_T\L-Folder\Back\AF1009G0L80726-R4784.pdf|@ Produktion: 31.01.2019 Satzfehler, Irrtümer, Änderungen vorbehalten. Medieninhaber und Hersteller: OÖ Verkehrsverbund-Organisations GmbH Nfg. & Co KG, Volksgartenstr. 23, 4020 Linz, Verlags-, Herstellungsort: 4020 Linz Kachelgröße (X/Y): 3/2 31.01.2019 12:28:09 OOEVG-FPD01 Ried im Innkreis Andrichsfurt Dorf/Pram Zell/Pram Fahrpläne / Linien gültig ab 17.02.2019 Tumeltsham Taiskirchen im Innkreis Riedau Raab 844 844 17.02.2019 ÖBB-Postbus GmbH Aigengutstraße 20-22 4020 Linz 05-17-17 Ried im Innkreis - Riedau - Montag–Freitag (Werktag) F S S S Zell/Pram - Raab 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 101 103 105 107 109 123 111 113 115 117 119 121 ¶' ¶' ¶' ¶' ¶' ¶' ¶' ¶' ¶' ¶' ¶' ¶' Ried i.Ikr. Gartenstraße/SZ 13.20 13.30 15.30 Ried i.Ikr. Brucknerstr./HS 13.22 13.32 15.32 Ried i.Ikr. Friedrich-Thurner-Straße 13.24 13.34 15.34 Ried i.Ikr. Marktplatz 13.25 13.35 15.35 ð ã aus Ri. (Linz - Wels -) Neumarkt-Kallham 6.41 7.07 10.59 11.59 12.59 15.59 16.59 17.59 18.59 ð ã aus Ri. (Simbach am Inn -) Braunau am Inn 6.41 7.06 10.59 11.59 12.59 15.59 16.59 17.59 18.59 ð ã aus Ri. Attnang-Puchheim 6.23 7.03 11.56 15.56 16.56 17.56 18.56 ð ã aus Ri. Schärding 6.49 11.56 15.53 16.53 17.53 18.53 Ried i.Ikr. -

Bezirkaktuelles AUS RIED
unserBezirk AKTUELLES AUS RIED SITZUNG DER BILDUNGS- UND BO Günter Huber informiert! KULTURREFERENTEN Zu einer Führung durch das Braunauer Heimathaus und die Stadtpfarrkirche lud Konsulent Franz Oberauer die in Ortsgruppen tätigen Funktionäre ein. Durch das Heimathaus führte Susanne Urferer, in der Stadt- pfarrkirche Annegret Ritzinger. Die Sitzung wurde nach einem literarischen Beitrag, den Oberauer vortrug, im Restaurant Schüdlbauer durchgeführt. BR a.D. Peter Rodek referierte über die Umsetzung des ISA Projektes im Bezirk Braunau. Der Pressereferent Johann Mayr berichtete über den PC- Kurs, der für Senioren im März bei der HBLW angeboten wird. Konsulent Oberauer gab eine Vorschau auf die geplanten Kulturveranstaltungen und nahm die Kartenbestellungen von links: BR a.D., Bezirkskulturreferent Peter Rodek, Konsulent Franz entgegen. Oberauer (Mayr) SCHULUNG DER SENIORENBUND OBFRAUEN UND OBMÄNNER Pauline Büchl, die 1. Obfrau-Stellvertreterin, konnte im Es referierte Polizei-Oberstleutnant Stefan Haslberger über Schulungsraum alle Obleute aus dem Bezirk begrüßen. die Sicherheit, Bürgermeister Stefan Mejer und Kammerätin Marianne Kraxberger über die Arbeiterkammer-Wahl. Bgm. Franz Bichler legte den Kassenbericht vor. Die Kassenprü- ferin Gertraud Hubauer schlug eine Entlastung vor. Konsulent Franz Oberauer berichtete über die Veranstaltungen im Kul- turbereich. Der Pressereferent Johann Mayr informierte über den PC- Kurs bei der HBLW. Alle Senioren, die bei der Mitglieder-Werbeaktion 2018 er- folgreich waren, wurden mit einem Thermen-Gutschein oder einem Oberösterreich-Buch geehrt. von links. Pauline Büchl, KR Marianne Kraxberger, Bgm. Stefan Mejer (Mayr) ORTSBERICHTE AUS ALLEN BEZIRKEN AUF WWW.OOE-SENIORENBUND.AT APRIL 2019 I 01 WIR GRATULIEREN HERZLICH: ANDRICHSFURT Hermine Danninger (80), Johann Bruckbauer (91), Ehren- Obfrau Anna Zöhrer (92), Maria Winklhofer (97) Am 13. -

2021.04.08 Updated List of RGLA Treated As
EU regional governments and local authorities treated as exposures to central governments in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) 575/2013 Disclaimer: The below list was compiled using exclusively the information provided by relevant competent authorities on the regional governments and local authorities which they treat as exposures to their central governments in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) No 575/2013’ Date of the last update of information in this Annex 08. Apr 21 Name of the counterparty Name of the counterparty Member State Type of counterparty1 Region / District (original language) (English) Austria Local authority Bezirk Lienz Abfaltersbach Austria Local authority Bezirk Innsbruck‐Land Absam Austria Local authority Bezirk Tulln Absdorf Austria Local authority Bezirk Hallein Abtenau Austria Local authority Bezirk Mödling Achau Austria Local authority Bezirk Schwaz Achenkirch Austria Local authority Bezirk Gänserndorf Aderklaa Austria Local authority Bezirk Steyr‐Land Adlwang Austria Local authority Bezirk Liezen Admont Austria Local authority Bezirk Hallein Adnet Austria Local authority Bezirk Bruck‐Mürzzuschlag Aflenz Austria Local authority Bezirk Villach Land Afritz am See Austria Local authority Bezirk Krems (Land) Aggsbach Austria Local authority Bezirk Liezen Aich Austria Local authority Bezirk Wels‐Land Aichkirchen Austria Local authority Bezirk Liezen Aigen im Ennstal Austria Local authority Bezirk Rohrbach Aigen‐Schlägl Austria Local authority Bezirk Lienz Ainet Austria Local authority -

Bundesgesetzblatt Für Die Republik Österreich
1 von 2 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2008 Ausgegeben am 30. Oktober 2008 Teil II 383. Verordnung: Änderung der Anhänge der Bluetongue-Bekämpfungsverordnung 383. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend zur Änderung der Anhänge der Bluetongue-Bekämpfungsverordnung Auf Grund der §§ 1 Abs. 6, 2c, 12, 23 Abs. 2 und 25a Abs. 3 des Tierseuchengesetzes (TSG), RGBl. Nr. 177/1909, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 36/2008, wird verordnet: Die Anhänge der Bluetongue-Bekämpfungsverordnung, BTB-V, BGBl. II Nr. 148/2008, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 267/2008, werden durch folgende Anhänge ersetzt: „Anhänge Anhang A Schutzzonen Derzeit keine Zonen. Anhang B Kontrollzonen Ab 4. November 2008: In Oberösterreich: Die Bezirke Rohrbach, Schärding, Grieskirchen, Eferding, Urfahr-Umgebung und Freistadt sowie im Bezirk Ried im Innkreis die Gemeinden Andrichsfurt, Antiesenhofen, Aurolzmünster, Eitzing, Geinberg, Gurten, Kirchdorf am Inn, Lambrechten, Mörschwang, Mühlheim am Inn, Obernberg am Inn, Ort im Innkreis, Peterskirchen, Reichersberg, St. Georgen bei Obernberg am Inn, St. Martin im Innkreis, Senftenbach, Taiskirchen im Innkreis, Tumeltsham, Utzenaich, Weilbach und Wippenham; In Niederösterreich: Der Bezirk Gmünd mit Ausnahme der Gemeinden Großschönau, Hirschbach, Kirchberg am Walde und Waldenstein. Anhang C Amtliche Impfungen 1. Gebiete in denen amtliche Schutzimpfungen gemäß § 7 durchgeführt werden (Sperrzone gemäß Verordnung (EG) Nr. 1266/2007): Ab 30. Juli 2008: In Tirol: das gesamte Landesgebiet mit Ausnahme von Osttirol. In Vorarlberg: das gesamte Landesgebiet. 2. Impfzeitraum für die Durchführung der amtlichen Schutzimpfungen gemäß § 7: Die Schutzimpfungen sind zwischen 30. Juli 2008 und 31. März 2009 durchzuführen. www.ris.bka.gv.at BGBl. -

Agrostis Scabra Willd. Neu Für Oberösterreich Sowie Weitere
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs Jahr/Year: 2002 Band/Volume: 0011 Autor(en)/Author(s): Hohla Michael Artikel/Article: Agrostis scabra WILLD. neu für Oberösterreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels und Niederbayerns 465-505 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Beitr. Naturk. Oberösterreichs 11 465-505 29.11.2002 Agrostis scabra WiLLD. neu für Oberösterreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels und Niederbayerns M. HOHLA Abstract: The following article deals with interesting discoveries of vascular plants that have been made and recorded by the author (or that have been imparted to him) between 2001 and 2002 in the Lower Inn and Lower Salzach regions. New finds for Upper Austria are represented by Agrostis scabra, Miscanthus sacchariflorus, Rorippa sylvestris x austriaca (= R. x armoracioides), Solidago graminifolia and Veronica anagallis-aquatica x catenata (= Veronica x lackschewitzii) among others. Welcome news are rediscoveries of the formerly extincted Dipsacus laciniatus and of Chenopodium opulifolium, Cochlearia pyrenaica, Dianthus armeria und Mercurialis annua which are threatened by extinction. Sagina apetala subsp. erecta has now been located beyond the railway system in Lower Bavaria and the Innviertel. Growth sites of the following rare species in this region are designated: Ajuga genevensis, -

Gemeindeliste Sortiert Nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt Am: 21.05.2015 14:29:08
Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt am: 21.05.2015 14:29:08 Gemeinde Gemeinde PLZ des Gemeindename Status weitere Postleitzahlen kennziffer code Gem.Amtes 10101 Eisenstadt 10101 SS 7000 10201 Rust 10201 SS 7071 10301 Breitenbrunn am Neusiedler See 10301 M 7091 10302 Donnerskirchen 10302 M 7082 10303 Großhöflein 10303 M 7051 10304 Hornstein 10304 M 7053 2491 10305 Klingenbach 10305 7013 10306 Leithaprodersdorf 10306 2443 10307 Mörbisch am See 10307 7072 10308 Müllendorf 10308 7052 10309 Neufeld an der Leitha 10309 ST 2491 10310 Oggau am Neusiedler See 10310 M 7063 10311 Oslip 10311 7064 10312 Purbach am Neusiedler See 10312 ST 7083 10313 Sankt Margarethen im Burgenland 10313 M 7062 10314 Schützen am Gebirge 10314 7081 10315 Siegendorf 10315 M 7011 10316 Steinbrunn 10316 M 7035 2491 10317 Trausdorf an der Wulka 10317 7061 10318 Wimpassing an der Leitha 10318 2485 10319 Wulkaprodersdorf 10319 M 7041 10320 Loretto 10320 M 2443 10321 Stotzing 10321 2443 10322 Zillingtal 10322 7034 7033 7035 10323 Zagersdorf 10323 7011 10401 Bocksdorf 10401 7551 10402 Burgauberg-Neudauberg 10402 8291 8292 10403 Eberau 10403 M 7521 7522 10404 Gerersdorf-Sulz 10404 7542 7540 10405 Güssing 10405 ST 7540 7542 10406 Güttenbach 10406 M 7536 10407 Heiligenbrunn 10407 7522 10408 Kukmirn 10408 M 7543 10409 Neuberg im Burgenland 10409 7537 10410 Neustift bei Güssing 10410 7540 10411 Olbendorf 10411 7534 10412 Ollersdorf im Burgenland 10412 M 7533 8292 Q: STATISTIK AUSTRIA 1 / 58 Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand -

Die Moosflora Des Oberen Innviertels (Oberösterreich)
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at KRISAI • Die Moosflora des oberen Innviertels STAPFIA 95 (2011): 55–75 Die Moosflora des Oberen Innviertels (Oberösterreich) R. KRISAI* Abstract: The Moss Flora of the Upper Innviertel (Upper Austria). — In the westernmost part of Upper Austria (oberes Innviertel) 246 species of Musci, 52 of Hepatics and 2 of Anthocerotatae were found up to now (2010). These are about 1/3 of the Austrian Musci and 1/5 of the Austrian Hepatics & Anthocerotatae. An annotated checklist is given in this paper. Species worth to emphasise are Dicranum viride, Hookeria lucens, Spaerocarpos texanus, Anthoceros agrestis and Phaeoceros carolinianus. 74 species are mentioned in the Austrian Red Lists of Musci and Hepatics + Anthocerotatae. Zusammenfassung: Im Gebiet wurden bisher 246 Laubmoosarten gefunden. Legt man die in der Roten Liste von GRIMS und KÖCKINGER bzw. SAUKEL u. KÖCKINGER (in NIKLFELD 1999) genannte Anzahl der österreichischen Laubmoose (760) zugrunde, sind das 32% oder etwa ein Drittel der österreichischen Arten. Bei Leber- und Hornmoosen sind es etwas weniger: 54 von 260 Arten, das sind 21% oder etwa ein Fünftel. In der neuen Online-Liste werden etwas höhere Artenzahlen für Österreich angegeben; da aber auch mit weiteren Funden zu rechnen ist, dürfte sich daran (1/3 der Laub- und 1/5 der Leber- und Hornmoose) nicht viel ändern. In den Roten Listen werden (einschließlich der regional bedrohten) 76 Arten als gefährdet genannt, das sind ca. 25%.Vom Aussterben bedroht (Stufe 1) sind fünf: Bryum neodamense, Drepanocladus sendtneri, Neckera pennata, Sphaerocarpus texanus (in der Roten Liste nicht angegeben, wohl aber hierher zu stellen) und das Lebermoos Cephalozia macrostachya.