Swiss Philosophical Preprint Series Anja Leser Bewusstsein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Palacký University in Olomouc 2004; and V
Palacký University Olomouc Philosophical Faculty Department of Philosophy Mgr. Vlastimil Vohánka Modality, Logical Probability, and the Trinity: A Defence of Weak Skepticism MODALITA, LOGICKÁ PRAVDĚPODOBNOST A TROJICE: OBHAJOBA UMÍRNĚNÉHO SKEPTICISMU Dissertation thesis Study program: Philosophy Supervisor: Prof. PhDr. et RNDr. Jan Štěpán, CSc. Olomouc 2011 1 Statement I declare that I wrote this dissertation on my own and that I cited all used sources. Olomouc, ............................... Vlastimil Vohánka ............................... 2 Abstract (EN) The author defends the thesis that, apart from religious experience, it cannot be evident – in a defined sense of psychological impossibility – that the Trinity doctrine is logically possible. The Trinity doctrine is understood broadly, as the proposition that there is just one God but three persons each of which is God. It is concluded that, apart from religious experience, none of the following claims can be evident: the Trinity doctrine is true; Christianity is true; the Trinity doctrine is logically possible; Christianity is logically possible; the Trinity doctrine has some but not minimal (zero) logical probability with respect to all that is evident; Christianity has some but not minimal logical probability with respect to all that is evident. Christianity is understood as a particular compound proposition including the Trinity doctrine. Replies are provided to objections against the employed principles of logical probability. The author leaves as undecided whether the Trinity doctrine, Christianity, or their logical possibility are: epistemically justified; well-argued; plausibly logically probable with respect to all that is evident (though not evidently logically probable on such information apart from religious experience); or probable in other than the logical sense. -

Los Ejemplos De La Historia De La Filosofía
LOS EJEMPLOS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA UNA SELECCIÓN PARA SU USO EN EL AULA Seminario 2019-2020 Ejemplística en el Aula de Filosofía1 UCM / CTIF Madrid-Oeste 1 Grupo de trabajo integrado por Jorge M. Burruezo Arcadio (ejs. 1-5), Eduardo Cañas Rello (ejs. 6-8), Silvia Castro García (ejs. 26-29), David Domínguez Manzano (ejs. 12-17), María Llanos Fernández Estrada (ejs. 30-31), Raúl García Tendero (ejs. 22-24), Ángel Gutiérrez Rubio (ej. 25), Alberto López López (ejs. 9-11) y Guillermo Villaverde López (ejs. 19-21). Seminario 2019-2020 EJEMPLÍSTICA EN EL AULA DE FILOSOFÍA Índice EJEMPLO Nº 1. El desconocido matiz de azul ......................................................................................3 EJEMPLO Nº 2. La unidad de una historia .......................................................................................... 6 EJEMPLO Nº 3. Las imposibles inferencias de Adán.......................................................................... 10 EJEMPLO Nº 4. Las bolas de billar ...................................................................................................... 14 EJEMPLO Nº 5. El lento aprendizaje de Adán .................................................................................... 19 EJEMPLO Nº 6. El príncipe indio y las heladas ................................................................................. 23 EJEMPLO Nº 7. El pichón y el gato .................................................................................................... 25 EJEMPLO Nº 8. La batalla naval ........................................................................................................ -
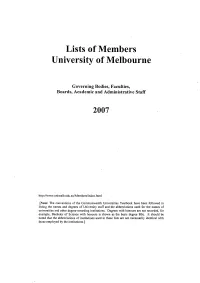
Lists of Members University of Melbourne
Lists of Members University of Melbourne Governing Bodies, Faculties, Boards, Academic and Administrative Staff 2007 http://www.unimelb.edu.au/Members/index.html [Note: The conventions of the Commonwealth Universities Yearbook have been followed in listing the names and degrees of University staff and the abbreviations used for the names of universities and other degree-awarding institutions. Degrees with honours are not recorded, for example, Bachelor of Science with honours is shown as the basic degree BSc. It should be noted that the abbreviations of institutions used in these lists are not necessarily identical with those employed byth e institutions.] Lists of Members University ofMelbourn e 2007 TABLE OF CONTENTS Senior Office Bearers 1 Council 3 Committees 5 Committees (Committees of Council) 6 Councils of Halls of Residence 11 Committee of Convocation 13 Academic Board 16 Committees ofthe Academic Board : 16 Faculties 24 Boards 34 Professors 36 Readers 49 Professors Emeritus 51 Laureate Professors 58 Laureate Professorial Fellow 58 Vice-Chancellor's Fellows 59 Federation Fellows 60 Headso f Affiliated Colleges 61 Headso f Hallso f Residence 61 Teaching and Research Staff. , 62 Architecture, Building and Planning 62 Arts 63 Economics and Commerce 78 Education 83 Engineering 87 Land and Food Resources 95 Law 98 Medicine, Dentistry and Health Sciences 101 Melbourne Business School 156 Music ; 157 Science 159 Veterinary Science 170 Victorian College ofthe Arts 172 Faculty Administration 175 Graduate School Administration 180 Central -

Revista DIAPHONÍA
Revista DIAPHONÍA Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Programa de Educação Tutorial – PET Grupo PET Filosofia Revista DIAPHONÍA Volume 4 Número 2 2018 e-ISSN 2446-7413 A Revista DIAPHONÍA constitui um periódico promovido pelo PET [Programa de Educação Tutorial] do Curso de Filosofia da UNIOESTE em que se privilegia a produção de textos escritos por estudantes de graduação, acadêmicos bolsistas, egressos, tutores ou demais pesquisadores afetos às atividades do Programa tanto em nível local quanto nacional. Sua principal peculiaridade é o fomento e a difusão de textos que espelhem o processo de formação de seus autores, tendo como meta estimular a interlocução entre pares, numa perspectiva indissolúvel entre o ensino, a pesquisa e a extensão na área de Filosofia. Apoio: Grupo PET Filosofia 2018/2º Semestre Ester Maria Dreher Heuser (tutora) Carina Eduarda Kozera Caroline de Paula Bueno Daniel Du Sagrado Barreto Daluz Elvio Camilo Crestani Fabio Gabriel Semencato Felipe Belin Giullya Schuster De Almeida Gustavo Henrique Martins Lucas dos Santos Nilson Rodrigo da Silva Rafaela Ortiz de Salles Ricardo Rodrigo França da Silva Pareceristas Prof. Dr. César Augusto Battisti Prof. Dr. Claudinei Aparecido de Freitas da Silva Profª Dra. Ester Maria Dreher Heuser Profª Me. Fabiana Bennetti Prof. Dr. Marciano Adilio Spica Profª Dra. Nelsi Kistemacher Welter Prof. Me. Saulo Sbaraini Agostini Profª Me. Thayla Magally Gevehr Editor Científico Geral Prof. Dr. Paulo Cézar Konzen (UNIOESTE) Conselho Editorial Prof. Dr. Bernardo A. M. Sakamoto (UNIOESTE) Profª Esp. Célia Machado Benvenho (UNIOESTE) Prof. Dr. César Augusto Battisti (UNIOESTE) Prof. Dr. Claudinei Aparecido de Freitas da Silva (UNIOESTE) Prof. -
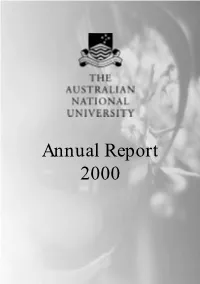
Annual Report 2000
Annual Report 2000 1 Annual Report 2000 Published by the Public Affairs Division The Australian National University Published by Public Affairs Division Produced by Publications Office Public Affairs Division The Australian National University Printed by University Printing and Duplicating Service Financial Services Division The Australian National University ISSN 1327-7227 April 2001 VICE-CHANCELLOR CANBERRA ACT 0200 AUSTRALIA PROFESSOR IAN CHUBB AO TELEPHONE: +61 2 6125 2510 FACSIMILE: +61 2 6257 3292 EMAIL: [email protected] 17 April 2001 The Hon Dr David Kemp Minister for Education, Training and Youth Affairs Parliament House CANBERRA ACT 2600 Dear Minister Report of the Council for the period 1 January 2000 to 31 December 2000 We have the honour to transmit the report of the Council of The Australian National University for the period 1 January 2000 to 31 December 2000 furnished in compliance with Section 9 of the Commonwealth Authorities and Companies Act 1977. Emeritus Professor P E Baume Professor I W Chubb Chancellor Vice-Chancellor Contents Council and University Officers Further information about ANU Overview of the University Detailed information about the achievements of ANU in 2000, especially research and teaching outcomes, is Review of 2000 contained in the annual reports of the University’s re- Council and Council Committee Meetings search schools, faculties, centres and administrative di- visions. University Statistics Cooperation with Government and For course and other academic information, other Public Institutions -

Annual Report 2001
Annual Report 2001 Published by the Marketing and Public Affairs Division The Australian National University Published by Marketing and Public Affairs Division The Australian National University Produced by Publications Office Marketing and Public Affairs Division The Australian National University Printed by University Printing Service The Australian National University ISSN 1327-7227 April 2002 THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY VICE-CHANCELLOR CANBERRA ACT 0200 AUSTRALIA PROFESSOR IAN CHUBB AO TELEPHONE: +61 2 6125 2510 FACSIMILE: +61 2 6257 3292 EMAIL: [email protected] 11 April 2002 The Hon Dr Brendaan Nelson MP Minister for Education, Science and Training Parliament House CANBERRA ACT 2600 Dear Minister Report of the Council for the period 1 January 2001 to 31 December 2001 We have the honour to transmit the report of the Council of The Australian National University for the period 1 January 2001 to 31 December 2001 furnished in compliance with Section 9 of the Commonwealth Authorities and Companies Act 1977. Emeritus Professor P E Baume Professor I W Chubb Chancellor Vice-Chancellor Contents Council and University Officers Further information about ANU Overview of The Australian National University Detailed information about the achievements of ANU in 2001, especially research and teaching outcomes, is Council and Council Committee Meetings contained in the annual reports of the University’s re- University Statistics search schools, faculties, centres and administrative di- visions. Cooperation with Government and other Public Institutions -

Experiment Month: Helping Philosophers to Engage Empirically June 30, 2009
Experiment Month: Helping Philosophers to Engage Empirically June 30, 2009 Overview: Although there has been a growing interest in experimental research among young philosophers, especially undergraduate and graduate students, many find that they don’t have the resources or expertise required to conduct rigorous experimental research. These budding philosophers often have exciting and original ideas; they simply lack the support they would need to turn those visions into real philosophical research. The aim of the proposed Experiment Month program is to provide these philosophers with resources, encouragement and technical assistance to realize the potential of their own ideas. To attain these objectives, we propose, in conjunction with a consortium of prominent philosophers and under the auspices of the Yale University Program in Cognitive Science, to implement a program that will provide philosophers (especially students) with: x ‘Experiment buddies’ who can help them to correctly design studies and think through the implications of their data x On-line educational videos that guide them through the process of developing philosophically relevant experiments x The resources necessary to put together online studies, attract a large sample of subjects, and analyze the resulting data. Above all, we aim to encourage and inspire young philosophers through the organization of a community-wide event that will enable broad participation in a friendly and supportive atmosphere. Summary of Project: Fall 2010 Proposals for experiments due. Winter 2010 Team of volunteers select the most viable proposals for inclusion in the Experiment Month and provide helpful comments on selected submissions. Winter 2010— Each winning project is assigned an ‘experiment buddy’ who works Spring 2011 with the philosopher to help refine the proposed study, enabling research that successfully engages with the key philosophical questions in the relevant area. -

John R. Searle E a Questão Da Consciência: Um Estudo Introdutório a Sua Problemática
NOARA, Ensaios Filosóficos, Volume XXII – Dezembro 2020 JOHN R. SEARLE E A QUESTÃO DA CONSCIÊNCIA: UM ESTUDO INTRODUTÓRIO A SUA PROBLEMÁTICA Andre Renan Batistella Noara1 Resumo: O presente estudo tem como objetivo elaborar uma análise referente ao modo com o qual o Filósofo americano John Roger Searle (1935) concebe o problema da consciência. Para tanto, será investigado os movimentos teóricos desenvolvidos por Searle em relação à sua tentativa de desvinculação da concepção tradicional de determinados conceitos que, atualmente, se fazem centrais em Filosofia da Mente. Para tanto, as obras de Searle, abordadas para o desenvolvimento deste estudo, são, fundamentalmente, A Redescoberta da Mente (1997), publicada originalmente, em 1992, e O Mistério da Consciência (1998), publicada originalmente, em 1997. A metodologia abordada para o presente trabalho se dará da seguinte forma: primeiramente será analisado o modo com o qual as tradições filosófica-religiosa conceberam o conceito de ser humano. Em um segundo momento, observar-se-á as influências das tradições para os estudos em Filosofia da Mente. Por fim será investigado o modo com o qual Searle busca se desvincular das concepções tradicionais acerca desta problemática e quais são os argumentos que visam sustentar sua desvinculação. Acredita-se que o presente trabalho trará para o leitor uma melhor compreensão dos problemas centrais em Filosofia da Mente e uma introdução à filosofia searleana acerca desta problemática. Palavras-chave: Qualia, Ontologia, Fenômeno, Físico. Mental. Abstract: This study aims to elaborate an analysis about the way that the American philosopher John Roger Searle (1935) understands the idea of consciousness. Therefore, theoretical movements developed by Searle will be investigated trying to the attempt of the unlink from the traditional idea of some concepts which nowadays, are the center of the Minds Philosophy. -
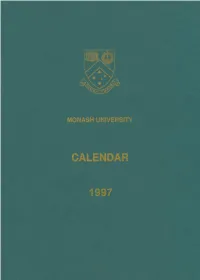
1997 Monash University Calendar Part 1
Monash University Calendar 1997 Part I- Lists of members Part II- Legislation Monash University Calendaris published early each year and updated throughout the year as required. Amendments to statutes and regulations are only published following Council approval and promulgation. Caution The information contained in this Calendar is as correct as possible at the publication date shown in the notes on the first page of part one and part two. Produced by: Publishing and Design, Marketing and Development Office Clayton campus Contents Part I- Lists of members Amendments to Staff Details (only use for non- faculty staff} . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 Officers and staff. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 Principal officers. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 Members of Council ............................ 5 The Academic Board ........................... 6 Emeritus professors .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 Former officers .................................. 9 Vice-Chancellor's Office ...................... 13 Deputy Vice-Chancellor's Office (Academic and Planning) ................... 14 Deputy Vice-Chancellor's Office (International and Public Affairs) .. .. .. .. .. 14 Deputy Vice-Chancellor's Office (Research and Development) ............... IS General Manager's Office ...................... 15 University professors .......................... 16 Research Professors ............................ 20 Honorary Professors and Adjunct Professors 20 Honorary Professorial Fellows ................ 21 Other Professors -

1979 Monash University Calendar Part 1
31. NORMANBY ROAD -- MONASH UNIVERSITY N C.S.J.R.O. SCALE IN METRES ~~ &Ms 100 121 110 175 zOo RING ROAD NORTH * 30 ••• .. KEY TO PLAN ••••29 I. University club 2. Religious centre MARSHALL RESERVE 3. Robert Blackwood Hall ENGINEERING 4. Main library S. Krongold child training centre 6. The Alexander Theatre 7. Rotunda 8. Biomedical library 9. Biochemistry laboratories 10. Central science block SPORTS AREA II. Senior zoology 12. First year chemistry 13. Zoology lecture theatres UNION ROAD 14. First year biology laboratory SPORTS AREA IS. Senior chemistry 16. Western science lecture theatres 17. Eastern science lecture theatres 18. First year physics 19. Senior physics 20. Hargrave library 21. Northern science lecture theatres 22. Mathematics and computer centre 23. Engineering lecture theatres 24. 25. 26. 27. Engineering school RING 28. Boiler-house VICE CHANCELLOR'S 29. Botany experimental area RESIDENCE 30. Zoology environmental laboratories _. EDUCATIOI't ,, 31. Conference centre SOUTHEAST FLATS ERECTED MANNIX COLLEGE MONASH UNIVERSITY CALENDAR 1979 Published by Monash University Wellington Road, Clayton Victoria, Australia 3168 Telephone: 541 0811 Telegrams: Monashuni Melbourne Telex: AA 32691 All rights reserved This book or any part thereof may not be reproduced in any form whatsoever, whether by graphic, visual, electronic, filming, microfilming, tape recording or any means, except in the case of brief passages for the information of students, without the prior written permission of the publisher. Copyright© Monash University 1979. Printed and bound by Brown Prior Anderson Pty Ltd Melbourne CONTENTS (The contents of the Calendar have been brought up to date as at 3 January 1979 with the exception of the statutes and regulations which were those in force at 9 October 1978. -

Interpretação Das Sensações Interpretation of the Sensations
Interpretação das sensações Interpretation of the sensations ANDRÉ RENAN NOARA1 Resumo: O presente estudo tem como objetivo elaborar uma análise referente ao modo com o qual as experiências fenomênicas de primeira pessoa são trabalhadas na filosofia da linguagem de Ludwig Wittgenstein (1889-1951), mais precisamente em sua obra Investigações Filosóficas (1953), assim como, apresentar a necessidade do uso da hermenêutica para a interpretação das mesmas nos jogos de linguagem. A metodologia abordada para o presente trabalho, visando alcançar os objetivos propostos, se dará da seguinte forma: primeiramente faremos uma breve análise relacionada ao conceito de qualia. Em um segundo momento, analisaremos os conceitos acerca da impossibilidade de uma linguagem privada em Wittgenstein e o conceito de jogos de linguagem por ele formulado. Em uma terceira etapa, observaremos o papel fundamental exercido pela hermenêutica nos jogos de linguagem. Acredito que o presente estudo trará para o leitor uma melhor compreensão em relação ao conceito de qualia, assim como, uma iniciação à filosofia wittgensteiniana referente à teoria dos jogos de linguagem. O leitor também irá perceber os motivos pelos quais a hermenêutica é fundamental para a compreensão correta das expressões linguísticas. Palavras-chave: Experiência. Qualia. Linguagem. Abstract: This study aims to create an analysis about the way the phenomenon experiences of the first subject are worked in the language philosophy of Ludwig Wittgenstein (1889- 1951) specific in his work Philosophical Investigation (1953). Also, it aims to present the need of the hermeneutic use to the interpretation of them in the language games. The methodology used is organized in the following way: first of all it will be done a brief analysis related to the qualia concept. -

Janeiro a Junho De 2021 ISSN 2238-6408
REVISTA REFLEXÕES, FORTALEZA-CE - Ano 10, Nº 18 – Janeiro a Junho de 2021 ISSN 2238-6408 EPIFENOMENALISMO OU SOBREDETERMINAÇÃO CAUSAL: CONSEQUÊNCIAS DO NATURALISMO BIOLÓGICO? Andre Renan Batistella Noara1 ORCID iD: 0000-0003-1119-3795 Jerzy A. Brzozowski2 ORCID iD: 0000-0002-8667-9530 Resumo: O presente estudo visa desenvolver uma análise da relação mente-cérebro proposta pela teoria do naturalismo biológico, de John Searle, bem como investigar se tal relação implica em sobredeterminação causal ou epifenomenalismo. Para tanto, o presente estudo seguirá a seguinte metodologia: primeiramente serão analisados os conceitos de identidade, causa e efeito ─ os quais visam dar sustentação à relação causal contida entre mente-cérebro ─, expostos por John Searle em sua obra Mind: A Brief Introduction (2004). Em um segundo momento, será analisado se a defesa de tal relação, por parte da teoria do naturalismo biológico, implica, ou não, nos conceitos de sobredeterminação causal ou epifenomenalismo, implicação esta negada por Searle em seu artigo “Por que não sou um dualista de propriedades” (2014). Acredita-se que o presente trabalho trará para o leitor uma melhor compreensão acerca das noções de causalidade e identidade em Searle, bem como dos conceitos básicos que definem o epifenomenalismo e a sobredeterminação causal. Palavras-chave: Mente; Cérebro; Causação; Identidade; Sobredeterminação causal; Epifenomenalismo Abstract: This study attempts to develop an analysis of the mind-brain relation as proposed by John Searle's biological naturalism theory, and also to investigate whether that relation entails either overdetermination or epiphenomenalism. We start with an analysis of the concepts of identity and causality which are at the core of Searle's view of the mind-brain relation in the word Mind: A Brief Introduction (2004).