Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

February Meeting
President Diana Scott ...................338-0208 Vice-President Dave Crucq ..................941-1957 The executive meeting will be held at the home of Dick and Past President: Pauline Bonney, 3293 Seabank Road. Harry Wright.................338-8345 Secretary Pauline Thompson ........339-3423 Treasurer Dave Godfrey ...............335-0717 Director: Ways & Means Nadine Boudreau ..........339-0909 As an experienced gardener for most of his life, Harry Director: Membership Wright will present his program "Gardening Basics" at our Brian Staton ..................337-5228 February meeting. His PowerPoint presentation will explore Director: Publicity and explain many aspects of gardening, from planting to Chris Aldred .................335-3221 pruning and seeding to weeding, with information for all Director: Newsletter/Library Noni Godfrey ................335-0717 levels. Be sure to attend this educational program. ....................... [email protected] Social Committee: Marleen Crucq ..............941-1957 Revenue Table Committee: Louise Casson ...............334-2331 Sunshine Lady: Pauline Bonney .............339-7594 The club meets at 7:30 p.m the second Tuesday of each month (except May through August) United Church in Comox. PO Box 3183, Courtenay, BC, Canada V9N 5N4 Vol. 24 No 6 February 2010 Other popular yak hybrids include the series developed in the 1970’s named after Snow White’s seven dwarfs. R. ‘Bashful’ has blushing pink blooms that go well with the silvery young leaves. R. ‘Dopey’ has glossy red blooms and R.‘Grumpy’ has pink buds and pale pink flowers that fade to cream. Other favourites are R. 'Fantastica' which has dark pink blooms that Ah, the yak and ‘yak hybrids’ — well shade to white in the throat, with attractive light loved and appreciated by Rhodo enthusiasts! green spotting. -
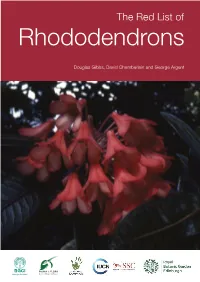
The Red List of Rhododendrons
The Red List of Rhododendrons Douglas Gibbs, David Chamberlain and George Argent BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL (BGCI) is a membership organization linking botanic gardens in over 100 countries in a shared commitment to biodiversity conservation, sustainable use and environmental education. BGCI aims to mobilize botanic gardens and work with partners to secure plant diversity for the well-being of people and the planet. BGCI provides the Secretariat for the IUCN/SSC Global Tree Specialist Group. Published by Botanic Gardens Conservation FAUNA & FLORA INTERNATIONAL (FFI) , founded in 1903 and the International, Richmond, UK world’s oldest international conservation organization, acts to conserve © 2011 Botanic Gardens Conservation International threatened species and ecosystems worldwide, choosing solutions that are sustainable, are based on sound science and take account of ISBN: 978-1-905164-35-6 human needs. Reproduction of any part of the publication for educational, conservation and other non-profit purposes is authorized without prior permission from the copyright holder, provided that the source is fully acknowledged. Reproduction for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission from the copyright holder. THE GLOBAL TREES CAMPAIGN is undertaken through a partnership between FFI and BGCI, working with a wide range of other The designation of geographical entities in this document and the presentation of the material do not organizations around the world, to save the world’s most threatened trees imply any expression on the part of the authors and the habitats in which they grow through the provision of information, or Botanic Gardens Conservation International delivery of conservation action and support for sustainable use. -

Rhododendron Garden * X = Hybrid; Var
Rhododendron Garden * x = hybrid; var. = variety; ssp. = subspecies; Bloom Bloom # Botanical Name * Cultivar Zone Growth Habit/Notes Color Time 1 Rhododendron x 'Amiblue' almost blue mid 7 dense tall, fragrant Chinese 2 Rhododendron auriculatum white late 5 native 3 Rhododendron x 'Sapphire' violet early 5 low, small leaves white-tinged small to medium Tibetan 4 Rhododendron bathyphyllum mid 6 pink native white, yellow large-leaf, hardy Great 5 Rhododendron x 'Capistrano' mid 5 throat Plant Pick fragrant Asian native, tall 6 Rhododendron decorum ssp. decorum white mid 7 shrub/small tree 7 Rhododendron dauricum x racemosum 'Ernie Dee' violet early 7 dwarf 8 Rhododendron x 'Golfer pale pink mid 6 mounding; hairy foliage 9 Rhododendron x 'Holden' rose red mid 5 medium Synonym ‘Kirin’; small 10 Rhododendron x 'Coral Bells' coral pink mid 6 evergreen azalea high altitude Asian native; 11 Rhododendron impeditum violet early 6 low low growth, high altitude 12 Rhododendron calostrotum ssp. keleticum violet early 5 Asian native shrub 13 Rhododendron x 'Lemon Dream' yellow mid 6 medium 14 Rhododendron x 'Lem's Monarch' pink mid 7 tall 15 Rhododendron x 'Mission Bells' pink mid 6 medium mounding 16 Rhododendron 'Patty Bee' yellow mid 6 small 17 Rhododendron x 'Peter Faulk' red early 7 tall, tree-like variegated, med-tall 18 Rhododendron ponticum var. cheiranthifolia 'Variegatum' violet mid 5 species selection 19 Rhododendron x 'President Roosevelt' red mid 7 variegated, medium 20 Rhododendron x 'Ramapo' violet early 5 dwarf, compact evergreen Rhododendron -

Self-Guided Tour
Self-Guided Tour Welcome to the Rhododendron Species Botanical Garden (RSBG). This self-guided tour will take approximately 1-1.5 hours depending upon how long you spend examining the plants. Please enjoy our 22 acre display of botanical splendor! Please keep in mind the following: Collecting seeds or any plant material is strictly prohibited. Smoking and pets are not allowed in the garden. Please remain on the paths. Picnicking is allowed only on the Conservatory Terrace. 2525 South 336 St. Federal Way, WA 98063 253-838-4646 www.rhodygarden.org Trivia: Did you know that Rhododendron Open All Year, Tuesday to Sunday means ‘Rose Tree’ in Greek? 10:00 to 4:00 Please follow the black numbered signs for this and R. hodgsonii*. In 10 years, most of the rhododen- Stumpery from the opposite end, and enjoy self-guided tour. From the Garden Shop, walk drons planted in this area will be 15 to 20 feet tall. the fall color of #15 Oxydendron arbo- straight to visit #1 Viburnum plicatum var. tomen- reum*, Sourwood. It is native to the Appa- tosum (Doublefile Viburnum) native to China and Take the path to the left to the display of #8 Rhododen- lachian Mountains and belongs to same Japan. This deciduous shrub provides beautiful white blos- dron rex* on both sides. This plant has extremely attrac- family as rhododendrons. It has fragrant white flow- soms in the spring as well as stunning reddish-bronze fall tive, shiny deep-green foliage with a thick gray to buff ers in summer. foliage color. Right behind is #2 Acer palmatum indumentum beneath. -

Dissertation, Bayreuth 2003
Molekularsystematische Untersuchungen an Vertretern der pflanzenparasitischen Gattung Exobasidium (Basidiomycota) Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften - Dr. rer. nat. - an der Fakultät für Biologie/ Chemie/ Geowissenschaften der Universität Bayreuth vorgelegt von Diplom-Biologin Heidi Döring aus Kassel Bayreuth 2003 Die vorliegende Arbeit wurde am Lehrstuhl für Pflanzensystematik der Universität Bayreuth unter der Betreuung von Herrn Prof. Dr. P. BLANZ (jetzt: Karl-Franzens-Universität Graz) angefertigt. Die dieser Arbeit zugrunde liegenden praktischen Laborarbeiten wurden im Zeitraum von Juli 1992 bis Januar 1995 sowie von März bis August 1997 durchgeführt. Teile der Arbeit wurden durch ein Stipendium und Forschungsgelder des Graduiertenkollegs „Pflanzen-Herbivoren-Systeme“ der Universität Bayreuth gefördert. Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften der Universität Bayreuth genehmigten Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.). Tag der Abgabe: 18.12.2003 Tag des wissenschaftlichen Kolloquiums: 07.05.2004 Mitglieder des Prüfungsausschusses: Herr Prof. Dr. P. BLANZ (Gutachter) Herr Prof. Dr. G. KRAUSS (Vorsitzender) Frau Prof. Dr. S. LIEDE-SCHUMANN Herr Prof. Dr. G. RAMBOLD (Gutachter) Herr Prof. Dr. W. SCHUMANN Teilergebnisse dieser Arbeit sind bereits veröffentlicht: BLANZ, P. & H. DÖRING (1995) Taxonomic relationships in the genus Exobasidium (Basidio- mycetes) based on ribosomal DNA analysis. Studies in Mycology 38: 119-127. DÖRING, H. & P. BLANZ (2000) 18S rDNA-Analysen bei der Gattung Exobasidium. Hoppea 61: 85-100. Teilergebnisse dieser Arbeit wurden auf Tagungen vorgestellt: Vorträge DÖRING, H. „RFLP-Analysen bei Arten der Gattung Exobasidium“- IV. Tagung der Gesell- schaft für Mykologie und Lichenologie, 16.-18.3.1994, Braunschweig. DÖRING, H., R. -

Rhododendron Garden * X = Hybrid; Var
Rhododendron Garden * x = hybrid; var. = variety; ssp. = subspecies; SS = species selection Bloom # Botanical Name * Cultivar Bloom Color Zone Growth Habit/Notes Time 1 Rhododendron x 'Amiblue' almost blue mid 7 dense tall, fragrant Chinese, 2 Rhododendron auriculatum white late 5 native; SS 3 Rhododendron x 'Sapphire' violet early 5 low, small leaves 4 Rhododendron x 'Ginny Gee' pink mid 6 low-growing azalea white, yellow large-leaf, hardy; Great 5 Rhododendron x 'Capistrano' mid 5 throat Plant Pick fragrant Asian native, tall 6 Rhododendron decorum ssp. decorum white mid 7 shrub/small tree; SS 7 Rhododendron dauricum x racemosum 'Ernie Dee' violet early 7 dwarf 8 Rhododendron x 'Golfer pale pink mid 6 mounding; hairy foliage 9 Rhododendron x 'Holden' rose red mid 5 medium 10 Rhododendron x 'Coral Bells' or 'Kirin' coral pink mid 6 small evergreen azalea high altitude Asian native; 11 Rhododendron impeditum violet early 6 low; SS 12 13 Rhododendron x 'Lemon Dream' yellow mid 6 medium 14 Rhododendron x 'Lem's Monarch' pink mid 7 tall 15 Rhododendron x 'Mission Bells' pink mid 6 medium mounding 16 Rhododendron 'Patty Bee' yellow mid 6 small 17 Rhododendron x 'Peter Faulk' red early 7 tall, tree-like 18 Rhododendron ponticum var. cheiranthifolia 'Variegatum' violet mid 5 variegated, med-tall; SS 19 Rhododendron x 'President Roosevelt' red mid 7 variegated, medium 20 Rhododendron x 'Ramapo' violet early 5 dwarf, compact evergreen 21 Rhododendron x 'Seaview Sunset' yellow-orange mid 7 medium 22 Rhododendron x 'Yaku Princess' white-pink mid 5 mounding form 23 Rhododendron x 'Sea-Tac' red early 7 small 24 25 Rhododendron Garden * x = hybrid; var. -

THE RHODODENDRON NEWSLETTER MARCH 2008 Published by the Australian Rhododendron Society, Victorian Branch Inc
THE RHODODENDRON NEWSLETTER MARCH 2008 Published by the Australian Rhododendron Society, Victorian Branch Inc. (A5896Z) P.O. Box 500, Brentford Square, Victoria 3131 Editor: Simon Begg Ph: (03) 9751 1610 email: [email protected] Picture site http://picasaweb.google.com/ARSVic Website www.vicrhodo.org.au Mobile 0438 340 240 FRIDAY APRIL 18th 2008 General Meeting at Nunawading at 8 pm Barry and Gaye Stagoll: Gardens of UK SATURDAY APRIL 19th and SUNDAY APRIL 20th Ferny Creek Horticultural Society AUTUMN SHOW SUNDAY APRIL 20TH 2008. PICNIC AT GEMBROOK AND VISIT TO PETER GENEAT’S NERINE NURSERY. 11.30am: Meet at JAC Russell Park, Main Rd Gembrook (next to Puffing Billy station) for a picnic lunch. BYO everything, BBQ available. Melway 312 K10 (ed. 28) 2.00pm Drive to Peter Geneat’s Nerine Farm/Nursery 164 Gembrook-Tonimbuk Rd Gembrook. Melway 299 D12 Peter is a cut flower grower and 4th generation nerine breeder. He has offered to show us his 16 acre farm. This is an excellent time of year to see and buy Peter’s hybrids and many other nerines in flower. Enquiries: Marcia Begg 9751 1610 FRIDAY MAY 16th 2008 General Meeting at Nunawading at 8 pm Surprise; bound to be good. To be Announced. FRIDAY JUNE 20th 2008 General Meeting at Nunawading at 8pm Parks Victoria Representative. SATURDAY JUNE 14th 10am-Noon Vireya Group at “Beechmont” 12 Mernda Road Olinda Followed by BBQ lunch; BYO everything 1 PRESIDENT’S REPORT Welcome to my second report, though I use the word report with my tongue in my cheek. -
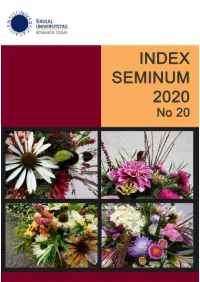
INDEX SEMINUM 2020 No 20
BOTANICAL GARDEN OF ŠIAULIAI UNIVERSITY INDEX SEMINUM 2020 No 20 2020 1 BOTANICAL GARDEN OF ŠIAULIAI UNIVERSITY ______________________________________________________________________________ Phone: +370 659 93748 E-mail: [email protected] Web: http://bs.su.lt/ Facebook: https://www.facebook.com/SUbotanikossodas/ Authors: Virginija Aleknienė, Martynas Kazlauskas, Rimanta Vainorienė, Žydrūnė Valainytė, Rita Šulskienė. Cover design Karolis Grušas Photos are from the archyve of botanical garden 2 ŠIAULIAI UNIVERSITY BOTANICAL GARDEN ŠIAULIAI AREA. Šiauliai is a city of Northern Lithuania. It counts its years from the Battle of Saulė which took place in 1236. Šiauliai is the fourth largest city by its population. Population: 106 400. HISTORY. Šiauliai University Botanical Garden was established in 1997 at the former site of Agrobiological Station of Šiauliai University. Total area of the garden is 6.54 ha. Since 2003 Botanical Garden of Šiauliai University is a member of Botanic Gardens Conservation International, Planta Europa Network, Association of Botanic Gardens in the Baltic Sea Region, Botanical Gardens of the Baltic Countries and the Association of Lithuanian University Botanic Gardens (LUBSA). Since 2005 the Botanic Garden is a member of International Network of Phenological Gardens of Europe (IPG). There is a Club of Botanic Garden Friends at the Botanical Garden. The Garden exchanges seeds with more than 300 botanical gardens of the world. Director: dr. Martynas Kazlauskas. Fields of research: • research on plant biodiversity ex situ and in situ, • research on introduction and acclimatization of ornamental plants, • phenological observations. Other activities: • ex situ conservation, • educational activities at the Botanical Garden, • organization of events at the Botanical Garden. COLLECTIONS OF THE BOTANICAL GARDEN. -

Optimizing Management Guidelines for the Non-Native Azalea Lace Bug On
Optimizing Management Guidelines for the Non-Native Azalea Lace Bug on Rhododendron Species in Western Washington Ryan R. Garrison A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science University of Washington 2020 Committee: Patrick Tobin Thomas M. Hinckley Soo-Hyung Kim Helena Puche Program Authorized to Offer Degree: Environmental and Forest Sciences © Copyright 2020 Ryan R. Garrison University of Washington Abstract Optimizing Management Guidelines for the Non-Native Azalea Lace Bug on Rhododendron Species in Western Washington Ryan R. Garrison Chair of the Supervisory Committee: Professor Patrick Tobin School of Environmental and Forest Sciences The non-native, invasive azalea lace bug, Stephanitis pyrioides (Scott), is one of the most serious insect pests of the genus Rhododendron, especially evergreen azaleas, an especially popular subgenus of Rhododendron. Feeding by nymphs and adults remove chlorophyll from leaves, reducing rates of photosynthesis and transpiration of infested plants, and causes stippling on the top of the leaf, which reduces the aesthetic value of infested plants. Severe infestations can lead to plant death. Introduced to the eastern U.S. from Japan in 1916, its presence in western Washington was confirmed in 2007. Research on azalea lace bug in the Pacific Northwest is extremely limited to date. In my thesis research, I investigated the seasonality of azalea lace bug in western Washington, and developed region-specific degree-day models to optimize sampling efforts and the timing of control measures. I also studied the susceptibility of Rhododendron spp. to azalea lace bug by assessing feeding damage in 71 different species and cultivars. -

Polly Hill Arboretum Plant Collection Inventory March 14, 2011 *See
Polly Hill Arboretum Plant Collection Inventory March 14, 2011 Accession # Name COMMON_NAME Received As Location* Source 2006-21*C Abies concolor White Fir Plant LMB WEST Fragosa Landscape 93-017*A Abies concolor White Fir Seedling ARB-CTR Wavecrest Nursery 93-017*C Abies concolor White Fir Seedling WFW,N1/2 Wavecrest Nursery 2003-135*A Abies fargesii Farges Fir Plant N Morris Arboretum 92-023-02*B Abies firma Japanese Fir Seed CR5 American Conifer Soc. 82-097*A Abies holophylla Manchurian Fir Seedling NORTHFLDW Morris Arboretum 73-095*A Abies koreana Korean Fir Plant CR4 US Dept. of Agriculture 73-095*B Abies koreana Korean Fir Plant ARB-W US Dept. of Agriculture 97-020*A Abies koreana Korean Fir Rooted Cutting CR2 Jane Platt 2004-289*A Abies koreana 'Silberlocke' Korean Fir Plant CR1 Maggie Sibert 59-040-01*A Abies lasiocarpa 'Martha's Vineyard' Arizona Fir Seed ARB-E Longwood Gardens 59-040-01*B Abies lasiocarpa 'Martha's Vineyard' Arizona Fir Seed WFN,S.SIDE Longwood Gardens 64-024*E Abies lasiocarpa var. arizonica Subalpine Fir Seedling NORTHFLDE C. E. Heit 2006-275*A Abies mariesii Maries Fir Seedling LNNE6 Morris Arboretum 2004-226*A Abies nephrolepis Khingan Fir Plant CR4 Morris Arboretum 2009-34*B Abies nordmanniana Nordmann Fir Plant LNNE8 Morris Arboretum 62-019*A Abies nordmanniana Nordmann Fir Graft CR3 Hess Nursery 62-019*B Abies nordmanniana Nordmann Fir Graft ARB-CTR Hess Nursery 62-019*C Abies nordmanniana Nordmann Fir Graft CR3 Hess Nursery 62-028*A Abies nordmanniana Nordmann Fir Plant ARB-W Critchfield Tree Fm 95-029*A Abies nordmanniana Nordmann Fir Seedling NORTHFLDN Polly Hill Arboretum 86-046*A Abies nordmanniana ssp. -

Rhododendrons International the Online Journal of the World’S Rhododendron Organizations
Rhododendrons International The Online Journal of the World’s Rhododendron Organizations V i s re n y ro as d en od Rhod Azaleas Volume 5, 2020 Rhododendrons International 1 Contents ii From the Editor, GLEN JAMIESON 1 Rhododendron occidentale and its Modern Day Plant Hunters. JIM INSKIP 17 The Nagoya Protocol: the Legal Framework and Challenges Ahead. CHARLES BRABIN 26 An Insect Apocalypse, and the Opportunity for Citizen Scientists to Monitor Rhododendron Pollinators. GLEN JAMIESON 32 Rhododendron Pollination: Looking beyond First Impressions. IAN EFFORD 41 Hybridising Rhododendrons. COLIN MUGRIDGE 51 Hidden Botanical Treasures of Japan. ATSUKO GIBSON JOURNAL CONTACTS Journal Editor: Glen Jamieson, Ph.D. Issue Layout: Sonja Nelson Journal Technical Reviewers: Gillian Brown, Steve Hootman, Hartwig Schepker, Barbara Stump, Juliana Medeiros Comments on any aspect of this journal and future articles for consideration should be submitted in digital form to: Dr. Glen Jamieson [email protected] Please put “Rhododendrons International” in the subject line. i From the Editor Dr. Glen Jamieson Parksville, BC Canada “Rhododendrons International” (RI) is an online journal distributed free to all the world’s known rhododendron associations for their internal distribution. It can also be accessed on the American Rhododendron Society website at https:// www. rhododendron.org/ri-index.htm. This fifth issue of RI includes five articles, some modified slightly from those printed initially, that I have extracted from various rhododendron publications that I feel are worthy of wider world-wide distribution. Articles in this volume are from “Rhododendron Species 2018,” the journal of the Rhododendron Species Botanical Garden in Federal Way, WA; “Rhododendrons, Camellias & Magnolias” 2018 and 2019, Royal Horticultural Society Group; and the “Journal American Rhododendron Society.” I regularly search botanical publications for worthwhile rhododendron articles I deem to be of international significance for wider distribution through RI issues. -

Mendelova Univerzita V Brně
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI Použití rodu Rhododendron L. v zahradní a krajinářské architektuře za první republiky Diplomová práce Vypracoval: Bc. Tomáš Schuch Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. Lednice, 2015 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Použití rodu Rhododendron L. v zahradní a krajinářské architektuře za první republiky“ vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Lednici dne: …………………………………………….. podpis 1 Poděkování Rád bych poděkoval prof. Ing. Miloši Pejchalovi, CSc. za vedení mé diplomové práce, odborné rady a připomínky, poskytnutí odborné literatury ze své osobní knihovny a za motivaci, která mě vedla k lepšímu výkonu, ochotě a vstřícnosti. Dále bych rád poděkoval svému dědovi Ing. Josefu Schuchovi CSc. za poskytnutí životních zkušeností, pomoc při psaní práce a doprovázení při terénních průzkumech a zároveň děkuji celé mé rodině za podporu.