Lebensstationen Prof. Dr. August Bier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Comprehensive Curriculum of the History of Regional Anesthesia
University of Massachusetts Medical School eScholarship@UMMS Anesthesiology and Perioperative Medicine Publications Anesthesiology and Perioperative Medicine 2019-09-18 A Comprehensive Curriculum of The History of Regional Anesthesia Gustavo Angaramo University of Massachusetts Medical School Et al. Let us know how access to this document benefits ou.y Follow this and additional works at: https://escholarship.umassmed.edu/anesthesiology_pubs Part of the Anesthesia and Analgesia Commons, Anesthesiology Commons, History of Science, Technology, and Medicine Commons, and the Medical Education Commons Repository Citation Angaramo G, Savage J, Arcella D, Desai MS. (2019). A Comprehensive Curriculum of The History of Regional Anesthesia. Anesthesiology and Perioperative Medicine Publications. Retrieved from https://escholarship.umassmed.edu/anesthesiology_pubs/193 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. This material is brought to you by eScholarship@UMMS. It has been accepted for inclusion in Anesthesiology and Perioperative Medicine Publications by an authorized administrator of eScholarship@UMMS. For more information, please contact [email protected]. Journal of Clinical Anesthesia and Pain Medicine Research Article A Comprehensive Curriculum of The History of Regional Anesthesia This article was published in the following Scient Open Access Journal: Journal of Clinical Anesthesia and Pain Medicine Received August 30, 2019; Accepted September 12, 2019; Published September 18, 2019 1 Gustavo Angaramo , James Savage, Abstract David Arcella and Manisha S. Desai1* Department of Anesthesiology and Perioperative The study of the past with regards to medical history has been an underemphasized Medicine, University of Massachusetts Medical component of the medical school curriculum for several reasons. School, Worcester, Massachusetts. -

Homenagem a August Karl Gustav Bier Por Ocasião Dos 100 Anos Da
Rev Bras Anestesiol ARTIGO DIVERSO 2008; 58: 4: 409-424 MISCELLANEOUS Homenagem a August Karl Gustav Bier por Ocasião dos 100 Anos da Anestesia Regional Intravenosa e dos 110 Anos da Raquianestesia* Eulogy to August Karl Gustav Bier on the 100th Anniversary of Intravenous Regional Block and the 110th Anniversary of the Spinal Block Almiro dos Reis Jr, TSA1 RESUMO Unitermos: ANESTESIA, Regional: subaracnóidea, venosa; Reis Jr. A — Homenagem a August Karl Gustav Bier por Ocasião dos ANESTESIOLOGIA: história. 100 Anos da Anestesia Regional Intravenosa e dos 110 Anos da Raquianestesia SUMMARY JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: August Karl Gustav Bier foi o in- Reis Jr A — Eulogy to August Karl Gustav Bier on the 100th Anni- trodutor de duas importantes técnicas de anestesia regional: a versary of Intravenous Regional Block and the 110th Anniversary of anestesia regional intravenosa e a anestesia subaracnóidea, Spinal Block. ambas até hoje amplamente empregadas. Completando neste ano de 2008 a primeira delas 100 anos e a segunda 110 anos de exis- BACKGROUND AND OBJECTIVES: August Karl Gustav Bier in- tência, seria mais do que justo prestarmos uma homenagem ao no- troduced two important techniques in regional block: intravenous tável médico que as criou. regional block and subarachnoid block, widely used nowadays. Since the first one celebrates its 100th anniversary and the second CONTEÚDO: O texto relata os dados familiares, estudantis inici- its 110th anniversary, it is only fair that we pay homage to this ex- ais, do curso acadêmico e da residência médica, as atividades pro- traordinary physician who created them. fissionais e universitárias, a personalidade, a aposentadoria e o falecimento de A. -
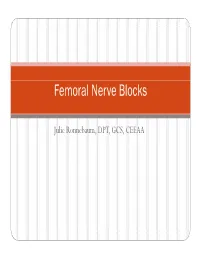
Femoral Nerve Blocks
Femoral Nerve Blocks Julie Ronnebaum, DPT, GCS, CEEAA Objectives 1. Become familiar with the evolution of peripheral nerve blocks. 2. Describe the advantages and disadvantages of femoral nerve blocks 3. Identify up-to-date information on the use of femoral nerve block. 4. Recognize future implications. History of Anesthesia The use of anesthetics began over 160 years ago. General Anesthesia In 1845, Horace Wells used nitrous oxide gas during a tooth extraction 1st- public introduction of general anesthesia October 16, 1846. Known as “Ether Day” ( William Morton) In front of audience at Massachusetts General Hospital First reported deat h in 1847 due to the ether Other complications Inttouctoroduction to eteteher was ppoogerolonged Vomiting for hours to days after surgery Schatsky, 1995, Hardy, 2001 History of Anesthesia In 1874, morphine introduced as a pain killer. In 1884, August Freund discovers cy clopropane for surgery Problem is it is very flammable In 1898, heroin was introduced for the addiction to morphine In 1923 Arno Luckhardt administered ethylene oxygen for an anesthetic History of Anesthesia Society History of Anesthesia Alternatives to general anesthesia In the 1800’s Cocaine used by the Incas and Conquistadors 1845, Sir Francis Rynd applied a morphine solution directly to the nerve to relieve intractable neuralgg(ia. ( first recorded nerve block) Delivered it by gravity into a cannula In 1855, Alexander Wood is a glass syringe to deliver the medication for a nerve block. ( also known as regg)ional anesthesia) In 1868 a Peruvian surgeon discovered that if you inject cocaine into the skin it numbed it. In 1884, Karl Koller discovered cocaine could be used to anesthetized the eye of a frog. -

Comparision of Dexmedetomidine and Fentanyl As Adjuvants to 0.5% Hyperbaric Bupivacaine in Spinal Anesthesia in Elective Lower Abdominal Surgeries
Indian Journal of Clinical Anaesthesia 2021;8(2):257–264 Content available at: https://www.ipinnovative.com/open-access-journals Indian Journal of Clinical Anaesthesia Journal homepage: www.ijca.in Original Research Article Comparision of dexmedetomidine and fentanyl as adjuvants to 0.5% hyperbaric bupivacaine in spinal anesthesia in elective lower abdominal surgeries V Sai Divya1, Rajola Raghu1, P Indira1,*, Sadhana Roy1 1Dept. of Anaesthesiology, Osmania Medical College and Hospital, Hyderabad, Telangana, India ARTICLEINFO ABSTRACT Article history: Spinal anesthesia has become most commonly used and choice of anaesthesia for surgeries on lower half of Received 03-01-2021 body after first planned spinal anaesthesia for surgery in man was administered by August Bier (1861–1949) Accepted 27-01-2021 on 16 August 1898, in Kiel(1), Germany. Coadministration of adjuvant drugs improve the quality and Available online 01-06-2021 duration of anesthesia and analgesia and patient safety. Aim of Study: To compare effects of Dexmedetomidine and Fentanyl as adjuvants to 3ml of 0.5% heavy bupivacaine injected intrathecally, in lower abdominal surgeries. Keywords: Design of the Study: Prospective randomized comparative study. Bupivacaine Materials and Methods: The study was approved by ethics committee and was conducted in 100 randomly Dexmedetomidine hydrochloride selected patients posted for elective lower abdominal surgeries in the age group 18-60yrs belonging to both Fentanyl citrate sex. Patients were divided into two groups- Group D (n=50) - received 5µg Dexmedetomidine+3ml 0.5% Spinal anesthesia heavy bupivacaine, Group F(n=50)-received 25µg Fentanyl +3ml 0.5% heavy bupivacaine, intrathecally respectively. Observations and Results: In group D patients onset of sensory block was significantly faster 2.620.56 mins (p<0.001) with better haemodynamic stability, intraoperative sedation, less incidence of side effects and analgesic sparing effect in post operative period when compared to group F. -

History of Pediatric Regional Anesthesia T.C.K
Pediatric Anesthesia ISSN 1155-5645 REVIEW ARTICLE History of pediatric regional anesthesia T.C.K. Brown Formerly, Department of Anaesthesia, Royal Childrens Hospital, Melbourne, Vic., Australia Keywords Summary spinal; caudal; epidural; children The history of local and regional anesthesia began with the discovery of Correspondence the local anesthetic properties of cocaine in 1884. Shortly afterwards nerve T.C.K. Brown, blocks were being attempted for surgical anesthesia. Bier introduced spinal 13 Alfred St., Kew, Vic. 3101, Australia anesthesia in 1898, two of his first six patients being children. Spinal Email: [email protected] anesthesia became more widely used with the advent of better local anes- thetics, stovaine and procaine in 1904–1905. Caudals and epidurals came Section Editor: Per-Arne Lonnqvist into use in children much later. In the early years these blocks were per- Accepted 16 May 2011 formed by surgeons but as other doctors began to give anaesthetics the spe- cialty of anesthesia evolved and these practitioners gradually took over this doi:10.1111/j.1460-9592.2011.03636.x role. Specific reports of their use in children have increased as pediatric anesthesia has developed. Spinals and other local techniques had periods of greater and lesser use and have not been universally employed. Initial loss of popularity seemed to relate to improvements in general anaesthesia. The advent of lignocaine (1943) and longer acting bupivacaine (1963) and increasing concern about postoperative analgesia in the 1970–1980s, contributed to the increased use of blocks. The history of pediatric regional anesthesia followed its France and a 1000 from Bier’s clinic in Germany in introduction in adults, which occurred after the discov- 1907, representing a huge increase in 3 years. -

Sudden Cardiac Arrest Under Spinal Anesthesia in a Mission Hospital: a Case Report and Review of the Literature Bamidele Johnson Alegbeleye
Alegbeleye Journal of Medical Case Reports (2018) 12:144 https://doi.org/10.1186/s13256-018-1648-5 CASEREPORT Open Access Sudden cardiac arrest under spinal anesthesia in a mission hospital: a case report and review of the literature Bamidele Johnson Alegbeleye Abstract Background: Sudden cardiac arrest following spinal anesthesia is relatively uncommon and a matter of grave concern for any anesthesiologist as well as clinicians in general. There have been, however, several reports of such cases in the literature. Careful patient selection, appropriate dosing of the local anesthetic, volume loading, close monitoring, and prompt intervention at the first sign of cardiovascular instability should improve outcomes. The rarity of occurrence and clinical curiosity of this entity suggest reporting of this unusual and possibly avoidable clinical event. Case presentation: We report the occurrence of unanticipated delayed cardiac arrest following spinal anesthesia in a 25-year-old Cameroonian man. Incidentally, the index patient was successfully resuscitated with timely and appropriate cardiopulmonary resuscitative measures. He went ahead to have emergency open appendectomy with good post-operative outcome and recovery. Conclusions: The management of such cardiac arrest under spinal anesthesia is very challenging in resource- limited settings such as ours. Anesthetists and clinicians need to be well informed of this grave complication. A good understanding of the physiologic changes caused by spinal anesthesia and its complications, adequate patient selection, respecting the contraindications of the procedure, adequate monitoring, and constant vigilance are of paramount importance to the eventual outcome. Keywords: Anesthesia-spinal, Cardiac arrest, Intraoperative complications, Resuscitation Background and prompt intervention in the management of sud- Ever since August Bier administered the first clinical den cardiac arrest under spinal anesthesia in a low- spinal anesthesia more than a century ago, it has become resource setting. -

Corning and Cocaine: the Advent of Spinal Anaesthesia
Grand Rounds Vol 9 pages L1–L4 Speciality: Landmark Case report Article Type: Case Report DOI: 10.1102/1470-5206.2009.L001 ß 2009 e-MED Ltd Corning and cocaine: the advent of spinal anaesthesia Alex Looseley Derby City General Hospital, Derby NHS Foundation Trust, Derby, UK Corresponding address: Dr Alex Looseley, Derby City General Hospital, Uttoxeter Road, Derby, DE22 3NE, UK. E-mail: [email protected] Date accepted for publication 17 June 2009 Abstract The inception of spinal anaesthesia can be traced to James Leonard Corning, a New York neurologist who inadvertently administered cocaine spinal anaesthesia in 1885. In 1898 August Karl Gustav Bier, a German surgeon, pioneered the successful use of operative spinal anaesthesia in lower limb surgery. Early spinal anaesthesia was fraught with complications but through advances in aseptic technique, anaesthetic agents and equipment, the seminal work of Corning and Bier has evolved into a widely established anaesthetic modality. Keywords Spinal anaesthetic; Leonard Corning; August Bier; history; development. Early history The very first spinal anaesthetic was delivered by accident. Its inception can be traced to the late 19th century and the work of a New York neurologist James Leonard Corning (1855–1923)[1]. Corning was born in Connecticut but received his medical education in Germany, graduating from the University of Wu¨rzburg in 1878. His earlier research was conducted using hydrochlorate of cocaine – the only available local anaesthetic agent at the time – first on the peripheral nervous system and later the central nervous system. He observed that subcutaneous injection of cocaine was associated with both vasoconstriction and local anaesthesia. -
Why Did August Bier and Ferdinand Sauerbruch Never Receive the Nobel Prize?
International Journal of Surgery 12 (2014) 998e1002 Contents lists available at ScienceDirect International Journal of Surgery journal homepage: www.journal-surgery.net Arts and humanities The Limit of a strong Lobby: Why did August Bier and Ferdinand Sauerbruch never receive the Nobel Prize? * Nils Hansson a, , Udo Schagen b a Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Universitatsmedizin€ Gottingen,€ Humboldtallee 36, D-37073 Gottingen,€ Germany b Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Charite - Universitatsmedizin€ Berlin, Thielallee 71, D-14159 Berlin, Germany highlights Bier and Sauerbruch were two of the most influential German surgeons. In 1937, Adolf Hitler prohibited all German citizens to accept a Nobel Prize. Bier and Sauerbruch were jointly awarded Hitler's alternative Nobel Prize. Their research was not evaluated as Nobel Prize-worthy. Political factors did not play a major role according to the protocols. article info abstract Article history: August Bier (1861e1949) and Ferdinand Sauerbruch (1875e1951) have remained two of the most Received 14 December 2013 influential figures during the first half of the 20th century in German and even in international surgery. Received in revised form They were jointly awarded Adolf Hitler's German Science Prize in 1937, but never the Nobel Prize for 9 July 2014 Physiology or Medicine, although no other German surgeons were nominated as often as Bier and Accepted 30 July 2014 Sauerbruch for the prestigeful award from 1901 to 1950. This contribution gives an overview of the Available online 2 August 2014 reasons why and by whom Bier and Sauerbruch were nominated, and discusses the reasons of the Nobel Prize Committee for not awarding them. -
9 Complications Associated with Spinal Anesthesia Pekka Tarkkila
9 Complications Associated with Spinal Anesthesia Pekka Tarkkila Spinal anesthesia celebrated its fi rst centennial in 1998 and still is one of the center- pieces of modern regional anesthesia. August Bier from Germany was the fi rst to publish a report of the fi rst successful spinal anesthesia with cocaine on his friend and assistant Hildebrandt. Since then, spinal anesthesia has gained worldwide popularity and an impressive safety record. However, the history of complications of spinal anes- thesia is as old as the method itself.1 The very fi rst spinal anesthetics were followed by postdural puncture headaches (PDPHs) as Bier and Hildebrandt both developed a headache after their experiment that, at least with Bier himself, was posture related. The wine and cigars consumed during the celebration of a successful experiment may have augmented the development of headache. In the early days of spinal anesthesia, it was claimed to be a very safe method of anesthesia and was used successfully even in operations on the head, neck, and thorax, with low mortality.2 After initial great popularity, some tragic events occurred with spinal anesthesia, at a time when major advances were being made in inhalation anesthesia, that almost made this technique obsolete, at least in the United Kingdom. The most famous of these tragedies was the Woolley and Roe case in which two patients, in adjoining operating rooms, became paraplegic following spinal anesthesia for relatively minor procedures.3 It is probable that this tragedy was caused by con- tamination of the spinal needles or syringes during the sterilization process.4 In the 1950s, the reputation of spinal anesthesia was restored, mostly as a result of several reports from Vandam and Dripps5 involving more than 10,000 patients. -

People Teaching Research People Teaching Research
PEOPLE TEACHING RESEARCH PEOPLE TEACHING RESEARCH Charité — excellence in health care CHARITÉ OFFERS OUTSTANDING HEALTH CARE. CHARITÉ’S STAFF MEMBERS DELIVER CLINICAL CARE, RESEARCH, AND TEACHING TO THE HIGH EST INTERNATIONAL STANDARD. ALL OF THEIR EFFORTS COMBINE EXCEPTIONAL EXPERTISE WITH SOCIAL RESPONSIBILITY. 1 Foreword 6 2 From ‘pest house’ to Europe‘s largest university hospital 8 More than 300 years of making people our purpose — insights into the history of Charité 9 Charité today — a leading health care organization with a social conscience 16 3 Medicine in all its facets — Charité‘s pillars of excellence 24 Highest standards of medical care 25 Nursing competence 28 Excellence in research 30 Cutting-edge concepts in teaching and learning 33 4 Health care priorities and research foci with international recognition 36 Neuroscience 37 Oncology 40 Regenerative therapies 42 Cardiology 45 Immunology 48 Genetics 50 5 Charité‘s strategic networks 52 Cooperative projects with industrial partners — from research innovation to practical application 53 Truly international 55 Charité Foundation — promoting innovation 57 World Health Summit — bringing experts together 59 Berlin Institute of Health — a model facility for translational research 62 6 Charité in numbers 64 Organogram 66 Content 5 1 Foreword Charité — Universitätsmedizin Berlin, which recently marked its 300-year anniversary, Welcome to Charité. For over 300 years, within the social care arena. Aside from is now the largest university hospital in Europe. Throughout its history, Charité has been we have been attracting people and interest, being responsible for the well-being of its dedicated to research, teaching, and medical care. We hope that our brochure ’People — not simply from within the Berlin area and patients, Charité is also actively involved in the rest of Germany, but also from all over supporting victims of violence. -

Dr. JFS Esserand His Influence on the Development of Plastic And
DR. J.F.S. ESSERAND HlS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIYE SURGERY Madrid, 1935 Dr. J.F.S. Esserand his influence on the development of plastic and reconstructive surgery Dr. J.F.S. Esseren zijn invloed op de ontwikkeling der plastische en reconstructieve chirurgie PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE ERASMUSUNIVERSITEIT ROTTERDAM OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS PROF. DR. J. SPERNA WEILAND EN VOLGENS BESLUITVAN HET COLLEGE VAN DE KANEN. DE OPENBARE VERDEDIGING ZAL PLAATSVINDEN OP WOENSDAG 9 NOVEMBER I983 TE 14.00 UUR DOOR BAREND HAESEKER geboren te Amerongen PROMOTOREN: PROF. DR. J.C. VAN DER MEULE"' PROF. DR. D. DE MOUUN Contents Preface VII PART ONE: A biography of Johannes Fredericus Samuel Esser ( 1877-1946) Introduetion 5 Early chiidhood and schoollife of Jan Esser. 8 Involvement in the development of chess in Holland I 0 Medica! studies: Leiden and Utrecht (1896-1903) 12 Medica! career. 15 Short historica! review of plastic surgery . 21 Esser's training in general surgery 28 Plastic and reconstructive ·surgery in Paris 31 Plastic surgery in Rotterdam . 35 World War I (1914-1918). 37 War surgery in Brünn 40 Vienna . 46 Budapest 53 Berlin (1917-1925) 60 Revolutionary movements in Russia and Germany 66 Plastic surgery in the First World War on the Allied side 74 Esser's plan for an international centre of plastic and reconstructive surgery 77 France 79 Soulh-America 82 Monaco. 85 Italy . 88 Crusade through Europe 96 Institut Esser de Chirurgie Structive 99 Greece (1937) 104 Sojourn in the United Statesof America . -

ORIGINAL ARTICLE STUDY of INJECTION TRAMADOL AS ADDITIVE in INTRAVENOUS REGIONAL ANESTHESIA Rajesh Subhedar1, Sandeep Patel2, Vishal V
DOI: 10.14260/jemds/2015/2113 ORIGINAL ARTICLE STUDY OF INJECTION TRAMADOL AS ADDITIVE IN INTRAVENOUS REGIONAL ANESTHESIA Rajesh Subhedar1, Sandeep Patel2, Vishal V. Ambre3, Preeti V. Jadhav4, Harshad Zambare5 HOW TO CITE THIS ARTICLE: Rajesh Subhedar, Sandeep Patel, Vishal V. Ambre, Preeti V. Jadhav, Harshad Zambare. “Study of Injection Tramadol as Additive in Intravenous Regional Anesthesia”. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2015; Vol. 4, Issue 85, October 22; Page: 14863-14868, DOI: 10.14260/jemds/2015/2113 ABSTRACT: Now a days IVRA is developed with use of double tourniquet and additive drugs like opioids, NSAIDS, muscle relaxants etc., to minimize the intraoperative discomfort of surgery and tourniquet pain. Many additives can take care of the post-operative pain. Each additive has its own pros and cons. Tramadol is a synthetic opioid analgesic having additional local anesthetic property and effect in neurotransmitter reuptake. With this background we studied the injection Tramadol 50mg as additive in IVRA against control group. METHODOLOGY: All the selected patients are from ASA Grade 1 and 2 for surgical procedure of upper limb. We have excluded the cases which are contraindicated for tourniquet and patients who are uncooperative and allergic to drug used for study. All 50 patients are divided in two groups. Group 1-25 patients who receive Intravenous Regional Anesthesia with injection lignocaine 0.5% 40cc volume. Group 2-25 patients who receive Intravenous Regional Anesthesia with injection Tramadol 50mgand injection lignocaine 0.5% total40ccvolume.After the drug is loaded in venous compartment sensory blocked is assessed at the interval of one min.