Mythos Andreas Hofer- Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va
GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

Zum Tiroler Musikleben in Der NS-Zeit. Franz Gratl
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen Jahr/Year: 2013 Band/Volume: 6 Autor(en)/Author(s): Gratl Franz Artikel/Article: Zum Tiroler Musikleben in der NS-Zeit. 25-41 © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at Abb. 1: Programm zu einem Konzert des Reichsgausymphonieorchesters im Rahmen des 7. Landesschießens 1944. © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at ZUM TIROLER MUSIKLEBEN IN DER NS-ZEIT Franz Gratl ABSTRACT Man will von der Vergangenheit loskommen: mit Recht, weil unter ihrem Schatten gar nicht sich leben läßt, und weil des The paper presents a general overview of Tyrolean musical Schreckens kein Ende ist, wenn immer nur wieder Schuld life from 1938 to 1945. A “music letter” by an anonymous und Gewalt mit Schuld und Gewalt bezahlt werden soll; mit author, published in the South German newspaper “Dolo- Unrecht, weil die Vergangenheit, der man entrinnen möchte, miten” in 1945, is taken as a starting point; it provides noch höchst lebendig ist. valuable insight on the development of the local music Theodor W. Adorno1 scene. The bourgeois concert circuit became less important and its promoters came under the influence of NS organisa- Der folgende Abriss des Tiroler Musiklebens in der NS- tions, while the regime in general and especially the local Zeit kann und will keinem Anspruch auf Vollständigkeit Gauleiter Franz Hofer favoured “folk culture” as a proper genügen. Angestrebt wird vielmehr eine Darstellung, die instrument for Nazi propaganda. The “Landestheater” was dem Leser in konziser Form einen Einblick in die Entwick- transformed into the “Reichsgautheater” and received lungen und Organisationsstrukturen bietet, die Institutionen special appreciation; theatre director Max Alexander und handelnde Personen benennt. -

Treibsätze Der Geschichtspolitik. Die Gedenkfeiern Der Tiroler Erhebung 1909–2009
Treibsätze der Geschichtspolitik. Die Gedenkfeiern der Tiroler Erhebung 1909–2009 Hans Heiss Sandwirt: Büxenlader! Ös müeßts ladn. Grad was ös derladets. Der Hörtnagl (stachlig): Müeßn? (Hält in der Arbeit inne). Sandwirt: (begütigend): Na, na Hörtnagl, müeßen tuest nit. Der Hörtnagl (nimmt seine Arbeit wieder auf): Afn ganzn Berg Isl ist koaner, der mueß. Die Szene aus „Volk in Not“ von Karl Schönherr greift zwei Schlüsselmotive von 1809 auf: Freiheit und Zwang. Dem Sandwirt, der am Bergisel seine Schützen dazu verhalten will, aus vollen Rohren in den Kampf zu gehen, kontert der Hörtnagl: Wer die Freiheit wolle, müsse nicht müssen. Der Widerhall des Gedenkens 2009 wird es anders sein: Süd- und Nordtirol haben keine Wahl, sondern müssen die Tiroler Erhebung feiern, sie haben sich dem Gedenken zu stellen und nach einer angemessenen Form zu suchen. Die Offensive des Gedenkens läuft seit langem, angetrieben von landeskonservativer bzw. von rechter Seite, die ihre patriotisch-festgefügten Visionen bereits entwickelt hat. Die bewährten Mechanismen des Gedenkens kommen leicht in Gang. Ein musikalischer Vergleich aus der Populärmusik sei erlaubt: Die Amplifikatoren des Gedenkens gleichen einem Paar alter, oft benutzter Marshall-Verstärker, die man nur einzustöpseln braucht, um ihren bulligen Sound zu aktivieren. Die Beschallung hat bereits eingesetzt und wird sich bis Ende 2009 zum dröhnenden Crescendo steigern. Wer dagegen eine andere Tonlage historischer Erinnerung oder Traditionspflege wünscht, findet weit schwerer Gehör. Zudem scheint die Landespolitik in Nord- und Südtirol bis zur Stunde nicht in der Lage, programmatische Leitlinien und Rahmenvorgaben zu entwickeln, um den Automatismen der Tradition und dem darauf aufbauenden Wildwuchs wirkungsvoll zu begegnen. Die Virulenz und Lebenskraft des Hofer-Mythos, des Gedenkens an Anno Neun, gründen auf dem Erfolg und Verlauf der bisherigen Gedenkjahre. -

Nazi Soundscapes Sound, Technology and Urban Space in Germany, 1933-1945 CAROLYN BIRDSALL
Nazi Soundscapes Sound, Technology and Urban Space in Germany, 1933-1945 CAROLYN BIRDSALL AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Nazi Soundscapes Nazi Soundscapes Sound, Technology and Urban Space in Germany, 1933-1945 Carolyn Birdsall amsterdam university press This book is published in print and online through the online OAPEN library (www.oapen.org) OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) is a collaborative initiative to develop and implement a sustainable Open Access publication model for academic books in the Humani- ties and Social Sciences. The OAPEN Library aims to improve the visibility and usability of high quality academic research by aggregating peer reviewed Open Access publications from across Europe. Cover illustration: Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger, 1936. © BPK, Berlin Cover design: Maedium, Utrecht Lay-out: Heymans & Vanhove, Goes isbn 978 90 8964 426 8 e-isbn 978 90 4851 632 2 (pdf) e-isbn 978 90 4851 633 9 (ePub) nur 686 / 962 Creative Commons License CC BY NC ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0) Vignette cc C. Birdsall / Amsterdam University Press, Amsterdam 2012 Some rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, any part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise). Every effort has been made to obtain permission to use all copyrighted illustrations reproduced in this book. Nonetheless, whosoever believes to have rights to this material is advised to contact the publisher. Content Acknowledgements 7 Abbreviations 9 Introduction 11 1. -

Il Tirolo in Guerra P
Università degli Studi di Cagliari Scuola di Dottorato in Studi Filologici e Letterari Ciclo XXII So schlagen wir mit ganzer Wucht/Die Feinde krumm und klein. La costruzione della propaganda nei Supplementi letterari della «Tiroler Soldaten-Zeitung» L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE Presentata da: Maria Rita Murgia Coordinatore Dottorato: Prof. Laura Sannia Relatore: Prof. Mauro Pala Esame finale anno accademico 2009 - 2010 Indice Introduzione p. 4 Il Kriegspressequartier e la propaganda per i soldati p. 7 Per una breve storia del Kriegspressequartier p. 7 La Filmstelle p. 10 La propaganda nell’Italia occupata p. 11 La Pressegruppe p. 13 La propaganda per i soldati p. 14 Gli spettacoli collettivi: il teatro da campo p. 16 Case del soldato e letture di trincea p. 17 I giornali per i soldati p. 18 Il giornale della Prima armata p. 18 La guerra e i due volti della censura p. 21 La Berichterstattergruppe e la militarizzazione dei corrispondenti di guerra p. 21 Le condizioni di lavoro dei Berichterstatter p. 22 La censura governativa p. 23 L’esperienza dei Kriegsmaler p. 24 Il Tirolo in guerra p. 26 Il bastione Tirolo e la mobilitazione dei Landesschützen p. 26 I provvedimenti anti-irredentisti dell’amministrazione militare p. 29 La propaganda nel Tirolo in guerra p. 34 La «Tiroler Soldaten-Zeitung» p. 38 Giornale di trincea o giornale per soldati? p. 38 Il giornale della prima armata arriva in Tirolo p. 41 Il supplemento letterario di trincea p. 45 Il foglio di propaganda p. 49 1 Il mondo secondo i Supplementi letterari della Tsz p. -

Das Sondergericht Für Die Operationszone Alpenvorland 1943-1945. Ein Vorbericht Gerald Steinacher University of Nebraska-Lincoln, [email protected]
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Faculty Publications, Department of History History, Department of 2002 " ... verlangt das gesunde Volksempfinden die schwerste Strafe ...": Das Sondergericht für die Operationszone Alpenvorland 1943-1945. Ein Vorbericht Gerald Steinacher University of Nebraska-Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub Part of the European History Commons, European Languages and Societies Commons, Military History Commons, and the Political History Commons Steinacher, Gerald, "" ... verlangt das gesunde Volksempfinden die schwerste Strafe ...": Das Sondergericht für die Operationszone Alpenvorland 1943-1945. Ein Vorbericht" (2002). Faculty Publications, Department of History. 148. http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/148 This Article is brought to you for free and open access by the History, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications, Department of History by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Klaus Eisterer (Hrsg.) Tirol zwischen Diktatur und Demokratie (1930-1950) Beiträge für Rolf Steininger zum 60. Geburtstag Studien Verlag Innsbruck Wien München Bozen ©2002 by Studien Verlag Ges.m.b.H. Amraser Straße 118,A-6010 Innsbruck e-mail: [email protected] www.studienverlag.at Die Drucklegung dieser Arbeit wurde durch die finanzielle Unterstützung des Bundesministe riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Wien, des Landes Tirol, der Südtiroler Landes regierung/ Abteilung für deutsche und ladinische Kultur, des Landes Vorarlberg, der Stadt Inns bruck, des Universitätsfonds der Stadt Innsbruck, der Universität Innsbruck und der Stadt Bozen ermöglicht. Buchgestaltung nach Entwürfen von Ku;t Höretzeder/Circus, Innsbruck Satz und Umschlag: Karin Berner/Studienverlag Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem Papier. -

Nazi Party from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read View source View history Nazi Party From Wikipedia, the free encyclopedia This article is about the German Nazi Party that existed from 1920–1945. For the ideology, see Nazism. For other Nazi Parties, see Nazi Navigation Party (disambiguation). Main page The National Socialist German Workers' Party (German: Contents National Socialist German Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (help·info), abbreviated NSDAP), commonly known Featured content Workers' Party in English as the Nazi Party, was a political party in Germany between 1920 and 1945. Its Current events Nationalsozialistische Deutsche predecessor, the German Workers' Party (DAP), existed from 1919 to 1920. The term Nazi is Random article Arbeiterpartei German and stems from Nationalsozialist,[6] due to the pronunciation of Latin -tion- as -tsion- in Donate to Wikipedia German (rather than -shon- as it is in English), with German Z being pronounced as 'ts'. Interaction Help About Wikipedia Community portal Recent changes Leader Karl Harrer Contact page 1919–1920 Anton Drexler 1920–1921 Toolbox Adolf Hitler What links here 1921–1945 Related changes Martin Bormann 1945 Upload file Special pages Founded 1920 Permanent link Dissolved 1945 Page information Preceded by German Workers' Party (DAP) Data item Succeeded by None (banned) Cite this page Ideologies continued with neo-Nazism Print/export Headquarters Munich, Germany[1] Newspaper Völkischer Beobachter Create a book Youth wing Hitler Youth Download as PDF Paramilitary Sturmabteilung -

Landscapes of Glory and Grief: Representations of the Italian Front and Its Topography in the Art of Stephanie Hollenstein and A
Landscapes of Glory and Grief: Representations of the Italian Front and its Topography in the Art of Stephanie Hollenstein and Albin Egger-Lienz, and the Poetry of Gustav Heinse By Francesca Roe A dissertation submitted to the University of Bristol in accordance with the requirements for award of the degree of MPhil in the Faculty of Arts, School of Modern Languages (German), August 2014. Supervised by Professor Robert Vilain and Doctor Steffan Davies Student Number: 1346104 25,000 Words 1. Historicist Idealism and Regional Identities: The Outbreak of War in Austria- Hungary In August 1914, the Berlin dramatist and critic Julius Bab and the Prague Germanist Adolf von Hauffen conducted independent analyses of German-language newspapers, magazines and pamphlets, and both concluded that an astonishing 50,000 pro-war poems were published daily in that month alone.1 Although it is difficult to state with certainty whether the researchers included Austro-Hungarian publications in their estimations (it would have been unusual for the conservative von Hauffen to have ignored the material published in his homeland), a brief survey of the poetry produced in the Dual Monarchy2 confirms that its German-speaking population experienced a ‘Kriegsbegeisterung’ just as profound as that of their German counterparts, a vociferous enthusiasm for war that affected individuals from all classes, generations and professions, and led to a remarkable outpouring of propagandist art and literature across the Habsburg Empire. 1 Klaus Zelewitz, ‘Deutschböhmische Dichter und der Erste Weltkrieg’, in Österreich und der Große Krieg 1914-1918. Die andere Seite der Geschichte, ed. by Klaus Amann and Hubert Lengauer (Vienna: C. -

Il Tribunale Speciale Per La Zona D'operaizoni Nelle Prealpi 1943-1945: Una Relazione Preliminare
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Faculty Publications, Department of History History, Department of 2003 «… richiedono il massimo rigore della pena!»: il Tribunale speciale per la Zona d'operaizoni nelle Prealpi 1943-1945: una relazione preliminare Gerald Steinacher University of Nebraska-Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub Steinacher, Gerald, "«… richiedono il massimo rigore della pena!»: il Tribunale speciale per la Zona d'operaizoni nelle Prealpi 1943-1945: una relazione preliminare" (2003). Faculty Publications, Department of History. 132. https://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/132 This Article is brought to you for free and open access by the History, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications, Department of History by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Published in Ribelli di confine: la Resistenza in Trentino, ed. Giuseppe Ferrandi & Walter Giuliano (Collana: Quaderni di Archivio Trentino, 2003). Gerald Steinacher* « ... richiedono il massimo rigore della pena!» il Tribunale speciale per la Zona d'operazioni nelle Prealpi 1943-1945 una relazione preliminare . Dalla fine della guerra nel 1945 gli atti dell' «Ufficio del Commissario Supremo per la Zona di Operazioni nelle Prealpi» Franz Hofer sono con siderati dispersP. Sia la situazione delle fonti che le conoscenze attuali relative alla sto ria della Zona d'operazioni nelle Pre alpi risultano quindi scarse, in particolar modo per quanto riguar da il Tribunale speciale della Zona di operazioni nelle Prealpi. Nel corso di un sopraluogo presso l'archivio del Tribunale di Bolzano Facciata della Villa Brigl nell' ottobre 2001 è stato possibile recuperare una piccola parte della Tribunale speciale. -

The South Tyrol Question, 1866–2010 10 CIS ISBN 978-3-03911-336-1 CIS S E I T U D S T Y I D E N T I Was Born in the Lower Rhine Valley in Northwest Germany
C ULTURAL IDENT I TY STUD I E S The South Tyrol Question, CIS 1866–2010 Georg Grote From National Rage to Regional State South Tyrol is a small, mountainous area located in the central Alps. Despite its modest geographical size, it has come to represent a success story in the Georg Grote protection of ethnic minorities in Europe. When Austrian South Tyrol was given to Italy in 1919, about 200,000 German and Ladin speakers became Italian citizens overnight. Despite Italy’s attempts to Italianize the South Tyroleans, especially during the Fascist era from 1922 to 1943, they sought to Question, 1866–2010 Tyrol South The maintain their traditions and language, culminating in violence in the 1960s. In 1972 South Tyrol finally gained geographical and cultural autonomy from Italy, leading to the ‘regional state’ of 2010. This book, drawing on the latest research in Italian and German, provides a fresh analysis of this dynamic and turbulent period of South Tyrolean and European history. The author provides new insights into the political and cultural evolution of the understanding of the region and the definition of its role within the European framework. In a broader sense, the study also analyses the shift in paradigms from historical nationalism to modern regionalism against the backdrop of European, global, national and local historical developments as well as the shaping of the distinct identities of its multilingual and multi-ethnic population. Georg Grote was born in the Lower Rhine Valley in northwest Germany. He has lived in Ireland since 1993 and lectures in Western European history at CIS University College Dublin. -
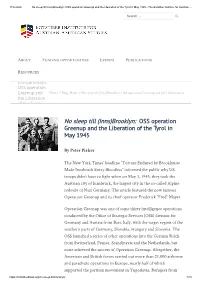
OSS Operation Greenup and the Liberation of the Tyrol in May 1945 - the Botstiber Institute for Austrian…
17.6.2020 No sleep till (Inns)Brooklyn: OSS operation Greenup and the Liberation of the Tyrol in May 1945 - The Botstiber Institute for Austrian… Search ... ABOUT FUNDING OPPORTUNITIES EVENTS PUBLICATIONS RESOURCES (Inns)Brooklyn: OSS operation Greenup and Home / Blog, News / No sleep till (Inns)Brooklyn: OSS operation Greenup and the Liberation of the Liberation of the Tyrol in No sleep till (Inns)Brooklyn: OSS operation Greenup and the Liberation of the Tyrol in May 1945 By Peter Pirker The New York Times’ headline “Torture Endured by Brooklynite Made Innsbruck Entry Bloodless” informed the public why US troops didn’t have to fight when on May 3, 1945, they took the Austrian city of Innsbruck, the largest city in the so-called Alpine redoubt of Nazi Germany. The article featured the now famous Operation Greenup and its chief operator Frederick “Fred” Mayer. Operation Greenup was one of some thirty intelligence operations conducted by the Office of Strategic Services (OSS) division for Germany and Austria from Bari, Italy, with the target region of the southern parts of Germany, Slovakia, Hungary and Slovenia. The OSS launched a series of other operations into the German Reich from Switzerland, France, Scandinavia and the Netherlands, but none achieved the success of Operation Greenup. Altogether, the American and British forces carried out more than 21,000 airborne and parachute operations in Europe, nearly half of which supported the partisan movement in Yugoslavia. Refugees from https://botstiberbiaas.org/no-sleep-till-brooklyn/ 1/10 17.6.2020 No sleep till (Inns)Brooklyn: OSS operation Greenup and the Liberation of the Tyrol in May 1945 - The Botstiber Institute for Austrian… across the entire Nazi dominion in Europe, antifascists in exile and local members of the resistance were involved in this collaboration to the extent it could be referred to as a transnational resistance against the Axis Powers. -

Die NS-Machtübernahme: Begeisterung Und Verfolgung
Die NS-Machtübernahme: Begeisterung und Verfolgung Wie kommt die NSDAP an die Macht? Im Deutschen Reich läuft die militärische Aufrüstung auf Hochtouren. Österreich spielt in den Plänen Hitlers, der deutschen Industrie und Banken eine wichtige Rol- le. Die geografische Lage des Landes ist für die Kriegspläne Deutschlands besonders interessant. Millionen ÖsterreicherInnen sind für Deutschland als Soldaten und Ar- beitskräfte von großer Bedeutung. Nicht nur weltanschauliche Gründe („Heimkehr ins Großdeutsche Reich“), sondern vor allem wirtschaftliche Motive machen Österreich so wichtig. Das Land ist reich an Rohstoffen, die die deutsche Kriegsindustrie dringend benötigt: Erze, Magnesit, Grafit, Öl, Edelstahl, Wasserkraft usw. Besonders begehrt sind die österreichischen Gold- und Devisenvorräte, denn nach fünfjähriger NS-Herrschaft ist Deutschland fast pleite. Der österreichische Barschatz ist 18-mal größer als der des Deutschen Reiches. In Österreich gibt es noch Lebensmittel und Konsumgüter zu kau- fen, die in Deutschland schon lange nicht mehr erhältlich sind. 57 Die NS-Macht- Das Abkommen von Berchtesgaden übernahme: Begeisterung und Ab Jahresbeginn 1938 verstärkt sich der Druck des Deutschen Reiches auf die öster- Verfolgung reichische Bundesregierung erheblich. Am 12. Februar 1938 zitiert Adolf Hitler Bun- deskanzler Kurt Schuschnigg auf den Obersalzberg bei Berchtesgaden. Schuschnigg ist Hitlers Psychoterror nicht gewachsen. Er erklärt sich bereit, die gesamte Politik Österreichs mit Deutschland abzustimmen. Die österreichischen Nationalsozialist- Innen dürfen sich im Rahmen der Organisationen des „Ständestaates“ politisch be- tätigen. Inhaftierte Nationalsozialisten werden entlassen, der Nationalsozialist Arthur Seyß-Inquart als Innenminister in die Regierung aufgenommen. Die vielen Zugeständnisse wirken sich auf die Stimmung in Österreich negativ aus. Die Moral der AnhängerInnen des „Ständestaates“ und all jener, die eine NS-Machter- greifung verhindern wollen, verschlechtert sich dramatisch.