Swr2-Musikstunde-20111207.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
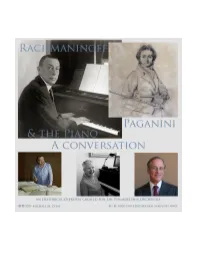
Rachmaninoff, Paganini, & the Piano; a Conversation
Rachmaninoff, Paganini, & the Piano; a Conversation Tracks and clips 1. Rachmaninoff in Paris 16:08 a. Niccolò Paganini, 24 Caprices for Solo Violin, Op. 1, Michael Rabin, EMI 724356799820, recorded 9/5/1958. b. Sergey Rachmaninoff (SR), Rapsodie sur un theme de Paganini, Op. 43, SR, Leopold Stokowski, Philadelphia Orchestra (PO), BMG Classics 09026-61658, recorded 12/24/1934 (PR). c. Fryderyk Franciszek Chopin (FC), Twelve Études, Op. 25, Alfred Cortot, Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG) 456751, recorded 7/1935. d. SR, Piano Concerto No. 3 in d, Op. 30, SR, Eugene Ormandy (EO), PO, Naxos 8.110601, recorded 12/4/1939.* e. Carl Maria von Weber, Rondo Brillante in E♭, J. 252, Julian Jabobson, Meridian CDE 84251, released 1993.† f. FC, Twelve Études, Op. 25, Ruth Slenczynska (RS), Musical Heritage Society MHS 3798, released 1978. g. SR, Preludes, Op. 32, RS, Ivory Classics 64405-70902, recorded 4/8/1984. h. Georges Enesco, Cello & Piano Sonata, Op. 26 No. 2, Alexandre Dmitriev, Alexandre Paley, Saphir Productions LVC1170, released 10/29/2012.† i. Claude Deubssy, Children’s Corner Suite, L. 113, Walter Gieseking, Dante 167, recorded 1937. j. Ibid., but SR, Victor B-24193, recorded 4/2/1921, TvJ35-zZa-I. ‡ k. SR, Piano Concerto No. 3 in d, Op. 30, Walter Gieseking, John Barbirolli, Philharmonic-Symphony Orchestra, Music & Arts MACD 1095, recorded 2/1939.† l. SR, Preludes, Op. 23, RS, Ivory Classics 64405-70902, recorded 4/8/1984. 2. Rachmaninoff & Paganini 6:08 a. Niccolò Paganini, op. cit. b. PR. c. Arcangelo Corelli, Violin Sonata in d, Op. 5 No. 12, Pavlo Beznosiuk, Linn CKD 412, recorded 1/11/2012.♢ d. -
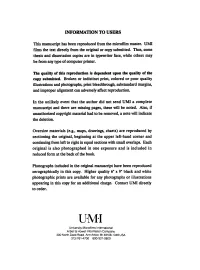
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI University Microfilms international A Bell & Howell Information Company 300 North! Z eeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 9130640 The influence of Leonard B. Smith on the heritage of the band in the United States Polce, Vincent John, Ph.D. -
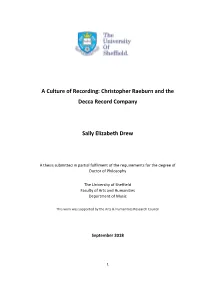
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company Sally Elizabeth Drew A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Sheffield Faculty of Arts and Humanities Department of Music This work was supported by the Arts & Humanities Research Council September 2018 1 2 Abstract This thesis examines the working culture of the Decca Record Company, and how group interaction and individual agency have made an impact on the production of music recordings. Founded in London in 1929, Decca built a global reputation as a pioneer of sound recording with access to the world’s leading musicians. With its roots in manufacturing and experimental wartime engineering, the company developed a peerless classical music catalogue that showcased technological innovation alongside artistic accomplishment. This investigation focuses specifically on the contribution of the recording producer at Decca in creating this legacy, as can be illustrated by the career of Christopher Raeburn, the company’s most prolific producer and specialist in opera and vocal repertoire. It is the first study to examine Raeburn’s archive, and is supported with unpublished memoirs, private papers and recorded interviews with colleagues, collaborators and artists. Using these sources, the thesis considers the history and functions of the staff producer within Decca’s wider operational structure in parallel with the personal aspirations of the individual in exerting control, choice and authority on the process and product of recording. Having been recruited to Decca by John Culshaw in 1957, Raeburn’s fifty-year career spanned seminal moments of the company’s artistic and commercial lifecycle: from assisting in exploiting the dramatic potential of stereo technology in Culshaw’s Ring during the 1960s to his serving as audio producer for the 1990 The Three Tenors Concert international phenomenon. -

Lynn Freeman Olson Collection Cassette
LYNN FREEMAN OLSON COLLECTION CASSETTE RECORDINGS LIST Beethoven 9 Symphonien Ouverturen (6 tape boxed set)- Karajan Berliner Philharmonikar Vivaldi: Two Concertos for Two Violins / Two Sonatas for Two Violins and Continuo - Aston Magna Vivaldi: Concerti E Sinfonie - I Solisti Veneti/Claudio Scimone Mahler: Symphony No. 10 - Philadelphia Orchestra / James Levine (2 cassettes) Mahler: Symphony So, 1 - London Philharmonic - Klaus Tennstedt Debussy: 3 Nocturnes Ravel: Pavane & Bolero - Moscow Radio Large Symphony Orchestra / Yevgeni Svetlanov Debussy: La Mer, Nocturnes - Cleveland Orchestra/ Lorin Maazel Rachmaninoff: Symphony No. 2 - Royal Philharmonic Orchestra / Yuri Temirkanov Rachmaninoff: Symphony Mo. 3 Shostakovich: Symphony No. 6 - London Symphony Orchestra / Andre Previn Rachmaninoff: Second Piano Concerto - Balakirev Islamey, Julius Katchen - London Symphony Orchestra / Sir Georg Solti Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 - Vladimir Ashkenazy - The London Symphony / Anatola Fistoulari Rachmaninoff: Piano Concertos 2 & 4 -Vladimir Ashkenazy - Concertgebouw Orchestra / Bernard Haitink Shostakovich: Symphony No. 11 ("1905") - Houston Symphony Orchestra / Leopold Stokowski Shostakovich: Symphony No. 6 / The Age of Gold (Ballet Suite) - Chicago Symphony / Leopold Stokowski Shostakovich: Symphony No. 7 ("Leningrad") - Bournemouth Symphony Orchestra / Paavo Berglund Shostakovich: Symphony No. 10 e minor Op, 93 - Austrian Broadcast Symphony Orchestra / Milan Horvat (2 cassette set) LYNN FREEMAN OLSON REFERENCE COLLECTION OF RECORDED SOUND -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Summer, 1963-1964
ewoo %,m A.-;£> r^ u* BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA ERICH LEINSDORF ^ Music Director -T^jj^i % Berkshire Festival 1963 I^^HMMUBBI^BB AN INVITATION TO HEAR THE DEBUT RECORDING BY LORIN HOLLANDER WITH THE BOSTON SYMPHONY UNDER THE DIRECTION OF ERICH LEINSDORF mmmv«Mx::miiWmi :: W>i Lorm Hollander was the first soloist chosen by Mr. " Leinsdorf to record with "The Aristocrat of Or- SSI»Y«M6 chestras." is in The album recorded RCA Victor's Dello Joio/ Fantasy and Variations new DYNAGROOVE system and captures to per- Ravel/Concerto in G Boston Symphony Orch./Leinsdorf fection Hollander's dazzling performance of The Aristocrat of Orchestras Ravel's Concerto in G , and the first recorded per- formance of Dello Joio's Fantas y, composed es- " pecially for Mr. Hollander. Acclaimed as . the outstanding member of his generation," watch for more recordings by Hollander and by the Boston Lorin Hollander Symphony under Mr. Leinsdorf's direction, exclu- sively on the Red Seal label. This album is avail- RCA VICTOR able in Living Stereo, Mono. Hi-Fi and on Tape. THE MOST TRUSTED NAME IN SOUND ^l, i Boston Symphony Orchestra ERICH LEINSDORF, Music Director Richard Burgin, Associate Conductor Berkshire Festival, Season ig6^ TWENTY-SIXTH SEASON MUSIC SHED AT TANGLEWOOD, LENOX, MASSACHUSETTS SEVENTH WEEK Concert Bulletin, with historical and descriptive notes by John N. Burk Copyright, 1963 by Boston Symphony Orchestra, Inc. The Trustees of The BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA, Inc. President Vice-President Treasurer Henry B. Cabot Talcott M. Banks Richard C Paine Abkam Berkowitz E.. Morton Jennings, Jr. Sidney R. Rabb Theodore P. -

Decca Discography
DECCA DISCOGRAPHY >>2 GREAT BRITAIN: ffrr, 1944-57 In a business where exclusive contracts were the norm, it was very difficult for a newcomer to become established and Decca’s initial roster of classical artists was unable to compete with established rivals. In March 1932 an agreement with Polydor provided access to a substantial catalogue of German artists and a year later the company virtually abandoned classical recording to concentrate on dance bands. The move to Thames Street Studios provided more scope for orchestral sessions and a bold policy of recording contemporary British music enhanced the label’s reputation. The newly formed Boyd Neel Orchestra was signed up in 1934, followed by the Griller String Quartet in 1935, Clifford Curzon in 1937, Peter Pears in 1944, Kathleen Ferrier in 1946 and Julius Katchen in 1947. War broke the link with Polydor, leaving Decca with a respectable catalogue of chamber music, but little symphonic repertoire. Armed with ffrr technology, the company began to remedy this in 1944, engaging Sidney Beer’s National Symphony Orchestra until 1947 and the misleadingly named New Symphony Orchestra (it had made its first recordings in 1909) from 1948. Neither developed into a house band to rival EMI’s Philharmonia and, with the Royal Philharmonic also exclusive to EMI, Decca had to resort to the LSO and the LPO, both in rather run-down condition in the post-war years. Meanwhile every opportunity was taken to impress visiting continental orchestras with ffrr sessions and it was evident that the company intended to transfer much of its symphonic work to Paris, Amsterdam, Geneva and Vienna as soon as practicable. -

Philharmonic Hall Lincoln Center for the Performing Arts 19 6 2-1963 ’ a New Constituent for the Center
PHILHARMONIC HALL LINCOLN CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 19 6 2-1963 ’ A NEW CONSTITUENT FOR THE CENTER With the structure of the New York State Theater be ginning to rise above the plaza level of Lincoln Center directly opposite Philharmonic Hall, plans are also begin ning to emerge for its use. The first of these to achieve definition has just been announced, and it calls for the creation of another constituent to join the five ^Philhar monic-Symphony Society, Metropolitan Opera, The Juil- liard School of Music, The Lincoln Repertory Company and the New York Public Library (which will operate the Library-Museum of the Performing Arts)—now in existence. Richard Rodgers and William Schuman Titled the New York Music Theater, the new entity will be formed as a non-profit membership corporation, and will contribute any net proceeds from its operation to Music Theater will have world importance. It will have Lincoln Center. It will be under the direction of Richard great meaning to New Yorkers. To our thousands of visi Rodgers, who will serve without financial compensation in tors, it will be a prime attraction. But the thing that interests the double capacity of president and producing director of me is that the New York Music Theater will be a showcase the Center’s newest constituent unit. The composer of some for an art, a kind of entertainment, keeping alive great and of America’s most beloved music, Mr. Rodgers will head cherished traditions, and hopefully, creating new ones. a unit which will be represented on the Lincoln Center Plays with music—and it may mean new kinds of plays and Council as well as by membership on the Center’s Board new kinds of music—take on new promise and opportunity of Directors. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Summer, 1965-1966
T" ^ffmm^i •"! FIRST WEEK July 2, 3, 4, 1966 BERKSHIRE FESTIVAL The Boston Symphony under Leinsdorf This recording of Prokof/'eff's Sixth Symphon y is a perfect example of the insight and drama with which the Boston Symphony Orchestra, under Leinsdorf, has invested the many Prokofieff masterpieces already recorded by them. Another striking example of their contemporary understanding is their powerful performance of Mahler's Sixth Symphon y, recorded for the first time in stereo, which takes its place among their cherished recordings of this master's First and Fifth Sympho- t£*"*i nies. Equally treasurable are their shimmering Firebird Mahler: S>mphon> So. 6 and glittering Le Cog d'Or. In D ynagroove sound. Boston Svmpbom Orchestra Erich Leinsdorf Bit Tjfhimy Orchestra/ Erich Lemdnrf Rimaky-Koraakoff/"LE GOQ D OR SUITE Stravinsky /"FIREBIRD" SUITE rca Victor® ^SJThe most trusted name m sound ~t BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA ERICH LEINSDORF, Music Director RICHARD Burgin, Associate Conductor Berkshire Festival, Season 1966 TWENTY-NINTH SEASON MUSIC SHED AT TANGLEWOOD, LENOX, MASSACHUSETTS FIRST WEEK Historical and descriptive notes by John N. Burk Assisted by DONALD T. GAMMONS Copyright, 1966 by Boston Symphony Orchestra, Inc. The Trustees of The BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA, Inc. President Vice-President Treasurer Henry B. Cabot Talcott M. Banks John L. Thorndike Philip K. Allen Francis W. Hatch Henry A. Laughlin Abram Berkowitz Andrew Heiskell Edward G. Murray Theodore P. Ferris Harold D. Hodgkinson John T. Noonan Robert H. Gardiner E. Morton Jennings, Jr. Mrs. James H. Perkins Sidney R. Rabb Raymond S. Wilkins Trustees Emeritus Palfrey Perkins Lewis Perry Edward A. -

Building a Library
BUILDING A LIBRARY All selections were made from recordings available in the UK at the time of the broadcast and are full price unless otherwise stated. CD Review cannot guarantee that they have not subsequently been deleted. KEY: CD = compact disc c/w = coupled with SIS = a recording which is only available through EMI’s Special Import Service IMS = a recording which is only available through Universal Classics' Import Music Service CONTENTS September 1999 – July 2000 .................................................................................................................................................................................. 3 September 2000 – July 2001 ................................................................................................................................................................................ 24 September 2001 – July 2002 ................................................................................................................................................................................ 46 September 2002 – July 2003 ................................................................................................................................................................................ 74 September 2003 – July 2004 ................................................................................................................................................................................ 98 September 2004 – July 2005 ............................................................................................................................................................................. -

Rachmaninov (1873-1943)
RUSSIAN, SOVIET & POST-SOVIET CONCERTOS A Discography of CDs and LPs Prepared by Michael Herman Sergei Rachmaninov (1873-1943) Born at Oneg, Novgorod Region. He had piano lessons from an early age but his serious training in composition began at the Moscow Conservatory where he studied counterpoint with Sergei Taneyev and harmony with Anton Arensky. He began to compose and for the rest of his life divided his musical time between composing, conducting and piano playing gaining great fame in all three. After leaving Russia permanently in 1917, the need to make a living made his role as a piano virtuoso predominant. His 4 Piano Concertos, Rhapsody on a Theme of Paganini and substantial solo piano works make him one of the world's most-performed composers. However, he also composed operas and liturgical choral works as well as other pieces for orchestra, chamber groups and voice. Piano Concerto No. 1 in F-sharp minor, Op. 1 (1892, rev. 1917) Leif Ove Andsnes (piano)/Antonio Pappano/Berlin Philharmonic Orchestra ( + Piano Concerto No. 2) EMI CLASSICS 74813-2 (2005) Agustin Anievas (piano)/Rafael Frühbeck de Burgos/New Philharmonia Orchestra ( + Piano Concertos Nos. 2, 3 and 4, Rhapsody on a Theme of Paganini, Prelude in C-sharp minor, 10 Preludes and 12 Preludes) EMI CLASSICS TRIPLE 5 00871-2 (2007) (original LP release: ANGEL SCB 3801 {3 LPs}) (1973) Vladimir Ashkenazy (piano)/Bernard Haitink/Royal Concertgebouw Orchestra (+ Rhapsody on a Theme of Paganini) DECCA 417613-2 (1987) Vladimir Ashkenazy (piano)/André Previn/London Symphony Orchestra ( + Piano Concertos Nos. 2, 3 and 4, Rhapsody on a Theme of Paganini, Variations on a Theme of Corelli and Piano Sonata No. -

The Young Conductor Looks to the Future
THE WORLD’S BEST CLASSICAL MUSIC REVIEWS Est 1923 . APRIL 2018 gramophone.co.uk Robin Ticciati The young conductor looks to the future PLUS Paul Lewis explores Haydn’s piano sonatas Handel’s Saul: the finest recordings UNITED KINGDOM £5.75 Intimate concerts featuring internationally acclaimed classical musicians in central London Now Booking Until July 2018 Igor Levit Cuarteto Casals: Beethoven Cycle Roderick Williams: Exploring Schubert’s Song Cycles O/Modernt: Purcell from the Ground Up Haydn String Quartet Series Jörg Widmann as Composer-Performer and much more… The Wigmore Hall Trust 36 Wigmore Street, London W1U 2BP Director: John Gilhooly OBE www.wigmore-hall.org.uk Registered Charity Number 1024838 A special eight-page section focusing on recent recordings from the US and Canada JS Bach Solo Violin Sonatas and Partitas, BWV1001-1006 talks to ... Johnny Gandelsman vn In a Circle F b ICR101 (124’ • DDD) Johnny Gandelsman The violinist and co-founder Bach’s Violin of Brooklyn Rider discusses his Sonatas and debut solo recording of Bach Partitas are among the most frequently Was it a challenge to plunge straight into performed works for the instrument, Bach for your first solo recording? or any instrument. Recordings evince a Not really. Over the the last three years spectrum of approaches, from historical I’ve performed all six Sonatas and Partitas treatments on period instruments to in concert about 30 times, which has been concepts Romantic and beyond. deeply rewarding. I wanted to capture this Among the newest journeys is Johnny moment of personal learning and growth. Gandelsman’s freshly considered account Do you miss the collaborative process of these monuments. -

An Examination of the Value of Score Alteration in Virtuosic Piano Repertoire
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 6-2020 The Mutability of the Score: An Examination of the Value of Score Alteration in Virtuosic Piano Repertoire Wayne Weng The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/3708 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] THE MUTABILITY OF THE SCORE: AN EXAMINATION OF THE VALUE OF SCORE ALTERATION IN VIRTUOSIC PIANO REPERTOIRE BY WAYNE WENG A dissertation suBmitted to the Graduate Faculty in Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts, The City University of New York 2020 © 2020 WAYNE WENG ALL RIGHTS RESERVED ii The Mutability of the Score: An Examination of the Value of Score Alteration in Virtuosic Piano Repertoire By Wayne Weng This manuscript has Been read and accepted for the Graduate Faculty in Music in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Musical Arts. Ursula Oppens ____________________ ____________________________ Date Chair of Examining Committee Norman Carey ____________________ ____________________________ Date Executive Officer Supervisory Committee: Scott Burnham Raymond Erickson John Musto THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT The Mutability of the Score: An Examination of the Value of Score Alteration in Virtuosic Piano Repertoire by Wayne Weng Advisor: Scott Burnham This dissertation is a defense of the value of score alteration in virtuosic piano repertoire.