Die Gemeindewappen Des Kantons Aargau [Schluss]
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kreisspieltag STV Staffelbach
Kreisspieltag STV Staffelbach 18. / 19. August 2007 auf dem Höchacker in Safenwil Kreisspieltag STV Staffelbach 2007 2 Kreisspieltag STV Staffelbach 2007 Kreisspieltag Jugend und Aktive 18. / 19. August 2007 auf dem Sportplatz Höchacker in Safenwil Willkommen Geschätzte Kinder, Turnerinnen, Turner, Gäste und Zuschauer Der STV Staffelbach möchte alle herzlich Willkommen heissen am Kreisspieltag des Zofinger Kreisturnverbandes. Da wir in Staffelbach nicht über die nötige Infrastruktur verfügen, dürfen wir Gastrecht in Safenwil geniessen. Welchen Stellenwert hat der Kreisspieltag? Geht es nur um den Wettkampf? Nein, am Kreisspieltag treffen sich die turnenden Vereine aus dem Zofinger Kreisturnverband. Neben dem Kräftemessen in den verschiedenen Disziplinen haben aber auch die Gemütlichkeit und das gemeinsame Erlebnis des Teamsports einen grossen Stellenwert. Am Abend haben alle etwas gewonnen, sei es auch nur die Freude an der sportlichen Betätigung unter freiem Himmel. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Sponsoren, Helfern, Gönnern, Funktionären und OK-Mitgliedern für Ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt der Gemeinde Safenwil, die uns den Sportplatz Höchacker für den Kreisspieltag zur Verfügung stellt. Ohne das grosszügige Entgegenkommen hätten wir vom STV Staffelbach diesen Kreisspieltag nicht durchführen können. Wir möchten es nicht unterlassen Euch viel Glück, Erfolg und vor allem viel Freude bei den Spielen und Wettkämpfen zu wünschen. Mit Turnergrüssen OK Kreisspieltag Turnverein STV Staffelbach 3 Kreisspieltag STV Staffelbach 2007 Kreisspieltag STV Staffelbach auf dem Höchacker in Safenwil 2007 Jugendspieltag Samstag 18. August Spieltagleitung Siegrist Patrik, Bütikofer Hans Speaker Morgenthaler Silvia Rechnungsbüro Röcker Christoph Aktivspieltag Sonntag 19. August Spieltagleitung Röcker Christoph Speaker Morgenthaler Silvia Indiaca / Schnurball Meyer Elisabeth Parkplätze sind signalisiert (Achtung auf Wiese) bzw. -

Wandergruppe Muri 2021 Beratungsstelle Bezirk Muri
Beratungsstellen der Pro Senectute Aargau Bezirk Aarau Bezirk Lenzburg Bachstrasse 111, 5000 Aarau Burghaldenstrasse 19, 5600 Lenzburg Telefon 062 837 50 40 Telefon 062 891 77 66 [email protected] [email protected] Bezirk Baden Bezirk Muri Bahnhofstrasse 40, 5400 Baden Luzernerstrasse 16, 5630 Muri Telefon 056 203 40 80 Telefon 056 664 35 77 [email protected] [email protected] Bezirk Bremgarten Bezirk Rheinfelden Alte Bahnhofstrasse 7, 5610 Wohlen Bahnhofstrasse 26, 4310 Rheinfelden Telefon 056 622 75 12 Telefon 061 831 22 70 [email protected] [email protected] Bezirk Brugg Bezirk Zofingen Neumarkt 1, 5200 Brugg Vordere Hauptgasse 21, 4800 Zofingen Telefon 056 441 06 54 Telefon 062 752 21 61 [email protected] [email protected] Bezirk Kulm Bezirk Zurzach Hauptstrasse 60, 5734 Reinach Baslerstrasse 2 A, 5330 Bad Zurzach Telefon 062 771 09 04 Telefon 056 249 13 30 [email protected] [email protected] Bezirk Laufenburg Widengasse 5, 5070 Frick Telefon 062 871 37 14 [email protected] Pro Senectute Aargau Geschäftsstelle Suhrenmattstrasse 29 5035 Unterentfelden Telefon 062 837 50 70 Fax 062 837 50 71 [email protected] www.ag.prosenectute.ch Postkonto 50-1012-0 Aargau IBAN CH97 0900 00000 5000 1012 0 ag.prosenectute.ch Pro Senectute Aargau Programm der Wandergruppe Muri 2021 Beratungsstelle Bezirk Muri Datum Route Marschzeit SG Treffpunkt Leitung Donnerstag, Gertrud Notter Sarmenstorf – Birrwil / Halbtagesanlass KW ca. 2 ¾ Std. * Bahnhof Muri 14.01.2021 Katharina Tomaschett Donnerstag, Ruedi Gautschi Schönenwerd – Suhr / Halbtagesanlass KW ca. 2 ½ Std. ** Bahnhof Muri 11.02.2021 Katharina Tomaschett Donnerstag, Gersau – Vitznau / Halbtagesanlass Katharina Tomaschett KW ca. -

Zofinger Tagblatt
ZOFINGER TAGBLATT 26 Feldschiessen in der Region MONTAG, 30. MAI 2016 Die Schiessplätze 279 Teilnehmer absolvierten ihr Programm im Schiessstand auf dem Spiegelberg in Aarburg. ALLE BILDER VOM FELDSCHIESSEN: RENÉ WULLSCHLEGER Erneut weniger Teilnehmer in der Region Aarburg/Kölliken/Rothrist/Safenwil/Schlossrued Alle Kranzauszeichnungen und Anerkennungskarten S E K T I O N S R E S U L T A T E (300 m) m u z z t r r n a h l e e a z p J m n s h e s n e n n r e z i e e e i t e n t n e l f r z h r i ä f t i r a c e e e S V T D l K K Treffsichere Behördenmitglieder in Safenwil (v. l.): Daniel Zünd, André Diefenbach, Peter Lüscher, Markus Gabriel und Peter Stadler. SG Hirschthal 19 +3 8 12 l i SV Muhen 31 -15 23 25 w n MSV Kölliken 57 -10 31 35 e f SV Schorüti Kölliken-Holziken 55 -11 35 40 a S SG Safenwil 77 +11 38 48 SV Schöftland 3 -13 0 0 t s SG Murgenthal-Balzenwil 56 +11 36 40 i r ASV Rothrist 76 +40 37 41 h t FSG Rothrist 98 -1 52 63 o R SV Aarburg 8 -6 7 8 g r SG Brittnau 13 -6 8 9 u SV Mättenwil-Brittnau 93 -25 39 47 b r SG Oftringen-Küngoldingen 61 14 35 39 a A SG Strengelbach 57 -5 27 33 SG Zofingen 47 -39 37 40 d e FSG Attelwil 28 +6 18 21 u r FSG Moosleerau 42 -2 25 28 s s FSG Reitnau 17 -16 6 12 o l SG Schlossrued 42 +17 14 18 h Rothrist: Der Dauerregen vermochte die gute Stimmung nicht zu trüben. -
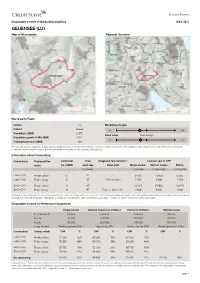
GEUENSEE (LU) Map of Municipality Regional Overview
Economic Research Disposable Income in Swiss Municipalities MAY 2011 GEUENSEE (LU) Map of Municipality Regional Overview Municipality Facts Canton LU Mandatory charges District Sursee low high Population (2009) 2'372 Fixed costs Swiss average Population growth (1999-2009) 2.0% low high Employed persons (2008) 456 The fixed costs comprise: living costs, ancillary expenses, charges for water, sewers and waste collection, cost of commuting to nearest center. The mandatory charges comprise: Income and wealth taxes, social security contributions, mandatory health insurance. Both are standardized figures taking the Swiss average as their zero point. Information about Commuting Commute to Transportation Commuter Time Integrated fare network / Cost per year in CHF mode no. (2000) each way travel pass Single person Married couple Family in minutes 1 commuter 2 commuters 1 commuter Luzern (LU) Private vehicle 51 21 - 6'403 15'830 6'656 Luzern (LU) Public transp. 51 34 TVLU 6 Zones 1'593 3'186 1'593 Zürich (ZH) Private vehicle 5 53 - 12'115 27'862 12'670 Zürich (ZH) Public transp. 5 87 Point-to-point ticket 2'808 5'600 2'808 Information on commuting relates to routes to the nearest relevant center. The starting point in each case is the center of the corresponding municipality. Travel costs associated with vehicles vary according to household type and are based on the following vehicle types: Single person = compact car, married couple = higher-price-bracket station wagon + compact car, family: medium-price-bracket station wagon. Disposable Income for Reference Households Single person Married couple (no children) Family (2 children) Retired couple In employment 1 person 2 persons 1 person Retired Income 75'000 250'000 150'000 80'000 Assets 50'000 600'000 300'000 300'000 Living situation Rented apartment 60m2 High-quality SFH Medium-quality SFH Rented apartment 100m2 Commute to Transp. -

Netzplan Region Zofingen
Netzplan Region Zofingen Olten Olten Olten Lenzburg Aarau HolzikenHirschthalerstr. Post Abzw Muhen Stadtgarten . Bändli Aarburg Mittelmuhen 1 Eggenscheide Obermuhen 525 2 511 520 Aarburg- Holziken Hirschthal BaslerstrasseObristhof Küngoldingen Oftringen Küngoldingen 521 Oberfeld Uerkheim 13 Bahnhof Oftringen Abzw Boningen Ruppoldingen Neuquartier che Unterdorf Kreuzplatz Schulhaus 518Uerkheim 126 Kir Tannacker . Neudorf Schweizer- Oftringen 1 Holzikerstr. Gilam Kir matten Perry-Center Küngoldingen g- Säge Post che Schöftland Boningen Kappelerstrasse 2 Nordweg Rothrist Alte 2 Sennhof-DörfliGemeindehausRössli Flecken Strasse Dorfstr. Rothrist Breitenpark Oftringen Wirtshüsli Bühnenber Gsteigli 3 reuzplatz Mühlethal Linden 13 Bahnhof K Sonnmatt 6 Lerchenfeld Schiltwald Hausenmühli Oftringen Uerkheim 616 Oftringen Milchhüsli Post 85 Ruhbank Schöftland Bahnhof 126 Grüebli Schwimmbad Döbeligut W 13 eiher Zofingen Pikar D 13 Uerkheim Uerkheim r Industrie - eistein Brunnhalde521 Kallernhag3 / CenterBrühl A1 Oberdorf 521 Ackerstrasse die Bleiche 3 Bethge Oensingen Weier e . Neue Industriestrasse Schürliweg Wässer Mühlethalstrasse mattenweg JHCO Gländ T Spitalgasse Wittwil Oberwil agblatt Unter Bottenwil Schöftland Rothrist Har Brühlstr Spital Käserei Hungerzelg Henzmannstr. Bottenwil d 3 Unterdorf Wittwil 4 Bifangstrasse Bottenwil 6 Sägetstrasse nplatz 512 6 6 4 3 1 13 e Hirschpark Dorf Staffelbach Garage Rickli Falkeisen- Gemeindehaus Grubenweg Zofingen Zofingen Heiter 85 Mühlewiese Heiter Bahnhof gli Sursee Str matte 5 8 9 1 11 Zofingen Stäpflistrasse Suhrenbrücke Hardmattenweg engelbach Oberer Ber 13 Friedhof Staffelbach Stadteingang 11 Bottenwil Bifang Römerbad Vorstatt 519 Fischerweg Altersheim Riedtalstr. Kath. Kirche Zofingen Vordemwald 518 6 engelbach Altachen 11 Post Str Schwimm- Haldenweg Moosmatt Gemeindehaus 519 Murgenthal Vordemwald 9 Post Iselishofdentsch bad Schulhaus Schleipfen 8 Murgenthal eier 1 engelbacheuzplatz 5 Hotel Murgenthal W r Adelboden Str K Eisengrube d Gemeindehaus Chratzernstrasse 4 Fahracker gherr . -

Ordonnance Sur La Protection En Cas D'urgence Au Voisinage Des
732.33 Ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU) du 20 octobre 2010 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 4, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)1, vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle la protection d’urgence en cas d’événement surve- nant dans une installation nucléaire suisse au cours duquel le rejet d’une quantité non négligeable de radioactivité ne peut être exclu. 2 Les installations nucléaires soumises à la présente ordonnance sont désignées dans l’annexe 1. Art. 2 But de la protection d’urgence La protection d’urgence vise à: a. protéger la population et son milieu de vie; b. assister temporairement la population touchée et lui assurer l’indispensable; c. limiter les effets d’un événement. RO 2010 5191 1 RS 732.1 2 RS 520.1 1 732.33 Energie nucléaire Section 2 Zones Art. 3 Principe 1 Le territoire au voisinage d’une installation nucléaire est réparti en deux zones: a. la zone 1 couvre l’aire proche de l’installation nucléaire où une défaillance grave peut causer un danger exigeant des mesures immédiates de protection de la population; b. la zone 2 est contiguë à la zone 1 et couvre l’aire où une défaillance grave de l’installation nucléaire peut causer un danger exigeant des mesures de pro- tection de la population. -
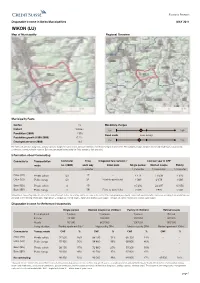
WIKON (LU) Map of Municipality Regional Overview
Economic Research Disposable Income in Swiss Municipalities MAY 2011 WIKON (LU) Map of Municipality Regional Overview Municipality Facts Canton LU Mandatory charges District Willisau low high Population (2009) 1'359 Fixed costs Swiss average Population growth (1999-2009) 0.1% low high Employed persons (2008) 753 The fixed costs comprise: living costs, ancillary expenses, charges for water, sewers and waste collection, cost of commuting to nearest center. The mandatory charges comprise: Income and wealth taxes, social security contributions, mandatory health insurance. Both are standardized figures taking the Swiss average as their zero point. Information about Commuting Commute to Transportation Commuter Time Integrated fare network / Cost per year in CHF mode no. (2000) each way travel pass Single person Married couple Family in minutes 1 commuter 2 commuters 1 commuter Olten (SO) Private vehicle 23 17 - 4'414 11'539 4'576 Olten (SO) Public transp. 23 24 Point-to-point ticket 1'089 2'178 1'089 Basel (BS) Private vehicle 4 49 - 10'492 24'437 10'956 Basel (BS) Public transp. 4 58 Point-to-point ticket 2'286 4'572 2'286 Information on commuting relates to routes to the nearest relevant center. The starting point in each case is the center of the corresponding municipality. Travel costs associated with vehicles vary according to household type and are based on the following vehicle types: Single person = compact car, married couple = higher-price-bracket station wagon + compact car, family: medium-price-bracket station wagon. Disposable Income for Reference Households Single person Married couple (no children) Family (2 children) Retired couple In employment 1 person 2 persons 1 person Retired Income 75'000 250'000 150'000 80'000 Assets 50'000 600'000 300'000 300'000 Living situation Rented apartment 60m2 High-quality SFH Medium-quality SFH Rented apartment 100m2 Commute to Transp. -

Freiam T S E E Ta L W Y N E T a L S U H Ren Tal W Ig G E Rta L Ru Ed Ertal
Buslinien Zofingen / Reiden Bahnlinien Buslinien Freiamt Buslinien Limmattal (Im Auftrag der VBZ) Unsere Zug- 1 Altachen – Zofingen – Aarburg-Oftringen S14 Aarau – Suhr – Menziken 340 Wohlen – Meisterschwanden 301 Oetwil an der Limmat 3 Industrie – Zofingen – Rothrist – Glashütten S14 Aarau – Entfelden – Schöftland 444 Bremgarten – Oberwil – Zürich Enge 302 Weiningen – Urdorf Weihermatt und Buslinien 4 Zofingen – Strengelbach – Brittnau-Wikon S17 Wohlen – Bremgarten – Dietikon 445 Remetschwil – Berikon-Widen – Zürich Enge 303 Killwangen – Spreitenbach - Schlieren (-Farbhof) 5 Zofingen – Brittnau 304 Geroldswil – Bahnhof Altstetten im Aargau 6 Zofingen – Strengelbach – Vordemwald / – Rothrist N31 Dietikon – Bergdietikon – Oberwil-Lieli 305 Bergdietikon/Kindhausen 8 Zofingen – Reiden – St. Urban N32 Dietikon – Bremgarten – Wohlen – Sarmenstorf 306 Stadthalle Ost und seinen 9 Zofingen – Reiden – Richenthal 308 Bahnhof Altstetten – Engstringen – Oberurdorf 11 Zofingen – Bergli Friedhof – Heiternplatz – Zofingen 309 Silbern Entdecken Sie mit uns angrenzenden 13 Zofingen – Bottenwil – Schöftland 311 Urdorf Weihermatt Gebieten: 314 Urdorf – Birmensdorf ZH N60 Olten – Aarburg – Zofingen – Vordemwald 325 Weinberg den Aargau Unsere Verantwortung gegenüber Natur und Land- schaft ist nicht nur auf das Verhalten unterwegs be- schränkt. Auch das Vorher und Nachher, die Planung, die An- und Heimreise oder die Abfallentsorgung sind J u r a k e t t darin eingeschlossen. e Staffelegg Legende Brugg Unsere Wanderungen sind so zusammen gestellt, dass Wanderroute Sie zur Hin- oder Rückfahrt auch bequem mit dem Zuglinie SBB L i m m a t öffentlichen Verkehrsmittel reisen können. Zuglinie Aargau Verkehr Biberstein Barmelweid Küttigen Der Natur und Umwelt zuliebe: Wandern Sie nach dem Saalhöhe Buslinie Aargau Verkehr Möriken Baden Motto «Nimm nichts mit als deine Eindrücke – hinter- Buslinie Limmat Bus Schloss lasse nichts als deine Fussspuren». -

Aargauer Turnverband / Fachgruppe Faustball Ranglisten Feldmeisterschaft 2011
Aargauer Turnverband / Fachgruppe Faustball Ranglisten Feldmeisterschaft 2011 Schlussrangliste 2. Liga Schlussrangliste Senioren 1 Kat. A * 1. FBV Zufikon 1 14 37 +153 1. STV MR Eien-Kleindöttingen 14 30 +72 2. STV Staffelbach 2 14 25 +19 2. STV Oberentfelden 5 14 29 +77 3. STV Spreitenbach 1 14 23 -14 3. STV MR Strengelbach 2 14 24 +11 4. STV Schöftland 1 14 20 +1 4. STV MR Schinznach-Dorf 2 14 22 +17 5. STV MR Villmergen 2 14 19 -13 5. STV MR Villmergen 3 14 22 -11 6. STV Vordemwald 3 14 18 -4 6. STV MR Auenstein 2 14 20 -12 - 7. STV Oberentfelden 3 14 13 -70 - 7. STV MR Suhr 14 15 -39 - 8. STV MR Auenstein 1 14 13 -72 - 8. STV MR Holderbank 14 6 -115 Schlussrangliste 3. Liga Schlussrangliste Senioren 1 Kat. B West + 1. STV Schlossrued 2 14 36 +180 * 1. STV MR Staffelbach 12 34 +168 + 2. STV Biberstein 14 35 +144 * 2. STV MTV Schafisheim 1 12 25 +67 3. FBV Zufikon 2 14 33 +90 * 3. STV MTV Aarburg 2 12 21 +32 4. STV Schöftland 2 14 25 +50 4. STV MTV Riniken 12 19 +31 5. TSV Würenlos 2 14 13 -71 5. STV MR Thalheim 12 16 -20 6. STV Spreitenbach 2 14 11 -118 6. STV MR Remigen 12 8 -105 7. STV Birr 14 9 -131 7. STV MR Hausen 12 3 -173 8. STV MR Rüfenach 1 14 6 -144 Schlussrangliste Senioren 1 Kat. B Ost * 1. TSV Obersiggenthal 2 14 33 +127 * 2. -

Ordonnance Sur La Protection En Cas D'urgence Au
Ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU) Modification du 20 novembre 2015 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, vu l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d’urgence (OPU)1, arrête: I L’annexe 3 de l’OPU est remplacée par la version ci-jointe. II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016. 20 novembre 2015 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: Hans Wanner 1 RS 732.33 2015-3032 4945 O sur la protection d’urgence RO 2015 Annexe 3 (art. 3, al. 2) Communes situées dans les zones 1 et 2, avec leurs secteurs de danger Désignation des centrales nucléaires: B/L – Beznau/Leibstadt G – Gösgen M – Mühleberg Commune District Zone 2 Secteurs de danger 1 2 3 4 5 6 Canton CN Zone 1 Aarau Aarau AG G X X X Aarberg Seeland BE M X X Aarburg Zofingen / Zofingue AG G X X Aegerten Biel/Bienne BE M X X Alterswil Sense FR M XX Altishofen Willisau LU G X X Ammerswil Lenzburg AG G X X Anwil Sissach BL G X X Arboldswil Waldenburg BL G X X Attelwil Zofingen / Zofingue AG G X X Auenstein Brugg AG B/L X X Auenstein Brugg AG G X X Avenches La Broye-Vully VD M X X Bachs Dielsdorf ZH B/L XX Bad Zurzach Zurzach AG B/L X X X Baden Baden AG B/L XX Baldingen Zurzach AG B/L XX X Barberêche See / du Lac FR M X X Bargen (BE) Seeland BE M X X X Belfaux (seul Cutterwil) La Sarine FR M X X Bellmund Biel/Bienne BE M X X Belp Bern-Mittelland BE M X X Bennwil Waldenburg BL G X X Bern/Berne Bern-Mittelland BE M X X Biberstein Aarau -

Polizeireglement Der Gemeinden Im Einzugsgebiet Der Regionalpolizei Zofingen
Polizeireglement der Gemeinden im Einzugsgebiet der Regionalpolizei Zofingen Attelwil Bottenwil Brittnau Holziken Kirchleerau Kölliken Moosleerau Muhen Murgenthal Oftringen Reitnau Rothrist Safenwil Schlossrued Schmiedrued Schöftland Staffelbach Strengelbach Uerkheim Vordemwald Wiliberg Zofingen - 2 - Inhaltsverzeichnis I. Allgemeine Bestimmungen § Seite 1 Geltungsbereich 5 2 Polizeiorgane 5 3 Anordnungen und Vorladungen 5 4 Störung der polizeilichen Tätigkeit 5 5 Identitätsnachweis 5 II. Besondere Bestimmungen A. Schutz der öffentlichen Sachen 6 Grundsatz 6 7 Reinigungspflicht / Littering 6 8 Überhängende Pflanzen 6 9 Lagerung von Waren 6 10 Parkieren auf öffentlichem Grund 6 B. Immissionsschutz 11 Grundsatz 7 12 Lärmschutz 7 13 Künstliche Lichtquellen 7 14 Immissionen aus der Landwirtschaft 7 C. Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 15 Unfug 8 16 Schiessen 8 17 Feuerwerk 8 18 Tierhaltung 8 D. Schutz der öffentlichen Sittlichkeit 19 Verrichten der Notdurft 8 20 Öffentliches Ärgernis 9 21 Jugendschutz 9 III. Bewilligungen, Strafen, Verfahren, Verwaltungszwang 22 Bewilligung 9 23 Busse 9 24 Fahrlässigkeit, Versuch 9 25 Bussendepositum 9 - 3 - § Seite 26 Strafbefehl 10 27 Bussenumwandlung 10 28 Ordnungsbussen 10 29 Juristische Personen und Handelsgesellschaften 10 30 Ersatzvornahme 10 IV. Schlussbestimmungen 31 Ausnahmen 10 32 Änderungen 10 33 Inkraftsetzung, Aufhebung bisherigen Rechts 10 - 4 - Die Gemeinderäte Attelwil, Bottenwil, Brittnau, Holziken, Kirchleerau, Kölliken, Moosleerau, Mu- hen, Murgenthal, Oftringen, Reitnau, Rothrist, -

SR-Jahresbericht 2014-FV
Jahresbericht 2014 2/22 Inhaltsverzeichnis 1.1.1. EinleitungEinleitungEinleitung ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 444 2.2.2. RückblickRückblickRückblick................................Rückblick.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 555 2.1 Jahresziele 2014 ..........................................................................................................5 2.2 Sicherheitspolizei .........................................................................................................5 2.3 Verkehrspolizei ............................................................................................................8 2.4 Verwaltungspolizei .....................................................................................................10 2.5 Sekretariat .................................................................................................................11 3.3.3. PersonellesPersonellesPersonelles ...............................................................................................................................................................................................................................................................................