Magisterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Weg Zum Anschluss. Burgenlandschicksal 1928 – 1938
INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Kulturlandesrat Helmut Bieler . 4 Einleitung . 5 Pia Bayer Burgenländische Landespolitik 1928–1933. 6 Pia Bayer, Dieter Szorger Das Burgenland im Ständestaat 1933–1938 ■ Die politische Entwicklung . 16 ■ Der 12. Februar 1934 . 23 ■ Die Organisationsstruktur der Vaterländischen Front . 31 ■ Die Arbeiterbewegung im Untergrund. 35 Der Beginn der politischen Verfolgung Der Aufbau der Untergrundorganisation der Revolutionären Sozialisten und Kommunisten Die Volksfront gegen Hitler ■ Die Entwicklung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) . 43 Pia Bayer, Dieter Szorger Die Machtergreifung der Nationalsozialisten ■ Die Anatomie der Machtergreifung . 54 ■ Der Beginn der Verfolgungsmaßnahmen. 66 Die erste Verhaftungswelle Das NS-Terrorsystem Die NSDAP Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) Die Sicherheitsdienst-Außenstelle (SD) Eisenstadt Die Kriminalpolizei (Kripo) Die Opfer der politischen Verfolgung Die Verfolgung der jüdischen Burgenländer Die Verfolgung der burgenländischen Roma ■ Die Volksabstimmung vom 10. April 1938 . 85 ■ Die Auflösung des Burgenlandes . 95 Dieter Szorger Biografien führender burgenländischer Nationalsozialisten . 97 Zeittafel 1928–1938. 104 Literaturverzeichnis. 110 Danksagung . 113 VORWORT Sehr geehrte Damen und Herren! er kennt sie nicht, jene Propa- genstaatlichkeit hinnehmen. Das Burgen- gandafilme aus den 30er Jah- land verlor seine Selbstständigkeit, wurde Wren des vorigen Jahrhunderts? aufgeteilt und verschwand von der Land- Zu sehen ist meist ein kleiner Diktator auf -

„Hinein in Die Vaterländische Front!“ Die Vaterländische Front Als Machtbasis Des Ständestaats?
„Hinein in die Vaterländische Front!“ Die Vaterländische Front als Machtbasis des Ständestaats? Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts im Masterstudium Politische Bildung Johannes Kepler Universität Linz Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Marcus Gräser Verfasser: Philipp Lumetsberger, BSc Linz, Februar 2015 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Masterarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch. Linz, Februar 2015 Philipp Lumetsberger 1 Inhalt I. Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................ 3 1. Einleitung ................................................................................................................ 4 2. Ständestaat ............................................................................................................ 6 2.1. Vorgeschichte .................................................................................................. 6 2.2. Verfassung ..................................................................................................... 16 2.3. Der Einfluss der Berufsstände ....................................................................... 26 3. Vaterländische Front............................................................................................ -

Engelbert Dollfuss and the Destruction of Austrian Democracy
RICE UNIVERSITY ENGELBERT DOLLFUSS AND THE DESTRUCTION OF AUSTRIAN DEMOCRACY by REINHART KONDERT A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS Thesis Director*s signature: (ylath 6\. ClfJ. A \y a Houston, Texas June, 1967 Abstract ENGELBERT DOLLFUSS AND THE DESTRUCTION OF AUSTRIAN DEMOCRACY Reinhart Kondert When Engelbert Dollfuss became chancellor of Austria on May 10, 1932, he had no intention of destroying Austrian demo- cracy• The idea of doing away with democracy never became an obsession with him; it was done more out of necessity than de¬ sire. Dollfuss* forced alignment with the Heimwehr, a right wing organization motivated by fascist principles, was the first clear indication that Austrian politics were henceforth to move in an anti-democratic direction.: The refusal of the Social Democrats to join his coalition in May, 1932, and their con¬ tinuing obstructionist tactics in parliament discredited not only themselves but also the institution in which they were represented. By March, 1933, the chancellor had become thoroughly disgusted with the parliament of his day, and he became convinced that Austria could not long endure under the present system of government. The self-dissolution of parliament on March 4, 1933, provided Dollfuss with the opportunity he had been waiting for. Although not certain about the future fate of parliament, he decided that, at least for the time being, he would govern without that defunct body. He decided to rule by governmental decree, instead, and to legalize his actions he revived an old imperial law of 1917, the War Emergency Powers Act. -
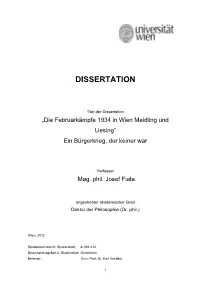
Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Die Februarkämpfe 1934 in Wien Meidling und Liesing“ Ein Bürgerkrieg, der keiner war Verfasser Mag. phil. Josef Fiala angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 312 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt Geschichte Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Karl Vocelka 1 Isabell Gerhard und Heidi gewidmet 2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 8 Einleitung 10 A. Fragestellung 12 B. Forschungsstand 13 C. Methoden 15 1. Die Entwicklungen in der 1. Republik 18 1.1. Ende und Anfang 18 1.1.1. Das Ende der Monarchie 18 1.1.2. Die Entstehung und Ausrufung der Republik 19 1.1.3. Der Friede von St. Germain-en-Laye 1919 20 1.2. Die Gründung der Parteien und der bewaffneten Schutzverbände 22 1.2.1. Die Heimwehren 22 1.2.2. Der Republikanischer Schutzbund 24 1.3. Die Toten von Schattendorf und ihre Folgen 26 1.3.1. Der Feuerüberfall 26 1.3.2. Das Fehlurteil 27 1.3.3. Der Justizpalastbrand 27 1.3.4. Der Schießbefehl durch Polizeipräsident Dr. Johann Schober nach Rücksprache mit Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel 29 1.4. Die Ausschaltung des Parlaments 30 1.4.1. Die Abstimmung bzgl. Eisenbahnerstreik 30 1.4.2. Der formelle Rücktritt aller drei Parlamentspräsidenten – kein offizielles Ende der Parlamentssitzung 31 1.4.3. Die Neueinberufung durch den 3. Präsidenten Dr. Sepp Straffner 32 1.4.4. Der Beginn des Austrofaschismus 33 1.4.5. Die neue Verfassung 34 1.5. Der autoritäre Ständestaat 35 1.5.1. Das Verbot des Republikanischen Schutzbundes 35 1.5.2. -

Az Osztrák Út
Németh István AZ OSZTRÁK ÚT Ausztria a 20. században Összegzés és dokumentumok Pandora Könyvek 26. kötet Németh István AZ OSZTRÁK ÚT Ausztria a 20. században Összegzés és dokumentumok Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Mózes Mihály A 2011-ben megjelent kötet: Ködöböcz Gábor: Erdélyi élmény – erdélyi gondolat (23. kötet) Lőrincz Julianna: Kommunikáció – stílus – variativitás és anyanyelvoktatás (24. kötet) Balásné Szalai Edit: A tárgyas szószerkezetek a magyar és a mordvin nyelvben (25. kötet) Németh István AZ OSZTRÁK ÚT Ausztria a 20. században Összegzés és dokumentumok Líceum Kiadó Eger, 2011 A DOKUMENTUMOKAT FORDÍTOTTA: Arany Ágnes Fiziker Róbert Hegedűs István Kocsis András Murber Ibolya Németh István Szávai Ferenc Tollas Gábor AZ IDŐRENDI ÁTTEKINTÉST F. Kárpát Kinga A MELLÉKLETET ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Arany Éva A borítón John William Waterhouse: Pandora (1896) című festményének részlete látható ISSN: 1787-9671 A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Főiskola rektora Megjelent az EKF Líceum Kiadó gondozásában Igazgató: Kis-Tóth Lajos Felelős szerkesztő: Zimányi Árpád Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné Borítóterv: Kormos Ágnes Megjelent: 2011. szeptember Készítette: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdája Felelős vezető: Kérészy László TARTALOMJEGYZÉK I. SZÜLETÉS A KÁOSZBÓL – AZ ELSŐ KÖZTÁRSASÁG (1918–1938) 1. A Német-ausztriai Köztársaság megalakulása (1918) ....................................................... 11 2. Otto Bauer és az anschluss .................................................................................................. 12 -

A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts And
AN ART OF THEIR OWN REINVENTING FRAUENKUNST IN THE FEMALE ACADEMIES AND ARTIST LEAGUES OF LATE-IMPERIAL AND FIRST REPUBLIC AUSTRIA, 1900-1930 A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences at Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History By Megan Marie Brandow-Faller, B.A./M.A. Washington, D.C. April 2010 Copyright 2010 by Megan Marie Brandow-Faller All Rights Reserved ii AN ART OF THEIR OWN REINVENTING FRAUENKUNST IN THE FEMALE ACADEMIES AND ARTIST LEAGUES OF LATE-IMPERIAL AND FIRST REPUBLIC AUSTRIA, 1900-1930 Megan Marie Brandow-Faller, M.A. Thesis Advisor: James P. Shedel, Ph.D. ABSTRACT Focusing on the institutionalization of women’s art education, this dissertation traces the development of the concept of Frauenkunst, (women’s art) originally connoting substandard, amateurish works intended as distraction rather than vocation, as well as certain lower genres (flower-painting, still-life, etc) associated with slavish reproduction rather than creative innovation, in Austrian artistic-educational systems circa 1900-1930. The originally-private, later state-subsidized Viennese Women’s Academy, which gained official institutional parity with Austria’s premier state academies of fine and applied arts, assumes particular significance for the question of a distinct “women’s art.” Originally founded by a private-league, the Women’s Academy gradually became integrated in late-Imperial Austria’s mainstream institutional framework: gaining rights of public incorporation in 1908, increased levels of state- funding and employment of key personnel, and the privilege of issuing degrees equal to the Austrian Academy of Fine Arts.