Amazon – Geschäftsmodell Eines Online-Giganten Über Die Relevanz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rose Gardner Mysteries
JABberwocky Literary Agency, Inc. Est. 1994 RIGHTS CATALOG 2019 JABberwocky Literary Agency, Inc. 49 W. 45th St., 12th Floor, New York, NY 10036-4603 Phone: +1-917-388-3010 Fax: +1-917-388-2998 Joshua Bilmes, President [email protected] Adriana Funke Karen Bourne International Rights Director Foreign Rights Assistant [email protected] [email protected] Follow us on Twitter: @awfulagent @jabberworld For the latest news, reviews, and updated rights information, visit us at: www.awfulagent.com The information in this catalog is accurate as of [DATE]. Clients, titles, and availability should be confirmed. Table of Contents Table of Contents Author/Section Genre Page # Author/Section Genre Page # Tim Akers ....................... Fantasy..........................................................................22 Ellery Queen ................... Mystery.........................................................................64 Robert Asprin ................. Fantasy..........................................................................68 Brandon Sanderson ........ New York Times Bestseller.......................................51-60 Marie Brennan ............... Fantasy..........................................................................8-9 Jon Sprunk ..................... Fantasy..........................................................................36 Peter V. Brett .................. Fantasy.....................................................................16-17 Michael J. Sullivan ......... Fantasy.....................................................................26-27 -

Consistency in Cloud-Based Database Systems
https://doi.org/10.31449/inf.v43i1.2650 Informatica 43 (2019) 313–319 313 Consistency in Cloud-based Database Systems Zohra Mahfoud USTHB University, Algeria E-mail: [email protected] Nadia Nouali-Taboudjemat CERIST Research Center, Algeria E-mail: [email protected] Keywords: cloud computing, consistency, distributed databases, relational databases, No-SQL, CAP Received: July 15, 2019 Cloud computing covers the large spectrum of services available on the internet. Cloud services use replication to ensure high availability. Within database replication, various copies of the same data item are stored in different sites, this situation requires managing the consistency of the multiple copies. In fact, the requirement for consistency level can be different according to application natures and other metrics; a delay of some minutes in visualizing latest posts in social networks can be tolerated, while some seconds can make a loss of a bid in an auction system. Wide variety of database management systems are used actually by cloud services, they support different levels of consistency to meet the diversity of needs. This paper draws a presentation of the main characteristics of cloud computing and data management systems and describes different consistency models. Then it discusses the most famous cloud-based database management systems from the point of view of their data and consistency models. Povzetek: Prispevek analizira podatkovna skladišča v oblakih predvsem s stališča konsistentnosti. 1 Introduction Cloud computing refers to the large spectrum of services cloud systems and describes the implemented models of available on the internet. These services manage big data and consistency. Section 6 concludes the paper. -
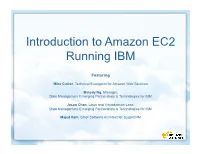
Introduction to Amazon EC2 Running IBM
Introduction to Amazon EC2 Running IBM Featuring Mike Culver, Technical Evangelist for Amazon Web Services Melody Ng, Manager, Data Management Emerging Partnerships & Technologies for IBM Jason Chan, Linux and Virtualization Lead, Data Management Emerging Partnerships & Technologies for IBM Majed Itani, Chief Software Architect for SugarCRM Webinar — Introduction to Amazon EC2 Running IBM Introducon IBM SugarCRM Q&A Q&A Amazon Has Three Parts 1 2 3 What You Want… Develop Test Operate What You Get… Undifferenated heavy liing • Hardware costs • Soware costs • Maintenance • Load balancing • Scaling Develop Test Operate • Ulizaon • Idle machines • Bandwidth management • Server hosng • Storage Management • High availability Continuous Process Improvement Makes it Worse Undifferenated heavy liing • Hardware costs • Soware costs • Maintenance • Load balancing • Scaling Develop Test Operate • Ulizaon • Idle machines • Bandwidth management • Server hosng • Storage Management • High availability The 70/30 Switch Differenated Value Undifferenated Heavy Liing Creaon Undifferenated Differenated Value Creaon Heavy Liing We Think of the Cloud as a Set of Building Block Services Infrastructure As a Service Payments As a Service Amazon Simple Storage Service Amazon Flexible Payments Amazon Elastic Compute Cloud Service Amazon Simple Queue Service Amazon DevPay Amazon SimpleDB Amazon CloudFront Fulfillment and Associates Amazon Elastic MapReduce Amazon Fulfillment Web Service Amazon Associates Web Service People As a Service Amazon Mechanical Turk What is Amazon -

Condiciones De Uso Del Sitio AWS
Condiciones de Uso del Sitio AWS Última actualización: 30 de agosto de 2017. Bienvenido al sitio de Amazon Web Services (el “Sitio AWS”). Amazon Web Services, Inc. y/o sus filiales (“AWS”) le ofrecen acceso al Sitio AWS con sujeción a las siguientes condiciones de uso (“Condiciones del Sitio”). Al visitar el Sitio AWS, acepta usted las Condiciones del Sitio. Le rogamos las lea detenidamente. Por otra parte, cuando utilice cualquier servicio, contenido u otros materiales de AWS, actuales o futuros, también estará usted sujeto al Contrato de Usuario AWS u otro acuerdo que rija el uso por su parte de nuestros servicios (el “Contrato”). PRIVACIDAD Le rogamos lea nuestra Política de Privacidad, que también regirá sus visitas al Sitio AWS, para familiarizarse con nuestras prácticas. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Cuando visita usted el Sitio AWS o nos envía correos electrónicos, se está comunicando usted con nosotros por vía electrónica. Usted consiente recibir comunicaciones enviadas por nosotros por vía electrónica. Nos comunicaremos con usted por correo electrónico o publicando avisos en el Sitio AWS. Acepta que todos los acuerdos, notificaciones, divulgaciones y otras comunicaciones que le facilitemos por vía electrónica satisfacen el requisito legal de que dichas comunicaciones se realicen por escrito. DERECHOS DE AUTOR Todo el contenido incluido en el Sitio AWS, como puede ser texto, gráficos, logotipos, iconos de botones, imágenes, clips de audio, descargas digitales, compilaciones de datos y software, es propiedad de AWS o de sus proveedores de contenido y está protegido por las leyes de derechos de autor internacionales y de los Estados Unidos de América. La compilación de la totalidad del contenido del Sitio AWS es propiedad exclusiva de AWS y está protegida por las leyes de derechos de autor internacionales y de los Estados Unidos de América. -

AWS SDK for .NET Developer Guide Version V2.0.0 AWS SDK for .NET Developer Guide
AWS SDK for .NET Developer Guide Version v2.0.0 AWS SDK for .NET Developer Guide AWS SDK for .NET: Developer Guide Copyright © 2014 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. The following are trademarks of Amazon Web Services, Inc.: Amazon, Amazon Web Services Design, AWS, Amazon CloudFront, Cloudfront, CloudTrail, Amazon DevPay, DynamoDB, ElastiCache, Amazon EC2, Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Glacier, Kinesis, Kindle, Kindle Fire, AWS Marketplace Design, Mechanical Turk, Amazon Redshift, Amazon Route 53, Amazon S3, Amazon VPC. In addition, Amazon.com graphics, logos, page headers, button icons, scripts, and service names are trademarks, or trade dress of Amazon in the U.S. and/or other countries. Amazon©s trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Amazon©s, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Amazon. All other trademarks not owned by Amazon are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Amazon. AWS SDK for .NET Developer Guide Table of Contents AWS SDK for .NET Developer Guide ................................................................................................ 1 How to Use This Guide ........................................................................................................... 1 Supported Services and Revision History ................................................................................. -

Data with Simpledb
DATA WITH SIMPLEDB Amazon’s SimpleDB is a distributed document-oriented database. SimpleDB shares many characteristics of relational databases, but it also has some significant dissimilarities. For instance, like a relational database, SimpleDB is designed for storing tuples of related information. Unlike a relational database, SimpleDB does not provide data ordering services—that is left to the programmer. Instead of tables, SimpleDB offers domains, which are schema-less. A domain is filled with items— similar to a row. Each item must have a unique name (which is not generated by SimpleDB) and may contain up to 256 attributes. Each attribute can have multiple values. The following table is an example domain for a Person. Note that the “Phones” attribute contains more than one value for Bob and Joe. Item Name Age Phones Bob 21 (555)555-1212 (555)555-7777 Alice 22 (555)555-1213 Joe 32 (555)555-1432 (555)555-5432 TABLE 1 - TABULAR REPRESENTATION OF A SAMPLE DOMAIN. All item names and attribute values in SimpleDB are strings. All comparisons during queries are string-based comparisons. This means that non-string data types (such as numbers), need to be converted into a single, consistent lexigraphic representation for storage (zero padding for numbers.) Queries are performed in a custom query language. Queries are formed from predicates. A predicate is a simple comparison expression, surrounded by square brackets. For instance: [‘Age’ = ‘22’]. A query with that predicate will return Alice from TABLE 1. Predicates can be combined with the union, intersection, or not keyword. For instance: [‘Age’ = ‘22’] union [‘Age’ = ‘32’] will return Bob and Joe from TABLE 1. -

Netflix's Transition to a Key V3
Netflix’s Transition to High-Availability Storage Systems Siddharth “Sid” Anand October 2010 1. Abstract The CAP Theorem states that it is possible to optimize for any 2 of Consistency, Availability, and Network Partition Tolerance, but not all three. Though presented by Eric Brewer in 2000 and proved in 2002, the CAP Theorem has only recently gained significant awareness and that primarily among engineers working on high-traffic applications. With spreading awareness of the CAP theorem, there has been a proliferation of development on AP (a.k.a. Available-Network Partition Tolerant) systems – systems that offer weaker consistency guarantees for higher availability and network partition tolerance. Much of the interest in these AP systems is in the social networking and web entertainment space where eventual consistency issues are relatively easy to mask. Netflix is one company that is embracing AP systems. This paper addresses Netflix’s transition to AWS SimpleDB and S3, examples of AP storage systems. 2. Motivation Circa late 2008, Netflix had a single data center. This single data center raised a few concerns. As a single- point-of-failure (a.k.a. SPOF), it represented a liability – data center outages meant interruptions to service and negative customer impact. Additionally, with growth in both streaming adoption and subscription levels, Netflix would soon outgrow this data center -- we foresaw an imminent need for more power, better cooling, more space, and more hardware. One option was to build more data centers. Aside from high upfront costs, this endeavor would likely tie up key engineering resources in data center scale out activities, making them unavailable for new product initiatives. -
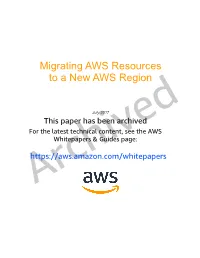
Migrating AWS Resources to a New Region
Migrating AWS Resources to a New AWS Region July 2017 This paper has been archived For the latest technical content, see the AWS Whitepapers & Guides page: https://aws.amazon.com/whitepapers Archived Notices Customers are responsible for making their own independent assessment of the information in this document. This document: (a) is for informational purposes only, (b) represents current AWS product offerings and practices, which are subject to change without notice, and (c) does not create any commitments or assurances from AWS and its affiliates, suppliers or licensors. AWS products or services are provided “as is” without warranties, representations, or conditions of any kind, whether express or implied. The responsibilities and liabilities of AWS to its customers are controlled by AWS agreements, and this document is not part of, nor does it modify, any agreement between AWS and its customers. © 2020 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Archived Contents Abstract .................................................................................................................. 5 Introduction ............................................................................................................ 1 Scope of AWS Resources .................................................................................. 1 AWS IAM and Security Considerations ............................................................. 1 Migrating Compute Resources ............................................................................. -
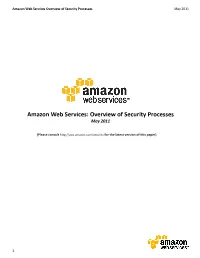
Amazon Web Services: Overview of Security Processes May 2011
Amazon Web Services Overview of Security Processes May 2011 Amazon Web Services: Overview of Security Processes May 2011 (Please consult http://aws.amazon.com/security for the latest version of this paper) 1 Amazon Web Services Overview of Security Processes May 2011 Amazon Web Services (AWS) delivers a scalable cloud computing platform with high availability and dependability, offering the flexibility to enable customers to build a wide range of applications. Helping to protect the confidentiality, integrity, and availability of our customers’ systems and data is of the utmost importance to AWS, as is maintaining customer trust and confidence. This document is intended to answer questions such as, “How does AWS help me protect my data?” Specifically, AWS physical and operational security processes are described for network and server infrastructure under AWS’ management, as well as service-specific security implementations. This document provides an overview of security as it pertains to the following areas relevant to AWS: Shared Responsibility Environment Control Environment Summary Secure Design Principles Backup Monitoring Information and Communication Employee Lifecycle Physical Security Environmental Safeguards Configuration Management Business Continuity Management Backups Fault Separation Amazon Account Security Features Network Security AWS Service Specific Security Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Security Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Security Amazon SimpleDB Security Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Security Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) Security Amazon Simple Notification Service (SNS) Security Amazon CloudWatch Security Auto Scaling Security Amazon CloudFront Security Amazon Elastic MapReduce Security 2 Amazon Web Services Overview of Security Processes May 2011 Shared Responsibility Environment Moving IT infrastructure to AWS creates a shared responsibility model between the customer and AWS. -

Frankfurt 2014 Rights Guide
Frankfurt 2014 Rights Guide www.apub.com For Foreign Rights Inquiries, please contact: Jennifer Bassuk Alexandra Levenberg Director, Global Rights Associate, Global Rights Amazon Publishing 1350 Avenue of the Americas, 17th Floor New York, New York 10019 [email protected] Rights Guide Table of Contents Amazon Breakthrough Novel Awards . 3 47North . 7 AmazonEncore . 34 Amazon Publishing . 39 German Language Titles—Amazon Publishing . 56 Grand Harbor Press . 66 Jet City Comics . 71 Lake Union Publishing . 75 Little A . 101 Montlake Romance . 114 StoryFront . 146 Thomas & Mercer . 151 Waterfall . 190 For Media Inquiries, please contact: [email protected] 2 Amazon Breakthrough Novel Award Winners 3 Amazon Breakthrough Novel Award Winners 2014 Grand Prize Winner — Mystery & Thriller 2014 Winner — Romance 3/31/2015 2/17/2015 The Dead Key The Bluestocking and D. M. Pulley the Rake Norma Darcy Rights Available: All Languages Rights Available: All Languages Rights Sold: Audio Rights Sold: Audio It’s 1998, and for years the old First Bank of Cleveland has The Earl of Marcham has decided to put the excesses of his sat abandoned, perfectly preserved, its secrets only colorful youth—or the most egregious of them, at least— speculated on by the outside world. firmly behind him in order to procure an heir. Twenty years before, amid strange staff disappearances and As he begins his search for an appropriate wife, a straight-laced allegations of fraud, panicked investors sold Cleveland’s largest bank spinster releases a morality pamphlet exposing some of the earl’s in the middle of the night, locking out customers and employees, and most scandalous misdemeanors. -
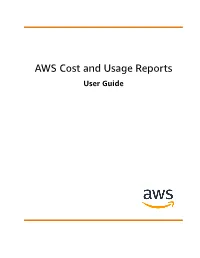
AWS Cost and Usage Reports User Guide AWS Cost and Usage Reports User Guide
AWS Cost and Usage Reports User Guide AWS Cost and Usage Reports User Guide AWS Cost and Usage Reports: User Guide Copyright © Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Amazon's trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Amazon's, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Amazon. All other trademarks not owned by Amazon are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Amazon. AWS Cost and Usage Reports User Guide Table of Contents What are AWS Cost and Usage Reports? ............................................................................................... 1 How it works ............................................................................................................................. 1 Using the data dictionary ............................................................................................................ 1 Download AWS CUR ................................................................................................................... 2 AWS Organizations users ............................................................................................................ 2 Creating reports ................................................................................................................................. 3 Setting up an Amazon S3 bucket for Cost and Usage Reports ......................................................... -

Frankfurt 2015 Rights Guide
Frankfurt 2015 Rights Guide www.apub.com For Global Rights inquiries, please contact: Jennifer Bassuk—Director, Global Rights Jodi Marchowsky—Manager, Global Rights Alexandra Levenberg—Manager, Global Rights Amazon Publishing 1350 Avenue of the Americas, 17th Floor New York, New York 10019 [email protected] Rights Guide Table of Contents 47North . 3 Amazon Publishing . 22 French and German Titles — Amazon Publishing . 29 Grand Harbor Press . 41 Jet City Comics . 45 Lake Union Publishing . 51 Little A . .82 Montlake Romance . 92 StoryFront . 123 Thomas & Mercer . 129 Waterfall . 165 For information about our backlist titles, please refer to our backlist rights guide, which is available on our website at www.apub.com. For Media Inquiries, please contact: [email protected] 2 This Way to the New Unknown 47North, whose name is based on the latitude coordinates for Seattle, offers a wide array of new novels and cult favorites for avid readers of science fiction, fantasy, and horror. 3 Seed Ania Ahlborn Horror Publication Date: 7/17/2012 Page Count: 246 Rights Available: All Languages Rights Sold: German Seed plants its page-turning terror deep in your soul, and lets it grow wild. With nothing but the clothes on his back—and something horrific snapping at his heels—Jack Winter fled his rural Georgia home when he was still just a boy. Watching the world he knew vanish in a trucker’s rearview mirror, he thought he was leaving an unspeakable nightmare behind forever. But years later, the bright new future he’s built suddenly turns pitch black, as something fiendishly familiar looms dead ahead.