Beschrieb 530
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
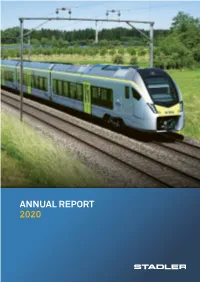
ANNUAL REPORT 2020 2020 RESULTS at a GLANCE 16.1 ORDER BACKLOG in CHF BILLION NET REVENUE Previous Year: 15.0 in Thousands of CHF
ANNUAL REPORT 2020 2020 RESULTS AT A GLANCE 16.1 ORDER BACKLOG IN CHF BILLION NET REVENUE Previous year: 15.0 in thousands of CHF 3,500,000 2,800,000 2,100,000 3,200,785 3,084,948 34,912 REGISTERED SHAREHOLDERS AS AT 31.12.2020 1,400,000 Previous year: 30 419 2,000,806 700,000 0 2018 2019 2020 NET REVENUE BY GEOGRAPHICAL MARKET in thousands of CHF Germany, Austria, Switzerland: 1,502,759 4.33 Western Europe: 963,548 ORDER INTAKE Eastern Europe: 457,488 IN CHF BILLION CIS: 68,207 Previous year: 5.12 America: 83,909 Rest of the world 9,037 % 12,303 5.1 EBIT MARGIN EMPLOYEES WORLDWIDE Previous year: 6.1% (average FTE 1.1. – 31.12.2020) Previous year: 10 918 156.1 EBIT IN CHF MILLION Previous year: 193.7 STADLER – THE SYSTEM PROVIDER OF SOLUTIONS IN RAIL VEHICLE CONSTRUCTION WITH HEADQUARTERS IN BUSSNANG, SWITZERLAND. Stadler Annual Report 2020 3 SUSTAINABLE MOBILITY – 16.1 ORDER BACKLOG TRAIN AFTER TRAIN IN CHF BILLION Previous year: 15.0 Stadler has been building rail vehicles for over 75 years. The company operates in two reporting segments: the “Rolling Stock” segment focuses on the development, design and production of high-speed, intercity and re gional trains, locomotives, metros, light rail vehicles and passenger coaches. With innovative signalling solutions Stadler supports the interplay be tween vehicles and infrastructure. Our software engineers in Wallisellen develop Stadler’s own solutions in the areas of ETCS, CBTC and ATO. The “Service & Components” segment offers customers a variety of services, ranging from the supply of individual spare parts, vehicle repairs, mod erni- sation and overhauls to complete full-service packages. -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -
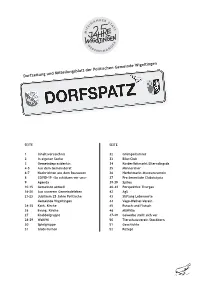
WEB Dorfspatz 2 20 IH.Pdf
Dorfzeitung und Mitteilungsblatt der Politischen Gemeinde Wigoltingen SEITE SEITE 1 Inhaltsverzeichnis 32 Grümpelturnier 2 In eigener Sache 33 Bike-Club 3 Gemeindepräsidentin 34 Kinderflohmarkt Elterndingsda 4–5 Aus dem Gemeinderat 35 Männerchor 6–7 Nachrichten aus dem Bauwesen 36 Herbstmarkt Museumsverein 8 COVID-19 «So schützen wir uns» 37 Pro Senectute Clubsixtysix 9 Agenda 38–39 Spitex 10–15 Gemeinde aktuell 40–41 Perspektive Thurgau 16–20 Aus unserem Gemeindeleben 42 AgS 21–23 Jubiläum 25 Jahre Politische 43 Stiftung Lebensorte Gemeinde Wigoltingen 44 Vago-Weiher-Verein 24–25 Kath. Kirche 45 Rutsch und Flutsch 26 Evang. Kirche 46 MüWiGa 27 Krabbelgruppe 47–49 Gewerbe stellt sich vor 28–29 WaKiWi 50 Tierschutzverein Steckborn 30 Spielgruppe 51 Geschichte 31 Globi-Turnen 52 Rezept Was darf veröffentlicht werden? Redaktionsschluss Erscheinungsdatum Beiträge im «Dorfspatz» sind kostenlos. Die Dorfzeitung steht Ausgabe Herbst Erscheinungsdatum grundsätzlich der gesamten Be- 28. August 2020 KW 40 völkerung und allen Körperschaf- ten, Vereinen oder Gruppierungen Ausgabe Winter Erscheinungsdatum der PG Wigoltingen für Beiträge, 13. November 2020 KW 51 Mitteilungen, Leserbriefe etc. zur Verfügung. Der Höchstumfang pro Beitrag beträgt 2 Seiten. Kommer- zielle Werbung ist nicht gestattet und wird abgewiesen. Der Verfas- Impressum ser muss der Redaktion bekannt sein. Verantwortlich für den Inhalt Redaktionsmitglieder Produktion ist der Verfasser. Für die Recht- Alexandra Bischof medienwerkstatt ag schreibung und Grammatik ist Kirchstrasse 29, 8556 Wigoltingen steinackerstrasse 8 ebenfalls der Verfasser zuständig. 052 721 82 45 8583 sulgen Die Redaktion beschränkt ihre Kor- 071 644 91 91 rekturen auf offensichtliche Fehler Ursina Gallmann und verzichtet auf inhaltliche Kor- Oberdorfstr. 15, 8556 Wigoltingen Sie können Beiträge, die Sie rekturen, sofern die Beiträge nicht 058 346 81 08 im Dorfspatz veröffentlichen die Regeln des Anstandes und der möchten, per e-mail an folgende Fairness verletzen. -

Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003
Research Collection Working Paper Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Author(s): Löchl, Michael Publication Date: 2005 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000066687 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Michael Löchl Travel Survey Metadata Series 16 Travel Survey Metadata Series 16 Stability of Travel Behaviour: Thurgau 2003 Michael Löchl IVT ETH Zürich Zürich Phone: +41 44 633 62 58 Fax: +41 44 633 10 57 [email protected] Abstract Within the project, a six week travel survey has been conducted among 230 persons from 99 households in Frauenfeld and the surrounding areas in Canton Thurgau from August until December 2003. The design built on the questionnaire used in the German project Mobidrive, but developed the set of questions further. All trip destinations of the survey have been geocoded. Moreover, route alternatives for private motorised transport and public transport have been calculated. Moreover, the collected data has been compared with the National Travel Survey 2000 (Mikrozensus zum Verkehrsverhalten 2000), whereas differences in terms of sociodemographic characteristics of the respondents and particularly their travel behaviour couldn't be observed except for an higher proportion of GA and Halbtax ownership. For example, the average trip frequency per person and day is almost the same. In order to check for possible fatigue effects of the amount of reported trips, several GLM (Generalised Linear Model) and poisson regression models have been estimated besides descriptive analysis. -

Sich Wohlfühlen
Februar 2020 Sich wohlfühlen leben arbeiten geniessen www.bussnang.ch informiert Mitteilungsblatt Liebe Einwohnerinnen und Einwohner Der erste Monat im neuen Jahr ist schon vorbei und was das neue Jahr alles bringen wird ist offen, wir hoffen und wünschen Ihnen viel Schönes und Erfreuliches. Damit die Einwohnerinnen und Einwohner mehr über die Gemeinde und die Besonderheiten erfahren, hat der Gemeinderat beschlossen, alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner, sowie Neuzuzüger, zu einem Kennenlernapéro einzuladen. Vielerorts gibt es zu Jahresbeginn solche Anlässe. Wir schätzen es, dass in unserer Gemeinde diese beliebten Neujahrsapéros in den jeweiligen Dörfern, durch die Dorfvereine, organsiert werden. Deshalb haben wir uns für einen Anlass im Frühjahr entschieden. Gerne zeigen wir Ihnen im und auf dem Platz vor dem Gemeindehaus was unsere flächenmässig grösste Gemeinde im Bezirk alles zu bieten hat und was besonders ist. Wir können Ihnen vielleicht, nebst der Geschichte, Land und Leute, auch einiges aufzeigen, was Sie eventuell noch nicht wissen? Wie es der Namen schon sagt, steht das Kennenlernen im Vordergrund und um dem gerecht zu werden stossen wir gerne mit Ihnen an. Der Kennenlernapéro findet statt am Samstag, 16. Mai 2020, um 10.00 Uhr, im und auf dem Platz vor dem Gemeindehaus in Bussnang. Reservieren Sie bitte schon jetzt den Termin. Die Einladung werden wir Ihnen zu gegebener Zeit zustellen. Zusammen mit dem Gemeinderat freue ich mich, wenn wir Sie am Kennenlernapéro begrüssen dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine -

Orts- Und Politische Gemeinden Kanton Thurgau
Amt für Geoinformation Orts- und Politische Willisdorf Diessenhofen Diessenhofen D Mannenbach ie Unterschlatt ss en h Gemeinden o f en Gottlieben Rheinklingen Berlingen Salenstein M Triboltingen Kanton Thurgau e Schlatt Schlattingen tt -O Wagenhausen Steckborn Salenstein b Basadingen Ermatingen e r Wagenhausen Fruthwilen s c Basadingen-Schlattingen Tägerwilen h la Kaltenbach Ermatingen Legende tt Salen- Reutenen B o Kreuzlingen t t Gemeinden Gündelhart- Raperswilen i Mammern g h Hörhausen o f n Eschenz Waeldi e e La Ortsgemeinden n D g nd O i n s Homburg Wäldi p i c f h l t p z i e r la i r s e c s h w h t h h Münsterlingen Lanzenneunforn s Sonterswil Neuwilen a c r a u Oberhofen u s S e s e Homburg n e n p n bei Kreuzlingen - - Nussbaumen p e n i n l e n e i n e Illhart L Kemmental s ö rt Engwilen u ch a w g Herdern a S m u Altnau Dettighofen h s a ig r b Hüttwilen Lippoldswilen ll Siegershausen Lengwil E e t Uerschhausen l Zuben Huettwilen Engwang D A Illighausen Oberneunforn n Güttingen o e H s Müllheim u t u n a Herrenhof Herdern Pfyn Wigoltingen g a h e is Neunforn Wilen Buch Pfyn ls c lt A Graltshausen Langrickenbach bei Neunforn h h h o c Wigoltingen t a Märstetten f b bei Frauenfeld e n n Kesswil n Klarsreuti e e k ic Niederneunforn k r Warth-Weiningen Ottoberg g n n a Uesslingen-Buch Weiningen i Birwinken L w Maerstetten n n r M le Berg e i i s D B l ü Hüttlingen u i n Uttwil e Bonau w ner Felben s a w sha Dozwil Uesslingen t Eschikofen r h t us t Warth e d t Happerswil- e e n a n Felben- Hüttlingen W A M Buch d Weinfelden Berg -

Rankings Municipality of Bussnang
9/24/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links SVIZZERA / Thurgau / Province of Bezirk Weinfelden / Bussnang Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH SVIZZERA Municipalities Affeltrangen Stroll up beside >> Amlikon-Bissegg Bussnang Berg (TG) Erlen Birwinken Hauptwil- Gottshaus Bischofszell Hohentannen Bürglen (TG) Kradolf- Schönenberg Märstetten Schönholzerswilen Sulgen Weinfelden Wigoltingen Wuppenau Zihlschlacht- Sitterdorf Provinces Powered by Page 2 BEZIRK ARBON BEZIRK L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin KREUZLINGEN AdminstatBEZIRK logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRAUENFELD SVIZZERABEZIRK MÜNCHWILEN BEZIRK WEINFELDEN Regions Aargau Graubünden / Grigioni / Appenzell Grischun Ausserrhoden Jura Appenzell Innerrhoden Luzern BaselLandschaft Neuchâtel BaselStadt Nidwalden Bern / Berne Obwalden Fribourg / Schaffhausen Freiburg Schwyz Genève Solothurn Glarus St. Gallen Thurgau Ticino Uri Valais / Wallis Vaud Zug Zürich Municipality of Bussnang Territorial extension of Municipality of BUSSNANG and related population density, population per gender and number of households, average age and incidence of foreigners Powered by Page 3 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin TERRITORY DEMOGRAPHIC DATA Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY(YEAR RANKINGS2018) SEARCH SVIZZERARegion Thurgau Bezirk Province Inhabitants -

Armbrustschützen Kommen 2022 Nach Neuwilen Empfang Der Neuzuzüger
Nr. 2 Freitag, 31. Januar 2020 Erscheinungsweise: Freitag, 14-täglich Redaktionsschluss: Amtliches Publikationsorgan der Politischen Gemeinde Kemmental Montag, 12 Uhr Gemeinde Kemmental, Alterswilerstrasse 2, 8573 Siegershausen Redaktion:Kreuzlinger Zeitung, Bahnhofstr. 33b, 8280 Kreuzlingen Tel. 058 346 08 00, E-Mail: [email protected] Tel. 071 678 80 34, E-Mail: [email protected] Armbrustschützen kommen 2022 nach Neuwilen Vom7.bis 17. Juli 2022 führt der Schützenkönig und Thurgauer Armbrustschützenver- Schweizermeister band das EidgenössischeArmbrust- Fürdiesen Grossandrangvon Arm- schützenfest durch. Dieses wirdauf brustschützenwährend diesen elf Ta- der Schiessanlage«Bäärenmos» bei genmussder jetzige Schiessstandim Neuwilen stattfinden. «Bäärenmos»von 16 auf40Scheiben Nach 26 Jahren kommtdas Eidge- erweitert werden. Zudembrauchtes nössische Armbrustschützenfestim eine umfassende Infrastrukturrund um Sommer 2022 wieder in den Thurgau. den Schiessstand. Gekochtwirdfür die Die beidenCo-OK-Präsidenten Andre- Teilnehmerund Helfer vorOrt und Un- as Häberli und Roland Ravelli infor- terkunftsmöglichkeitenbestehen in der mierten die Medien im Schiessstand Region oderauf dem festeigenen Zelt- «Bäärenmos» über die bisherigen Vor- platz im «Bäärenmos». DenHöhepunkt bereitungen. «Eshandelt sich um einen bildet der FestaktamSonntagmorgen sportlichen Grossanlassmit nationaler vom10. Juli mit der Fahnenübergabe und internationaler Beteiligung,vielen desOKRinggenbergandas OK Thur- Besuchern sowieeinem Festakt mit Die -

KANTON THURGAU Jahr 2020
KANTON THURGAU Jahr 2020 Total CHF 12'432'883 Begünstigte Unterstütztes Projekt Kultur CHF6'902'439 Eisenwerk, Genossenschaft, Frauenfeld Leistungsvereinbarung 2019-22 Theater Bilitz, Weinfelden Leistungsvereinbarung 2019-22 Verein Phönix-Theater, Steckborn Leistungsvereinbarung 2019-22 See-Burgtheater, Verein, Kreuzlingen Leistungsvereinbarung 2019-22 Löwenarena, Sommeri Leistungsvereinbarung 2019-22 Kulturpool ThurKultur Leistungsvereinbarung 2019-22 Kulturpool Region Diessenhofen, Diessenhofen Leistungsvereinbarung 2019-22 Kulturpool Regio Frauenfeld, Frauenfeld Leistungsvereinbarung 2019-22 Kulturpool Mittelthurgau, Weinfelden Leistungsvereinbarung 2019-22 Kulturpool Oberthurgau, Amriswil Leistungsvereinbarung 2019-22 Kulturpool UnterseeRhein, Mammern Leistungsvereinbarung 2019-22 Verein Kultursee, Kreuzlingen Leistungsvereinbarung 2019-22 Kulthurpool Aach Sitter Thur, Bischofszell Leistungsvereinbarung 2019-22 Kulturstiftung des Kantons Thurgau, Frauenfeld Leistungsvereinbarung 2019-22 Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen Leistungsvereinbarung 2019-22 Kunsthalle Arbon, Arbon Leistungsvereinbarung 2019-22 Stadtorchester Frauenfeld Leistungsvereinbarung 2019-22 TanzPlan Ost, St. Gallen Leistungsvereinbarung 2017-20 Kultur im Kloster Fischingen Leistungsvereinbarung 2019-22 Thurgauische Kunstgesellschaft, Kunstraum Leistungsvereinbarung 2019-22 Kreuzlingen Vokalenensemble Cantemus Weinfelden Leistungsvereinbarung 2019-22 Verein Zauberlaterne, Weinfelden/Romanshorn Leistungsvereinbarung 2019-22 Sinfonisches Orchester Arbon Leistungsvereinbarung -

Sperrung Kantonstrasse Bissegg Bis Bussnang
Kantonales Tiefbauamt Kantonales Tiefbauamt, 8510 Frauenfeld An alle Haushaltungen von Amlikon, Bissegg, Bussnang, Hünikon und Unteroppikon +41 58 345 7948, [email protected] Frauenfeld, 18. April 2018 SPERRUNG KANTONSTRASSE BISSEGG BIS BUSSNANG BEREICH: GESAMTE KANTONSSTRASSE B ISSEGG BIS BUSSNANG (DORFEINGANG) INFOLGE BRÜCKENUNTERHALT UND BELAGSSANIERUNG ab Dienstag, 22. Mai 2018 (ab 7.00Uhr) bis ca. Ende Juli 2018. Sehr geehrte Damen und Herren Die Kantonsstrasse K27 (Bissegg – Bussnang) wird zwischen Bissegg und dem Dorfeingang von Bussnang gesamterneuert. In Hünikon südwestlich des Einlenkerbereichs der Hünikerstrasse überquert die Kantonsstrasse den Hünikerbach mit einem Brückenbauwerk. Im Zuge der Belagsanierung der Kantonsstrasse werden auch grössere bauliche Unterhaltsarbeiten am Brückenbauwerk ausgeführt. Aufgrund der anstehenden Brückenbauarbeiten wird die Kantonsstrassenverbindung zwischen Bis- segg und Bussnang unterbrochen. Die Umleitung des Transit- und Schwerverkehrs wird durch das kantonale Tiefbauamt über Affeltrangen-Märwil-Rothenhausen signalisiert. Die Fussgängerverbindung zwischen Hünikon und Bissegg bleibt mit einem provisorischen Fuss- gängersteg über den Hünikerbach gewährleistet. Bauphase 1, 22.05.2018 bis 2.07.2018 Brückenbau: Sanierung Bachdurchlass Hünikerbach Strassenbau: Ersatz Randabschlüsse und Anpassung Entwässerungen in den Abschnitten: - Bissegg bis BD Hünikerbach in Hünikon (Brückenbaustelle) - Bussnang bis Strassenkreuzung in Hünikon Verkehrsführung: Sperrung Kantonsstrasse K27, Bissegg bis Dorfeingang -

Einladung Zur 22. Jahresversammlung Donnerstag, 23. April 2020, 19.30 Uhr, Im Alterszentrum Bussnang Um 18.30 Uhr Serviert Das A
Einladung zur 22. Jahresversammlung Donnerstag, 23. April 2020, 19.30 Uhr, im Alterszentrum Bussnang Um 18.30 Uhr serviert das Alterszentrum für Fr. 12.– einen feinen Imbiss. Spitex Thur-Seerücken Spitex-Dienste für die politischen Gemeinden Amlikon-Bissegg, Bussnang, Märstetten, Raperswilen, Wäldi Inhaltsverzeichnis Traktandenliste 4 Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25. April 2019 6 Jahresbericht des Präsidenten 12 Jahresberichte der Ressorts 14 Jahresbericht der Betriebsleiterin 17 Bilanz 2019 19 Rechnung 2019 / Budget 2020 20 Anhang zur Jahresrechnung 2019 22 Kurzkommentar zu Jahresrechnung und Budget 25 Revisionsbericht 27 Grafiken 28 Wahl neuer Vorstandsmitglieder 29 Statistische Angaben 30 Tarife 31 Vorstand und Mitarbeitende 32 3 Traktandenliste 1. Begrüssung: Diana Manser, Gemeinderätin, Märstetten 2. Wahl von zwei Stimmenzählern 3. Protokoll der Jahresversammlung vom 25. April 2019 4. Jahresberichte des Präsidenten und der Betriebsleiterin 5. Rechnung 2019 Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung den Gewinn von Fr. 9‘769.56 auf die neue Rechnung (Kto. 2980 Gewinn-/Verlustvortrag) vorzutragen. 6. Budget 2020 7. Wahl der neuen Vorstandsmitglieder • Silvia Zwick • Nadine Wiesli 8. Verabschiedung der zurücktretenden Vorstandsmitglieder • Franziska Zeller • Regina Broger 9. Anträge 10. Diverses und Umfrage 4 Pause mit Kaffee und Dessert offeriert von der Gemeinde Märstetten ********* Wer Yvonne Eigenmann im Internet sucht, findet Ihre Webseite «Musig fürs Herz». Yvonne Eigenmann ist leidenschaftliche Schwyzerörgeli-Spielerin. Das Musizieren bereitet ihr Freude und begleitet Yvonne Eigenmann seit ihrer frühesten Kindheit. Unter dem Motto: «Musik ist die Nahrung der Seele» wird sie uns an unserer Jahresversammlung mit ihrem Schwyzerörgeli unterhalten, faszinieren und im Herzen berühren. ********* 5 Kurzprotokoll der 21. Jahresversammlung vom 25. April 2019 Datum: Mittwoch, 25. April 2019, 19.30 – 20.40 Uhr Ort: Alterszentrum Bussnang Traktanden: 1. -

OSTWIND–Zürcher Verkehrsverbund
OSTWIND–Zürcher Verkehrsverbund 116 Uhwiesen Schloss Laufen a. Rh. Mannenbach- Dachsen Berlingen Salenstein Wildensbuch Benken ZH Etzwilen Neubrunn- Grenzstein Steckborn Ulmenhof 162 954 Salenstein Rheinau Stein am Rhein Hörhausen Stammheim Eschenz Hörhausen Fruthwilen Rudolfingen Trüllikon Hö Freihof Hochstr. Guntalingen rh Marthalen a usen Fischbach TG Oerlingen Truttikon Waltalingen 952 Mammern Post Ossingen Oberstamm- Homburg Marthalen heim Raperswilen Lanzenneunforn Illhart Nussbaumen Engwilen 161 Bornhausen Unterhörstetten Rafz 115 Oberneunforn 953 Connyland Sonterswil Wil ZH Kalchrain Dettighofen 958 920 Hüttwilen Dotnacht Kleinandelfingen Müllheim Wagerswil Herdern Pfyn Hüntwangen Buch Engwang Hugelshofen Andelfingen Niederneunforn 114 Weckingen Wigoltingen Gütighausen Warth Wasterkingen Adlikon Kartausen Märstetten 124 Dietingen Ittingen Weiningen Felben- Hüttlingen- Hüntwangen-Wil Rüdlingen Wellhausen Mettendorf Ottoberg Thalheim Uesslingen Müllheim- Berg Klarsreuti Altikon Wigoltingen 924 113 Flaach Volken Dorf 921 Buchberg 160 Weinfelden Kaiserstuhl AG Thalheim-Altikon Horgenbach Amlikon Kehlhof Henggart Ellikon 923 Humlikon an der Thur Frauenfeld 922 Bissegg Zweidlen Berg am MaureLeimbach Eglisau Irchel Dägerlen Fimmelsberg Bussnang Erlen Dinhard Marktplatz Bänikon Bürglen Rickenbach ZH Islikon Oppikon n Buch am Aesch bei Lustdorf Strohwilen Teufen Lüdem Rothenhausen Weiach Irchel Neftenbach 163 Oberwil Thundorf h Glattfelden Sulgen Hettlingen Murkart Friltschen Seuzach Gachnang Gerlikon 919 Reuti 118 Windlac Stettfurt Märwil