Über Soziale Innovationen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

How to Evaluate German Unification?
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Zapf, Wolfgang Working Paper How to evaluate German unification? WZB Discussion Paper, No. FS III 00-404 Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Zapf, Wolfgang (2000) : How to evaluate German unification?, WZB Discussion Paper, No. FS III 00-404, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/50191 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise -

How to Evaluate German Unification? Zapf, Wolfgang
www.ssoar.info How to evaluate German unification? Zapf, Wolfgang Veröffentlichungsversion / Published Version Arbeitspapier / working paper Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: SSG Sozialwissenschaften, USB Köln Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Zapf, W. (2000). How to evaluate German unification? (Veröffentlichung / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Sozialer Wandel, Institutionen und Vermittlungsprozesse, Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung, 00-404). Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-116371 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. -

Modernization Theory - and the Non-Western World
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Zapf, Wolfgang Working Paper Modernization theory - and the non-western world WZB Discussion Paper, No. P 2004-003 Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Zapf, Wolfgang (2004) : Modernization theory - and the non-western world, WZB Discussion Paper, No. P 2004-003, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/50239 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu Wolfgang Zapf Modernization Theory – and the Non-Western World* Best.-Nr. P 2004-003 Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) Juni 2004 Beim Präsidenten Emeriti Projekte * Paper presented to the conference "Comparing Processes of Modernization", University of Potsdam, December 15-21, 2003. -

Social Reporting in the 1970S and 1990S
Veröffentlichungen der Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung des Forschungsschwerpunktes Sozialer Wandel, Institutionen und Vermittlungsprozesse des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung FS III 99 - 404 Social Reporting in the 1970s and 1990s Wolfgang Zapf Februar 1999 Abteilung „Sozialstruktur und Sozialberichterstattung“ im Forschungsschwerpunkt III Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) • Reichpietschufer 50 • D - 10785 Berlin Telefon 030 - 25 491 - 0 * Paper presented to the conference on „Social Change in an Enlarging Europe: Welfare Development, Structural Change and Theoretical Approaches“. Workshop in the Collegi- um Budapest, May 15-16, 1998. SOCIAL REPORTING PAGE 2 WOLFGANG ZAPF Introduction In November 1997 and in February 1998 there were held two conferences commemorating important events in the development of social reporting in Germany: the publication of the first government report on the situation of the family in 1968 and the trade union congress on quality of life in 1972. At both conferences I gave a talk referring to an early paper of mine also from 1972, under the title „On the measurement of quality of life“ (Zapf 1972). In the following version I take up again the two main parts of that paper: the theoretical discussion about a broader concept of welfare (I) and the discussion about methods and institutions of social reporting (II). In conclusion, I briefly shall discuss probable effects and limits of social reporting today (III). I Concepts of welfare In 1972, the theoretical discussion about a broader concept of welfare was presented under the topic „the economics of qualitative growth“. First the concepts of social cost (Kapp) and external diseconomies (Mishan) were investigated with the result that externalities basical- ly are a function of the level of industrialisation, not of the system of the economy, i.e. -

Veröffentlichungen Nach Themen
Wolfgang Glatzer Professur für Soziologie Sozialstruktureller und kultureller Wandel Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse Fachbereich Gesellschaftswissenschaften Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Verzeichnis der Publikationen nach Themengebieten 1. Sozialstruktureller Wandel und Modernisierung 2 2. Lebensverhältnisse und Lebensqualität 4 3. Haushaltsproduktion und Technisierung 12 4. Wohlfahrtsstaat und Sozialpolitik 15 5. Sozialindikatoren und Sozialberichterstattung 18 6. Soziologie: Geschichte und Leistungspotential 23 7. Sonstige Autoren- und Herausgebertätigkeiten 24 2 1. Sozialstruktureller Wandel und Modernisierung Sozialstruktur. In: Günter Endruweit und Gisela Trommsdorf (Hrsg.), 1989: Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart, Enke, Bd. 3, S. 647-652 25. Deutscher Soziologentag 1990. Die Modernisierung moderner Gesellschaften - Sektionen, Arbeits- und Ad hoc-Gruppen, Ausschuß für Lehre. (Hrsg.), 1991: Opladen, Westdeutscher Verlag, 968 Seiten Recent Social Trends in West Germany. (Koautoren: Karl Otto Hondrich, Heinz Herbert Noll, Karin Stiehr, Barbara Wörndl), 1992: Frankfurt/New York, Campus, 549 pages Entwicklungstendenzen der Sozialstruktur. Soziale Indikatoren Bd. XV, (Hrsg.), 1992: Frankfurt/New York, Campus, 243 Seiten Convergence or Divergence - Comparing Recent Social Trends in Industrial Societies (Coeditors: Simon Langlois, Theodore Caplow, Henri Mendras), 1994: Frankfurt am Main/Montreal, Campus/McGill-Queen`s University Press, 329 Seiten The Changing Consumer in Germany (Coauthors: Klaus -

Social Indicators and Quality of Life Research: Background, Achievements and Current Trends
Heinz-Herbert Noll Social Indicators and Quality of Life Research: Background, Achievements and Current Trends At the beginning of the 21st century, social indicators and quality of life re- search are well-established fields of social science in many countries around the world. Numerous book publications, entries in handbooks and encyclo- paedias, specialised journals and newsletters, national and international pro- fessional organisations, conferences and congresses and not least regular courses taught within university curricula are some indications of the suc- cessful career of two rather new branches of social research. This article will summarise the background and objectives, the major approaches and appli- cations and will discuss some of the recent developments as well as further prospects of these multidisciplinary research fields. 1. Background and Objectives of the Social Indicators Movement and Quality of Life Research As a field of social science social indicators research was born in the United States in the mid-1960s. Actually it came into being as part of an attempt of the American space agency NASA to detect and anticipate the impact and side effects of the American space program on U.S. society. The project came to the conclusion that there was almost a complete lack of adequate data but also of concepts and appropriate methodologies for this purpose. Presumably it was Raymond Bauer, the director of this project, who invented the term and the basic concept of ‘social indicators’. In his definition, social indicators were “statistics, statistical series, and all other forms of evidence that enable us to assess where we stand and are going with respect to our val- ues and goals” (Bauer, 1966: 1). -

CURRICULUM VITAE Dr. Franz Rothenbacher Contact Franz
CURRICULUM VITAE Dr. Franz Rothenbacher Contact Franz Rothenbacher MZES, University of Mannheim D-68131 Mannheim Phone: +49(0)621–181–2831 Fax: +49(0)621–181–2803 [email protected] Research interests • Structures of social inequality in Europe • The European welfare states • Sociology of the family and demographic change in Europe • European social reporting Studies and degrees 1989 Dr. phil in sociology at the University of Mannheim 1982–88 Assistent lecturer at the University of Mannheim, chair Wolfgang Zapf 1982 Research assistent at the Special Research Group 3 (Sonderforschungsbereich 3 Frankfurt/Mannheim) 1981 Degree in sociology (diploma) of the University of Mannheim 1974–81 Study of sociology, psychology and social and economic history at the University of Mannheim Research projects 2002–2004 Social Structure, Social Security, and the Social Position of the Public Fritz Thyssen Service Sector: European Models and National Case Studies Foundation, Cologne Expert 1994–96 European Observatory on National Family Policies (EONFP), Brussels/York, England 2000 Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Vienna 2012 Fonds National de la Recherche Luxembourg (FNR), Luxembourg Recent publication list Dr. Franz Rothenbacher A. Books (author, co-author and editor) 1. Soziale Ungleichheit im Modernisierungsprozeß des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1989 (diss.) (395 pp.). 2. (author and editor, together with Peter Flora, Franz Kraus and Heinz-Herbert Noll) Social Statistics and Social Reporting in and for Europe. Bonn: InformationsZentrum Sozialwissenschaften (IZ), 1994 (Europe in Comparison – A Series of Guidebooks for the Social Sciences, ed. by Heinrich Best and Peter Flora, vol. 1) (332 pp.). -

The Euromodule. a New Instrument for Comparative Welfare Research
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Delhey, Jan; Böhnke, Petra; Habich, Roland; Zapf, Wolfgang Working Paper The Euromodule: a new instrument for comparative welfare research WZB Discussion Paper, No. FS III 01-401 Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Delhey, Jan; Böhnke, Petra; Habich, Roland; Zapf, Wolfgang (2001) : The Euromodule: a new instrument for comparative welfare research, WZB Discussion Paper, No. FS III 01-401, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/50210 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen -

For Approval W
FORApplied Research APPROVAL Quality Life DOI 10.1007/s11482-012-9199-1 Wolfgang Zapf—Pioneer of Social Indicators- and Quality of Life-Research Wolfgang Glatzer Received: 9 October 2012 /Accepted: 10 October 2012 # Springer Science+Business Media Dordrecht and The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) 2012 Wolfgang Zapf is the founder of social indicators research in Germany and he conceives it as the combination of monitoring of social change and measurement of A note to the reader: This biography was written with the consultation and approval of Wolfgang Zapf. W. Glatzer (*) Goethe-University Frankfurt am Main, Im Rothkopf 8, 61440 Oberursel, Germany e-mail: [email protected] FOR APPROVAL W. Glatzer quality of life. Early in the 1970’s when he first became interested in social reporting and quality of life research, Zapf invented the German welfare surveys, he promoted welfare research and contributed significantly to the promising sociological approach of social monitoring. One of his colleagues remarked to Wolfgang Zapf - and many would agree: “We are grateful to you, a person with an unusual mixture of clearness, modesty and irony”. In recognition for his groundbreaking and pioneering work in the field of social indicators and quality of life research, Wolfgang Zapf received the highest honor of the International Society for Quality of Life Studies in 2004, the Distinguished Quality of Life Researcher Award. What follows is a brief biography of this great and influential man. Wolfgang Zapf grew up in Frankfurt, Germany’s most scientifically advanced city at the time. This is where Goethe-University first introduced a diploma in sociology. -

HIWED - a Comparative Historical Research Projekt on Western Europe Flora, Peter
www.ssoar.info HIWED - a comparative historical research projekt on Western Europe Flora, Peter Veröffentlichungsversion / Published Version Sammelwerksbeitrag / collection article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Flora, P. (1980). HIWED - a comparative historical research projekt on Western Europe. In J. M. Clubb, & E. K. Scheuch (Eds.), Historical social research : the use of historical and process-produced data (pp. 524-532). Stuttgart: Klett-Cotta. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-326261 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. -

Soeppapers on Multidisciplinary Panel Data Research 146
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung www.diw.de SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research 146 Ute Hanefeld • Jürgen Schupp S The First Six Waves of SOEP - The Panel Project in the Years 1983 to 1989 Berlin, December 2008 SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research at DIW Berlin This series presents research findings based either directly on data from the German Socio- Economic Panel Study (SOEP) or using SOEP data as part of an internationally comparable data set (e.g. CNEF, ECHP, LIS, LWS, CHER/PACO). SOEP is a truly multidisciplinary household panel study covering a wide range of social and behavioral sciences: economics, sociology, psychology, survey methodology, econometrics and applied statistics, educational science, political science, public health, behavioral genetics, demography, geography, and sport science. The decision to publish a submission in SOEPpapers is made by a board of editors chosen by the DIW Berlin to represent the wide range of disciplines covered by SOEP. There is no external referee process and papers are either accepted or rejected without revision. Papers appear in this series as works in progress and may also appear elsewhere. They often represent preliminary studies and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be requested from the author directly. Any opinions expressed in this series are those of the author(s) and not those of DIW Berlin. Research disseminated by DIW Berlin may include views on public policy issues, but the institute itself takes no institutional policy positions. The SOEPpapers are available at http://www.diw.de/soeppapers Editors: Georg Meran (Dean DIW Graduate Center) Gert G. -
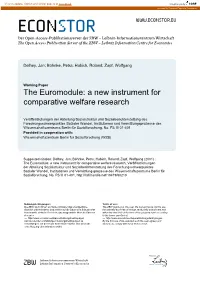
The Euromodule. a New Instrument for Comparative Welfare Research
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Research Papers in Economics econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics Delhey, Jan; Böhnke, Petra; Habich, Roland; Zapf, Wolfgang Working Paper The Euromodule: a new instrument for comparative welfare research Veröffentlichungen der Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung des Forschungsschwerpunktes Sozialer Wandel, Institutionen und Vermittlungsprozesse des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, No. FS III 01-401 Provided in cooperation with: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) Suggested citation: Delhey, Jan; Böhnke, Petra; Habich, Roland; Zapf, Wolfgang (2001) : The Euromodule: a new instrument for comparative welfare research, Veröffentlichungen der Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung des Forschungsschwerpunktes Sozialer Wandel, Institutionen und Vermittlungsprozesse des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, No. FS III 01-401, http://hdl.handle.net/10419/50210 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts the selected work free of charge, territorially unrestricted and beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen within the time limit of the term of the property rights according der unter to the terms specified at → http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen → http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu By the first use of the selected work the user agrees and vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die declares to comply with these terms of use.