Ehrenpreis an Hans Otte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Deutsche Nationalbibliografie 2016 T 04
Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2016 T 04 Stand: 20. April 2016 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2016 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-201512111762 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -

Fluxus Multiple Kunst Und Sound-Art Für Mönchengladbach Und Bremen
Das Magazin der Kulturstiftung der Länder 3 2018 FLUXUS MULTIPLE KUNST UND SOUND-ART FÜR MÖNCHENGLADBACH UND BREMEN WILHELM LEHMBRUCK IN STUTTGART SCHLESWIG-HOLSTEIN: DER SAMMLER GUSTAV FERDINAND THAULOW EDITORIAL damit unsere Sehgewohnheiten maßgeblich mitgeprägt hat. Andererseits zählte zu den zentralen Aspekten von Moderne Galerie Fluxus „die konzeptuelle, anti-kommerzielle und anti- „La cédille qui sourit“ institutionelle Ausrichtung“, wie Susanne Rennert in ihrem Beitrag zu Sammlung und Archiv Dorothee und Erik Andersch in diesem Heft betont (S. 22 –28). Das Hinterfragen gesellschaftlicher und politischer Kon- ventionen, formale und mediale Durchdringungen, die 01.09.2018 Auflösung einer starren Disziplinarität, all das wirkt wohltuend irritierend in einer Gegenwart, in der Ab- grenzungen, Partikularismen und regressive Nationalis- — 13.01.2019 men an politischem Einfluss gewinnen und Einzug in gesellschaftliche Diskurse halten. Die Erwerbung von Sammlung und Archiv Dorothee und Erik Andersch für das Städtische Museum Abteiberg Mönchenglad- bach sowie der Sound Collection Guy Schraenen für Slevogt die Bremer Weserburg, die die Kulturstiftung der Län- der gemeinsam mit ihren Partnern ermöglichen konnte, Prof. Dr. Markus Hilgert, Generalsekretär der ist damit nicht zuletzt ein deutliches Signal der födera- Kulturstiftung der Länder len Kulturförderung zur Stärkung derjenigen Kräfte in unserer Gesellschaft, die diesen Tendenzen intellektuel- und Frankreich Liebe Leserinnen und Leser, ler und kultureller Erstarrung entgegenwirken wollen. Werke der Fluxus-Bewegung sind heute auch noch werden Sie gern verunsichert? Schätzen Sie es, wenn Sie in anderer Hinsicht relevant: Ihre vielfach prekäre Ma- Cézanne liebgewordene Sichtweisen in Frage gestellt sehen? Als terialität verweist auf die erheblichen Herausforderun- Johannes Cladders, Direktor des Städtischen Museums gen kulturbewahrender Einrichtungen beim Erhalt des Courbet in Mönchengladbach, im Juni 1969 eine Ausstellung materiellen Kulturerbes des 20. -

Ambient Music the Complete Guide
Ambient music The Complete Guide PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Mon, 05 Dec 2011 00:43:32 UTC Contents Articles Ambient music 1 Stylistic origins 9 20th-century classical music 9 Electronic music 17 Minimal music 39 Psychedelic rock 48 Krautrock 59 Space rock 64 New Age music 67 Typical instruments 71 Electronic musical instrument 71 Electroacoustic music 84 Folk instrument 90 Derivative forms 93 Ambient house 93 Lounge music 96 Chill-out music 99 Downtempo 101 Subgenres 103 Dark ambient 103 Drone music 105 Lowercase 115 Detroit techno 116 Fusion genres 122 Illbient 122 Psybient 124 Space music 128 Related topics and lists 138 List of ambient artists 138 List of electronic music genres 147 Furniture music 153 References Article Sources and Contributors 156 Image Sources, Licenses and Contributors 160 Article Licenses License 162 Ambient music 1 Ambient music Ambient music Stylistic origins Electronic art music Minimalist music [1] Drone music Psychedelic rock Krautrock Space rock Frippertronics Cultural origins Early 1970s, United Kingdom Typical instruments Electronic musical instruments, electroacoustic music instruments, and any other instruments or sounds (including world instruments) with electronic processing Mainstream Low popularity Derivative forms Ambient house – Ambient techno – Chillout – Downtempo – Trance – Intelligent dance Subgenres [1] Dark ambient – Drone music – Lowercase – Black ambient – Detroit techno – Shoegaze Fusion genres Ambient dub – Illbient – Psybient – Ambient industrial – Ambient house – Space music – Post-rock Other topics Ambient music artists – List of electronic music genres – Furniture music Ambient music is a musical genre that focuses largely on the timbral characteristics of sounds, often organized or performed to evoke an "atmospheric",[2] "visual"[3] or "unobtrusive" quality. -

A Place to Ply Their Wares with Dignity: American Composer-Performers in West Germany, 1972
The Twentieth Century and Beyond A Place to Ply Their Wares with Dignity: American Composer-Performers in West Germany, 1972 Amy C. Beal Downloaded from Reflecting on their careers at home and abroad, several American com- mq.oxfordjournals.org posers (including Earle Brown, Alvin Curran, Gordon Mumma, Frederic Rzewski, David Tudor, and Christian Wolff) cite German support that rewarded them generously for their work, kept them “in business,” and allowed them to “survive” professionally.1 In fact, West German individ- uals and institutions have played a leading role in the production and dissemination of postwar American experimental music—a tradition at Univ. of California, Santa Cruz on November 22, 2010 rooted in the music of Charles Ives, Henry Cowell, and John Cage. Especially since the 1950s, German engagements helped shape much of the history of that branch of composition and performance. The Ger- man reception of American music was not free of tension: in the 1950s German audiences came to know Cage’s ideas only cautiously, and some- times with great hostility; in the 1960s the West German new-music community polarized in vigorous acceptance or bitter rejection of those ideas. Despite years of official ambivalence about radical new composi- tions from the United States, performances of experimental music in- creased dramatically during the early 1970s.2 West German interaction with American experimental music between the end of World War II in 1945 and reunification in 1990 peaked, in a series of new-music festivals, in 1972. A handful of influential West German cultural administrators, music critics, composers, and performers deserve credit as champions of American experimentalism (see Table 1). -

Deutscher Klangkunst-Preis 2006 Marler Kkunst Kat06.Qxd 11.10.2006 11:42 Uhr Seite 2
Marler_Kkunst_Kat06.qxd 11.10.2006 11:42 Uhr Seite 1 Deutscher Klangkunst-Preis 2006 Marler_Kkunst_Kat06.qxd 11.10.2006 11:42 Uhr Seite 2 Skulpturenmuseum Glaskasten Marl KulturRadio WDR 3 Initiative Hören Freundeskreis Habakuk zur Förderung des Skulpturenmuseums Glaskasten Marl Kunststiftung NRW, Düsseldorf gefördert vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Sparkasse Vest Recklinghausen Marler_Kkunst_Kat06.qxd 11.10.2006 11:42 Uhr Seite 3 Ausstellung zum Deutschen Klangkunst-Preis in Marl 2006 Skulpturenmuseum Glaskasten Marl 2. September bis 22. Oktober 2006 Marler_Kkunst_Kat06.qxd 11.10.2006 11:42 Uhr Seite 4 Marler_Kkunst_Kat06.qxd 11.10.2006 11:42 Uhr Seite 5 Inhalt Vorwort Deutscher Klangkunst-Preis 2006 6 Prof.Karl Karst/Dr. Uwe Rüth Uwe Rüth: Auswertung 8 Stephan Wolters: Statistisches Ehrenpreise 13 Begründung für die Verleihung an Hans Otte 14 Hans Otte 19 Begründung für die Verleihung an Peter Vogel 20 Peter Vogel Preisträger/in Werner Cee 26 Preisträger / Realisation Roswitha von den Driesch/Jens-Uwe Dyffort 30 Preisträger/in / Realisation Robert Jacobsen 34 Preisträger / Realisation Produktionspreis des Kulturradios WDR 3 Miki Yui 40 small sounds Wettbewerbsbeiträge 46 Pierre-Laurent Cassière 48 Marianne Greve 50 Hanna Hartman 52 Jan Jacob Hofmann 54 Timo Kahlen 56 Burkard Schmid Biografien 61 der beteiligten Künstlerinnen und Künster 71 Impressum 5 Marler_Kkunst_Kat06.qxd 11.10.2006 11:42 Uhr Seite 6 Vorwort »Trotz aller Trennungsstrukturen, der ganzen Arbeitsteilung, der Ideologien, festen Vorstellungen, Systeme, trotz des Parteienstaats und allem, was einen pausenlos trennen und teilen will, habe ich im Grund den Wunsch, ganz zu sein…« Hans Otte Hans Otte, gemeinsam mit Peter Vogel Ehrenpreis- Museum für die bildenden Künste dem Optischen ver- träger des Deutschen Klangkunst-Preises 2006, hat in pflichtet. -
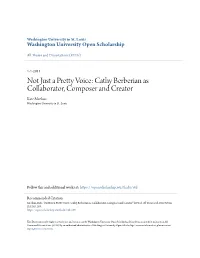
Not Just a Pretty Voice: Cathy Berberian As Collaborator, Composer and Creator Kate Meehan Washington University in St
Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship All Theses and Dissertations (ETDs) 1-1-2011 Not Just a Pretty Voice: Cathy Berberian as Collaborator, Composer and Creator Kate Meehan Washington University in St. Louis Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/etd Recommended Citation Meehan, Kate, "Not Just a Pretty Voice: Cathy Berberian as Collaborator, Composer and Creator" (2011). All Theses and Dissertations (ETDs). 239. https://openscholarship.wustl.edu/etd/239 This Dissertation is brought to you for free and open access by Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in All Theses and Dissertations (ETDs) by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS Department of Music Dissertation Examination Committee: Peter Schmelz, Chair Bruce Durazzi Craig Monson Anca Parvulescu Dolores Pesce Julia Walker NOT JUST A PRETTY VOICE: CATHY BERBERIAN AS COLLABORATOR, COMPOSER AND CREATOR by Kate Meehan A dissertation presented to the Graduate School of Arts and Sciences of Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy May 2011 Saint Louis, Missouri copyright by Kate Meehan 2011 Abstract During her relatively brief career, Cathy Berberian (1925-83) became arguably the best- known singer of avant-garde vocal music in Europe and the United States. After 1950, when she married Italian composer Luciano Berio, Berberian premiered almost thirty new works by seventeen different composers and received the dedications of several more. Composers connected to her include: John Cage, Igor Stravinsky, Darius Milhaud, Sylvano Bussotti, Henri Pousseur, Bruno Maderna, Bernard Rands, Roman Haubenstock- Ramati, and of course, Berio. -

Dieser Artikel Wurde Von Ingo Ahmels Im April 2006 Leicht Verän- Dert in Die Web-Enzyklopädie »Wikipedia« ( Ein- Gestellt
© Dieser Artikel wurde von Ingo Ahmels im April 2006 leicht verän- dert in die Web-Enzyklopädie »Wikipedia« (www.wikipedia.de) ein- gestellt. Nachfragen bitte an: [email protected] Hans Otte * 3. Dezember 1926 lebt seit 1959 als Musiker und Intermediakünstler in Bremen (Rund- den »absolutistischen Neue-Musik- Tempeln« als »politisch inkorrek- funkveranstalter bis 1984, Organist und Pianist bis 1998, Text- und te Gestaltungsmittel verfemt« waren. Musiktheaterautor, Klanginstallateur, bildender Künstler, Komponist). Exemplarisch offenbart sich Ottes traditionsgeschulter Sinn für neuen Hans (Günther Franz) Otte wurde am 3. Dezember 1926 im vogt- Klang im zwölfteiligen Klavierzyklus »Das Buch der Klänge« (OWV ländischen Plauen geboren. Er entstammt einer musikliebenden 42, 1979-82). Unter behutsamer Aufhebung der europäischen Apothekerfamilie und wuchs bei Breslau (heute Wrozlaw) auf. Schon Klaviertradition kondensierte er hier – mit Spuren zu Schubert, mit fünf Jahren war er fasziniert von den Künsten, ersann Dramen Chopin, Debussy, Ravel, Satie und der amerikanischen Minimal Music und inszenierte sie im Familienkreise auf selbstgebauten – eine raffinierte, stets fließende Synthese alter und neuer Klang- und Miniaturbühnen. Formenwelten. Das Buch der Klänge, eine für Werke zeitgenössischer E-Musik geradezu populäre Komposition, wurde bisher – in Ottes Die pianistische Grundausbildung erhielt er seit Mitte der 30er-Jahre eigener Aufnahme von 1983 – weltweit vielfach verbreitet. Dieses z. bei Bronislaw von Pozniak. Seither komponierte er -
Tompkins on Beal, 'New Music, New Allies: American Experimental Music in West Germany from the Zero Hour to Reunification'
H-German Tompkins on Beal, 'New Music, New Allies: American Experimental Music in West Germany from the Zero Hour to Reunification' Review published on Sunday, April 1, 2007 Amy C. Beal. New Music, New Allies: American Experimental Music in West Germany from the Zero Hour to Reunification. Berkeley: University of California Press, 2006. xvi + 340 pp. $49.95 (cloth), ISBN 978-0-520-24755-0. Reviewed by David Tompkins (Department of History, Carleton College) Published on H-German (April, 2007) Experience and Experiments Abroad In this meticulously researched monograph, Amy Beal offers an exhaustively detailed picture of the West German reception of a segment of post-World War II American music from 1945 to 1989. She focuses on American "experimental music," which she defines as originating from Charles Ives and Edgard Varèse, who "provided later composers with alternatives to Stravinsky-influenced neoclassicism or Schoenbergian serialism" (p. 2). Its main figures after 1945 included John Cage, Morton Feldman, Conlon Nancarrow, Steve Reich, Frederic Rzewski, David Tudor, Christian Wolff, and La Monte Young. These unconventional men (Pauline Oliveros is the only female composer to appear occasionally) were generally neither academics nor connected to institutions. They sought to develop new sounds and their works often proved difficult to subject to traditional forms of musical analysis. Beal does not analyze these musical works or provide the reader with a sense of their sound, but rather focuses on the social and personal networks surrounding this music. West Germany's state-subsidized musical life provided significant opportunities for American composers, and included festivals, radio play, exchange programs, private recitals, and of course public concerts. -

Hans Otte Sound of Sounds
hans otte PDF version 1.0 081020 sound of sounds edition :dacapo: joana gama hans otte – sound of sounds ingo ahmels A 10 de Maio de 2010 recebi um – Studien zum künstlerischen Contra todo o tipo de obstáculos, email de um amigo com o título Schaffen e assistente de Hans para mim foi um grande prazer “Hans Otte”. O email continha Otte desde 1995 até a morte do trabalhar, como co-curador, com apenas a frase “Para o caso de compositor, em 2007. a Joana Gama. não conheceres…" e, como anexo, o primeiro andamento do Considerando a relevância do tra- Como amantes de música, nem Apoio ciclo para piano “O Livro dos balho artístico de Hans Otte crises económicas nem pandemi- Sons” / “Das Buch der Klänge” Goethe-Institut Lisboa interpretado pelo próprio compo- (música, texto e instalações sono- as nos iriam, de maneira alguma, :dacapo: gGmbH, Bremen CESEM – NOVA FCSH sitor. ras), propus a Ingo Ahmels a co- impedir de prosseguir caminho curadoria de um ambicioso pro- com o "sound of sounds". Esta publicação teve apoio do De facto desconhecia o composi- CESEM – Centro de Estudos de Sociologia jecto de apresentação de Hans e Estética Musical da NOVA FCSH, tor e esta música, que me cativou Otte em Portugal. Este projecto, Tal como o Goethe-Institut financiado por fundos nacionais através desde o primeiro momento e que que envolve diversas instituições Lissabon, todos os nossos parcei- da Fundação para a Ciência e a me levou a ouvir todo o ciclo e a Tecnologia, I.P,. em Portuguesas e Alemãs, não ros mostraram uma grande con- querer saber mais sobre o homem no âmbito do projecto pôde acontecer, tal como idealiza- vicção em querer trazer a música por detrás da música. -

An Investigation of Zen Buddhism in Hans Otte's Book of Sounds
Refracted Zen in the Art of Composition: An Investigation of Zen Buddhism in Hans Otte’s Book of Sounds Tysen Dauer The scant secondary literature about Hans Otte often locates the influence of Zen Buddhism in his compositions dat- ing from the 1990s. While Otte’s interest in and exposure to Zen Buddhism peaks in that decade, the composer had already begun exploring Zen Buddhism in the 1960s. Otte’s Book of Sounds (1979-1982) was written after the composer had taken up the practice of zazen meditation, read the writings of D. T. Suzuki and Zen-obsessed guru, Rajneesh, and worked with American composers interested in Zen Buddhism and Eastern thought. These interests and influ- ences are evident in the visual art, design, notation, aesthetic goals and musical techniques used in The Book of Sounds, as well as in Otte’s use of language in his introduction to the composition. Identifying the influences of Zen Buddhism in The Book of Soundsalso places the work within the larger history of the popularization of Zen Buddhism in the West. 59 60 Tysen Dauer The contemporary cultural saturation of Zen Buddhism in the West has a history extending at least as far back as Schopenhauer, who believed that his own philosophy of Vorstellung was a kindred spirit with Buddhism.1 While the influence of Zen Buddhism on American artists and composers like John Cage has been well documented, composers in Europe were also interacting with Zen and other Buddhisms, particu- larly after World War Two.2 German composer Hans Otte, for example, began investigating Zen Buddhism and meditation in the 1960s, yet the reception of his work only locates the influence of Zen in later com- positions.3 In 1979, when Hans Otte began writing Das Buch der Klänge or The Book of Sounds (1979-1982), Buddhism in Europe was begin- ning to transition from a scholarly topic towards institutionalization and popularization.4 Otte had come to know the “core Buddhist literature” (Buddhist sacred texts) as well as the works of D. -

Anne Thurmann-Jajes, Dr
Biografie und Curriculum Vitae Dr. Anne Thurmann-Jajes Leiterin Studienzentrum für Künstlerpublikationen in der Weserburg | Museum für moderne Kunst Teerhof 20, 28199 Bremen Telefon: 0421/53939-40, Telefax: 0421/505247 E-Mail: [email protected] Website: www.thurmann-jajes.de Ausbildung: 1981 Abitur, Kippenberg Gymnasium, Ennepetal 1981-1987 Studium der Kunstgeschichte mit den Nebenfächern Orientalistik und Publizistik / Kommunikationswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum 1989 Forschungsaufenthalt in Rom, Italien, u.a. Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivo Secreto im Vatikan, Bibliotheca Hertziana 1993 Promotion, Ruhr Universität Bochun 1995 - 1996 Qualifizierung Fremdenverkehrs- und Veranstaltungsmanagement Beruflicher Hintergrund: 1993 - 1997 Freiberufliche Tätigkeit als Ausstellungsmacherin und Autorin 1997 - 1999 Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Neues Museum Weserburg Bremen seit 1999 Leiterin des Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Weserburg - Museum für moderne Kunst, Bremen Lehrtätigkeit: 1996 - 2000 Freiberufliche Dozentin für Erwachsenenbildung 1999 - 2000 Lehrbeauftragte an der Universität Bremen, Fachbereich 9, Institut für Kunstwissenschaft /und Kunstpädagogik 2000 - 2003 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen, Fachbereich 9 / Kunstwissenschaft für den besonderen Forschungsbereich der Künstlerpublikationen seit 2003 Lehrbeauftragte an der Universität Bremen, Fachbereich 9 Institut für Kunstwissenschaft / Kulturwissenschaften 1 Berufliche Tätigkeiten: 2005 - 2008 Vorstandsmitglied -

The Reconstruction of Post-War West German New Music During the Early Allied Occupation
The Reconstruction of Post -War West German New Music during the early Allied Occupation (1945 -46), and its Roots in the Weimar Republic and Third Reich (1918 -45) PhD Submission, 2018 Cardiff University Ian Pace Abstract This thesis is an analysis of the development of new music in occupied Germany from the end of World War Two, on 8 May 1945, until the end of 1946, in terms of the creation of institutions for the propagation of new music, in the form of festiva ls, concert series, radio stations, educational institutions and journals focusing on such a field, alongside an investigation into technical and aesthetic aspects of music being composed during this period. I argue that a large number of the key decisions which would affect quite fundamentally the later trajectory of new music in West Germany for some decades were made during this period of a little over eighteen months. I also argue that subsequent developments up to the year 1951, by which time the infra structure was essentially complete, were primarily an extension and expansion of the early period, when many of the key appointments were made, and institutions created. I also consider the role of new music in mainstream programming of orchestras, opera h ouses, chamber music societies, and consider all of these factors in terms of the occupation policies of the three Western powers – the USA, the UK and France. Furthermore, I compare these developments to those which occurred in during the Weimar Republic and the Third Reich, of which I give an overview, and argue as a result that the post -war developments, rather than being radically new, constituted in many ways a continuation and sometimes distillation of what was in place especially in the Weimar years .