Alexander Von Pflaum
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ortrud Wörner-Heil Adelige Frauen Als Pionierinnen Der Berufsbildung Die Ländliche Hauswirtschaft Und Der Reifensteiner Verband
Ortrud Wörner-Heil Adelige Frauen als Pionierinnen der Berufsbildung Die ländliche Hauswirtschaft und der Reifensteiner Verband O rtrud Wörner-Hei l A D E L I G E F raU E N A L S P I O N I E R I N N E N D E R B E R U F S B IL D UNG Die ländliche Hauswirtschaft und der Reifensteiner Verband dank und Impressum Dank gebührt dem Reifensteiner Verband e. V. – Verein ehemaliger Reifensteiner für die großzügige Unterstützung bei der Drucklegung des Buches. Abbildung Umschlag : Maiden in der Wirtschaftlichen Frauenschule Obernkirchen, 1910. In der Mitte die spätere Schulvorsteherin Margarethe von Spies. Zitat Umschlag : Elizabeth Mary Annette Gräfin von Arnim, Elizabeth and her German Garden, Erstveröffentlichung London 1898. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar ISBN print : 978-3-89958-904-7 ISBN online : 978-3-89958-905-4 URN : http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0002-9055 © 2010, kassel university press GmbH, Kassel www.upress.uni-kassel.de Satz und Gestaltung : Jörg Batschi Grafikdesign, Kassel Printed in Germany Vorwort „Adel im Untergang“: dazu gehörte für Ludwig Renn (Arnold Vieth von Golßenau), den Autor dieses Romans, auch die pre- käre Situation junger adeliger Frauen, die im Kaiserreich – ge- fangen in den Normen ihres Standes – keinen Beruf ergreifen konnten, obwohl die ökonomische Lage vieler Adelsfamilien dies nahe legte. Vielmehr war ihre Jugendzeit mit der Vorberei- tung auf eine standesgemäße Ehe ausgerichtet ; gelang dies nicht, so blieb nur das Leben als Stiftsdame oder als arme Verwandte. -

Vignettes. the Legacy of Jewish Laupheim
Kilian von Steiner (1833–1903) Kilian of Steiner, the first of the six personalities intro- duced in this book, was born in 1833 and ennobled in 1895. He worked his entire life dedicated to the advance- ment of his native region of Württemberg in southern Germany and had a profound influence on the develop- ment of its finance sector. His family is the most impres- sive example of intergenerational social advancement within the Jewish community of Laupheim. Their willing- ness to assimilate into the cultural, religious and social surroundings played a significant role in their ascension. It is as well interesting to compare Steiner with Carl Laemmle, who was born a generation after him and in different social and economic conditions, yet also experi- enced great commercial success. Kilian of Steiner’s grandfather and his father both worked as peddlers. In 1836, Viktor Steiner, Kilian’s fa- ther, and his brother Heinrich, opened a corner store sell- ing leather goods. With their new business, they were able to rise above the class of Jewish small merchants to which they had belonged and to build a house and work beyond the confines of Judenberg, a Jewish district in Laupheim. The next step in their social advancement was to acquire the Grosslaupheim Castle from the state in 1843. Though the Jewish Emancipation Act of 1828 had conceded Jew- ish people more rights, the Steiner family nonetheless needed non-Jewish business partners in order to complete the purchase. Jewish people at that time were still not 11 allowed exclusive property rights to such estates. -

Lebensdaten Von Dr. Kilian Von Steiner
Lebensdaten des Geheimen Kommerzienrat Dr. jur. Kilian von Steiner 1833 - 1903 1833 Kilian von Steiner wurde am 9.Oktober 1833 in Laup- Er hatte die Gesellschaft umgewandelt in die heim Kapellenstraße 35 geboren. Er ist das achte Geschäftsform als Aktien-Gesellschaft. von insgesamt 12 Kindern des Simon Victor Steiner (1790-1865) undSophie Steiner geb. Reichenbach 1894 Der Besitz des Laupheimer-Schloßes mit (1799-1866) zahlreichen Ländereien ging an Kilian von Steiner über. 1853 Kilian von Steiner studierte Jura, Geschichte, Philo- sophie und Literatur in Tübingen und Heidelberg. 1895 Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BASF. 1843 Kaufte der Vater Viktor Steiner das Groß-Laup-heimer Schloß für 41000 Gulden. 1895 Kilian von Steiner erhielt von König Wilhelm II. das Ehrenkreuz der "Württembergischen 1859 K.v.Steiner wurde Rechtsanwalt in Heilbronn. Krone" und damit der persönliche Adel. 1865 Bedeutender Mitgründer der deutschen Partei. 1897 Kilian von Steiner gehörte bis 1901 dem Aufsichtsrat der Mauser-Werke Oberndorf an. 1869 Mitgründer der Württembergischen Vereinsbank später Deutsche Bank. 1903 Ab 25. April war Kilian von Steiner Vorsitzender der BASF. 1869 Familiengründung, Kilian Steiner vermählte sich mit Clothilde Bacher. ..... Stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei der deutschen Verlagsunion. 1870 Kilian von Steiner wurde Vater, sein erster Sohn heißt Victor gest. 1859. ..... Steiner war eine Hauptperson bei der Schaffung des Pulver- und Dynamit Kartells. 1872 Tochter Luise wurde geboren, gestorben 1932. ..... Er war Mitgründer der Ermstalbahn Metzingen- 1873 Gelang die Fusion der BASF mit Gustav Siegle Urach. und Rudolf Knosp in Stuttgart. ..... Kilian von Steiner war Mitgründer der Löwen- 1873 BASF-Aufsichtsratmitglied. bräu in München sowie der Ludwig-Löwe-AG in Berlin, der Laupheimer Werkzeugfabrik, der 1876 Zweiter Sohn wurde geboren, er heißt Adolf- Maschinenfabrik Berlin-Karlsruhe und der Wohlgemut (Mut), gestorben 1957. -
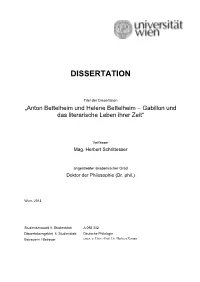
Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Anton Bettelheim und Helene Bettelheim – Gabillon und das literarische Leben ihrer Zeit“ Verfasser Mag. Herbert Schrittesser angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 332 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Deutsche Philologie Betreuerin / Betreuer: emer. o. Univ.-Prof. Dr. Herbert Zeman INHALT Seite Danksagung ………………………………………………………………………………….. 4 I. Einleitung 1) Allgemeines …………………………………………………………………………. 5 2) Das jüdische Bürgertum im Zeitalter Franz Josef I ………………………………… 11 a) Der emanzipierte jüdische Bürger zwischen deutschem Bürgertum, Literatur und Theater ………………………………………………………………………….. 24 b) Deutsche Bildung und christliche (jüdische) Ethik ……………………………. 36 II. Anton Bettelheim und Helene Gabillon – Biographischer Hintergrund 1) Anton Bettelheim: Herkunft und Ausbildung ……………………………………... 44 a) Die Schulzeit am Akademischen Gymnasium 1861 – 1869 ……………………. 47 b) Die Studienjahre 1869 – 1875 …………………………………………………... 49 i) Der „Leseverein der deutschen Studenten Wien’s“ ………………………… 51 ii) Die Eröffnung der Kaiser-Wilhelms-Universität in Strassburg …………….. 54 b) Die Zeit nach dem Studium – Der Weg zur biographischen Forschung ……...... 59 2) Helene Gabillon: Tochter der „Gabillons“ …………………………………………. 66 a) Ludwig Gabillon (1828 – 1896) ………………………………………………… 66 b) Zerline Gabillon (1835 – 1892) ………………………………………………….69 c) Helene Bettelheim –Gabillon; Kinder- und Jugendjahre ……………………….. 72 i) Der Hauslehrer Anton E. Schönbach (1848-1911) -

Bücherbestand Des PKC Nach Autoren
Bücherbestand Pädagogisch-Kulturelles Centrum Ehemalige Synagoge Freudental Stand 15.04.2021 Signatur Autor*in Titel Erscheinungsjahr Jc 4 Abdel-Samad, Hamed Mohamed. Eine Abrechnung 2015 Bj Abraham, Pearl Die Romanleserin 1995 / 1996 Ip Abulhawa, Susan Während die Welt schlief 2012 Al Ackermann, Frank Eine unbekannte Jugend. Schiller als Schüler 2009 Ir ADAC Reiseführer (Hg.) Israel o.J. Re ADAC Reiseführer (Hg.) Italien: Florenz 2009 Re ADAC Reiseführer (Hg.) Portugal: Algarve o.J. Re ADAC Reiseführer (Hg.) Weißrussland: Weißrussland o.J. Rr ADAC Reiseführer (Hg.) / Metzger, Christine USA: New York 1999 Jc 1 Adam, Schlomit Paulus und das Gesetz aus der Perspektive des frührabbinischen Judentums 1994 Db Adam, Thomas u.a. (Hg.) Oppenheimer. Eine jüdische Familie aus Bruchsal. Spuren-Geschichten-Begegnungen 2012 Dw Adams, Myrah / Maihoefer Schauplätze und Spuren. Jüdisches Ulm 1991 Dw Adams, Myrah / Schönhagen, Benigna Ein Gang durch die Stadt. Jüdisches Laupheim 1998 Js 1 Adler, David A. Froim. Der Junge aus dem Warschauer Ghetto 2011 Jw 3 Adler, Elkan Nathan Von Ghetto zu Ghetto. Reisen und Beobachtungen 1909 / 2001 Dw Adler, H.G. Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft 1955 Js 1 Adler, H.G. Der Kampf gegen die "Endlösung der Judenfrage" 1958 Js 3 Adler, H.G. Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft 1955 Jw 1 Adler, H.G. Die Juden in Deutschland. Von der Aufklärung bis zum Nationalsozialismus 1960 Js 1 Adler, Stanislaw in the warsaw ghetto 1940-1943. An account of a witness 1982 Jr Adler-Rudel, S. Ostjuden in Deutschland 1880-1940. 1959 Js 1 Adler-Rudel, S. Jüdische Selbsthilfe unter dem Naziregime 1933-1939 1974 Jw 1 Adler-Rudel, S. -

Vignettes. the Legacy of Jewish Laupheim
Udo Bayer Vignettes The Legacy of Jewish Laupheim Vignettes Udo Bayer Vignettes Udo Bayer Vignettes The Legacy of Jewish Laupheim Translation edited by Robynne Flynn-Diez Originally published as Udo Bayer: Jüdisches aus Laupheim. Prominente Persönlichkeiten einer Landjudengemeinde, erschienen beim Verlag Hentrich & Hentrich Berlin, ISBN 9783955651220 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. This work is published under the Creative Commons License 4.0 (CC BY-SA 4.0). The online version of this publication is freely available on the ebook-platform of the Heidelberg University Library heiBOOKS http://books.ub.uni-heidelberg.de/heibooks (open access). urn: urn:nbn:de:bsz:16-heibooks-book-229-6 doi: https://doi.org/10.11588/heibooks.229.301 Original Text © Udo Bayer / Gabriele Bayer Translation © 2017 Cover image: Elizaveta Dorogova ISBN 978-3-946531-51-7 (PDF) ISBN 978-3-946531-52-4 (Softcover) Introduction In honor of Dr. Udo Bayer this translation project was initiated by the Gesellschaft für Geschichte und Gedenken in collabora- tion with the University of Heidelberg, Germany. Master’s students from the Institute of Translation and Interpreting spent five months researching and translating the biographies of the personalities presented by Bayer in this brief collection of stories. Each chapter of Vignettes serves as a portrait of one of the distinguished figures, relating their family history, ca- reer, and how they were affected by the historical context in which they lived. It is only through Bayer’s extensive research and the resulting comprehensive archive that the narratives of the Laupheim German-Jewish community have been pre- served for future generations; and Vignettes extends these narratives to an English-speaking readership.